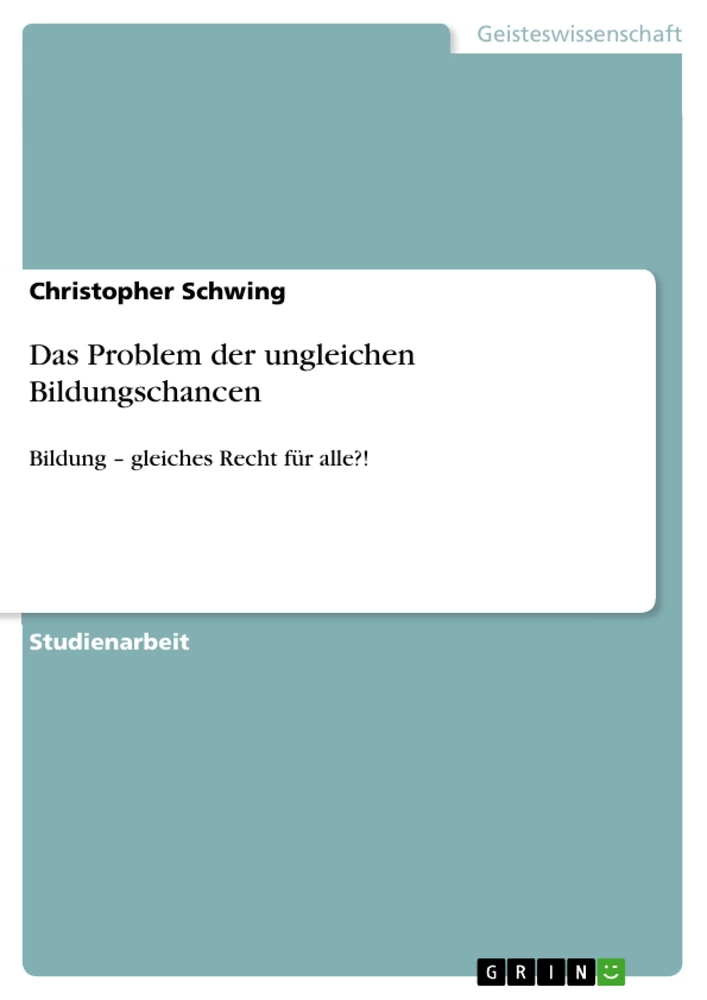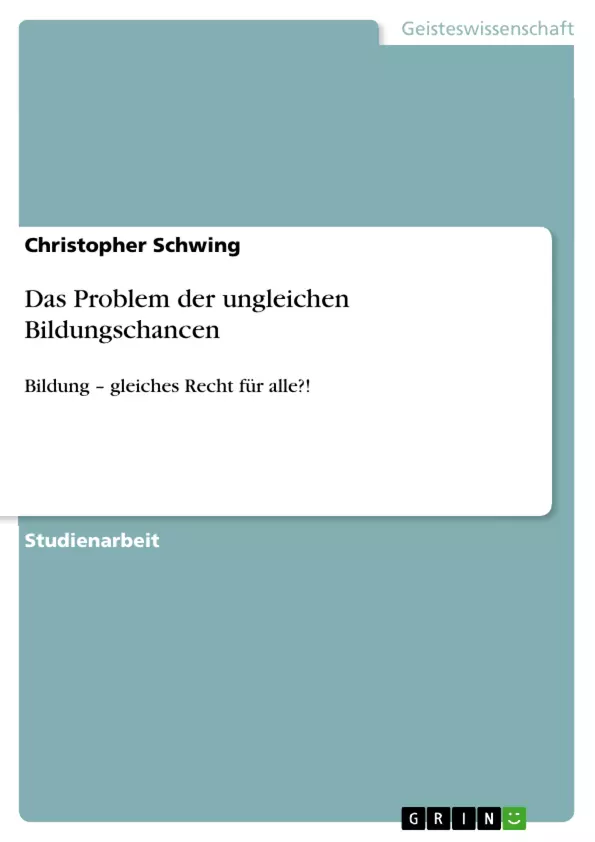Durch das deutsche Grundgesetz wird die Bundesrepublik Deutschland als demokratischer Sozialstaat definiert1. Dieses Staatsprinzip beschreibt das Bestreben, soziale Ungleichheit aufzuheben, sowie Gerechtigkeit zu etablieren. In dem Gleichheitsprinzip von Artikel 3 des Grundgesetzes wird klar formuliert, dass niemand auf Grund seines Geschlechts, seiner Herkunft, Rasse, Sprache oder religiösen Ansicht bevorzugt oder benachteiligt werden darf. Der Gesetzestext beinhaltet dabei lediglich den formalen Grundsatz, die praktische Umsetzung erweist sich in vielen Bereichen als problematisch.
Einer dieser Bereiche ist das Thema Bildung. Ergebnisse der letzten PISA-Studie werfen im internationalen Vergleich ein eher trübes Bild auf das deutsche Bildungssystem. Die Bildungsexpansion, die in den 60er Jahren mit dem Ziel einer Neustrukturierung des Bildungssystems betrieben wurde, sollte insbesondere zu mehr Chancengleichheit führen. Dies ist nur in Teilen gelungen. Mehrere soziologische Texte befassen sich mit den Verlierern und Gewinnern der Bildungsexpansion und zeigen auf, welche Schwachstellen das deutsche Bildungssystem immer noch aufweist.
Mit dem Ausbau der Schulformen wurde zwar ein erhöhtes Bildungsangebot geschaffen, doch Studien zeigen, dass die Chance auf Bildung stets von äußeren Einflüssen wie dem Geschlecht oder der Ethnie abhängig ist. Besonders umstritten ist das Konzept der Hauptschule, in dem viele Soziologen eine erhöhte Gefahr der sozialen Isolation sehen.
In dieser Hausarbeit werden zwei Texte zu dem Thema „Bildungsungleichheiten“ untersucht. Nach einer Darstellung der Aufsätze „Die Metamorphose der Arbeitertochter zum Migrantensohn“ von Rainer Geißler (2008) und „Die Zurückgelassenen – die soziale Verarmung der Lernumwelt von Hauptschülerinnen und Hauptschülern“, verfasst von Heike Solga und Sandra Wagner im Jahr 2010, und ihrer wichtigsten Thesen, werden weiterführende Überlegungen angestellt. Dabei geht es um eine kritische Betrachtung der bisherigen Expansion sowie eigene Einschätzungen, wie dem Problem der ungleichen Bildungschancen begegnet werden kann. Im Zentrum meiner Ansätze steht dabei die Frage nach dem Einfluss der sozialen Klasse auf die Bildungschance und die Bedeutung der familiären Ressourcen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schicht-, geschlechts- und ethniespezifische Bildungschancen nach Rainer Geißler
- Die Dimension der Schicht
- Die Dimension des Geschlechts
- Die Dimension der Ethnie
- Fazit
- Darstellung der Hauptthesen von Solga und Wagner
- Reflexion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Problem der ungleichen Bildungschancen in Deutschland. Sie analysiert zwei wissenschaftliche Aufsätze, die sich mit den Auswirkungen der Bildungsexpansion auf unterschiedliche soziale Gruppen befassen. Die Arbeit untersucht die Thesen von Rainer Geißler, der die Bildungschancen in Bezug auf Schicht, Geschlecht und Ethnie untersucht, sowie die Thesen von Heike Solga und Sandra Wagner, die sich mit der sozialen Verarmung der Lernumwelt von Hauptschülerinnen und Hauptschülern auseinandersetzen. Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Ursachen für die ungleichen Bildungschancen zu analysieren und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.
- Der Einfluss der sozialen Schicht auf die Bildungschancen
- Die Rolle des Elternhauses und der familiären Ressourcen
- Die Bedeutung des Bildungssystems und der institutionellen Rahmenbedingungen
- Die Herausforderungen der Integration von Migrantenkindern
- Die Folgen der sozialen Isolation von Hauptschülern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema „Bildungsungleichheiten" in den Kontext des deutschen Grundgesetzes und der Bildungsexpansion der 60er Jahre. Sie zeigt auf, dass trotz verbesserter Bildungsmöglichkeiten die Chancengleichheit nicht erreicht wurde und die Bildungschancen stark von sozialen Faktoren wie Schicht, Geschlecht und Ethnie beeinflusst werden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Thesen von Rainer Geißler, der die Bildungschancen in Bezug auf Schicht, Geschlecht und Ethnie untersucht. Geißler stellt fest, dass die Bildungsexpansion nicht zu einem Ausgleich der Chancengleichheit geführt hat, sondern die Chancenabstände zwischen privilegierten und benachteiligten Gruppen sogar vergrößert hat. Er analysiert die Rolle der sozialen Schicht, des Geschlechts und der Ethnie bei der Gestaltung von Bildungschancen und zeigt auf, dass Migranten aus bildungsschwachen Familien die größte Chancenungleichheit erfahren.
Das dritte Kapitel stellt die Hauptthesen von Heike Solga und Sandra Wagner dar, die sich mit der sozialen Verarmung der Lernumwelt von Hauptschülerinnen und Hauptschülern auseinandersetzen. Sie argumentieren, dass die soziale Segregation im deutschen Schulsystem zu einer herkunftsabhängigen Kanalisierung führt, die die Lernumwelt von Hauptschülern sozial verarmt und ihre Bildungschancen einschränkt. Sie kritisieren die Stigmatisierung von Hauptschülern als Schulversager und fordern die Abschaffung der Hauptschule und die Etablierung weiterer Gesamtschulen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die ungleichen Bildungschancen, die Bildungsexpansion, die soziale Schicht, das Elternhaus, die familiären Ressourcen, die institutionellen Rahmenbedingungen, die Integration von Migrantenkindern, die soziale Isolation von Hauptschülern, die Hauptschule, die Gesamtschule, Chancengleichheit, Bildungsungleichheit, Bildungskapital, Leistungsentwicklung, Lernumwelt, soziale Verarmung, Stigmatisierung, Bildungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es trotz Bildungsexpansion weiterhin Chancenungleichheit?
Studien zeigen, dass die Bildungschancen weiterhin stark von der sozialen Schicht, der Ethnie und dem Elternhaus abhängen. Die Expansion hat die Abstände zwischen privilegierten und benachteiligten Gruppen oft sogar vergrößert.
Welche Rolle spielt das Elternhaus für den Bildungserfolg?
Die familiären Ressourcen (Bildungskapital der Eltern, finanzielle Mittel) sind entscheidend für die Weichenstellung im Schulsystem und beeinflussen die Leistungsentwicklung maßgeblich.
Was kritisieren Solga und Wagner am Hauptschulkonzept?
Sie sehen in der Hauptschule eine Gefahr der sozialen Isolation und Stigmatisierung. Die soziale Segregation führt zu einer "verarmten Lernumwelt", die den Bildungsweg der Schüler massiv einschränkt.
Wie wirkt sich die ethnische Herkunft auf die Bildungschancen aus?
Migrantenkinder aus bildungsfernen Familien erfahren oft eine doppelte Benachteiligung, da sprachliche Barrieren und schichtspezifische Hürden zusammenwirken.
Was besagt Artikel 3 des Grundgesetzes im Kontext Bildung?
Artikel 3 garantiert, dass niemand wegen seiner Herkunft oder Sprache benachteiligt werden darf. Die Realität im Bildungssystem zeigt jedoch, dass dieser formale Grundsatz praktisch schwer umzusetzen ist.
- Arbeit zitieren
- Christopher Schwing (Autor:in), 2013, Das Problem der ungleichen Bildungschancen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212808