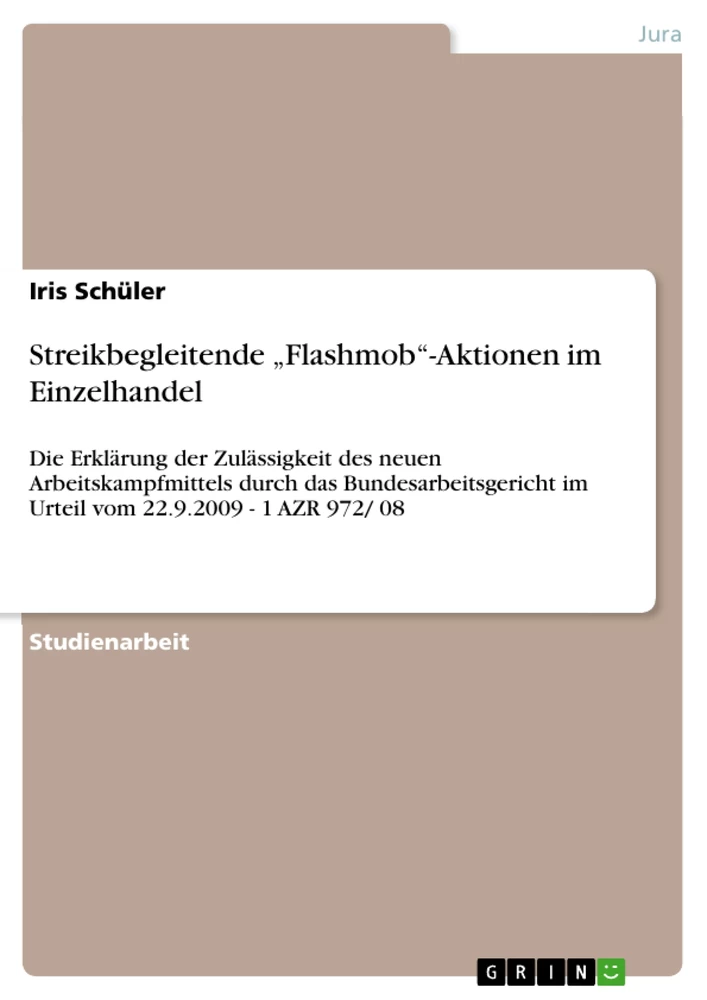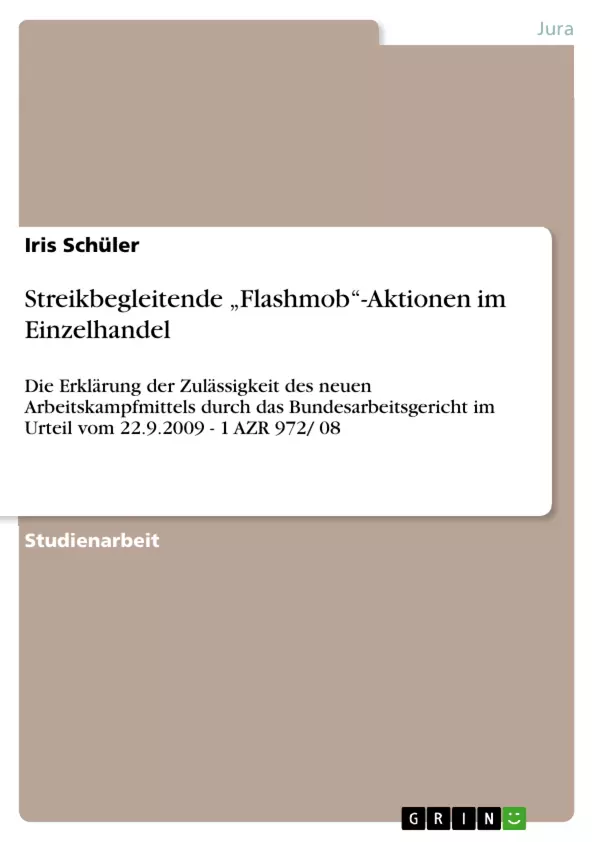In der Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 22.09.2009 zu streikbegleitenden Arbeitskampfmaßnahmen im Einzelhandel, etablierte und legitimierte sich eine neue Intensitätsstufe des Arbeitskampfes, die sogenannte arbeitskampfbezogene „Flashmob“-Aktion. Hierbei handelt es sich um plötzliche, kurzzeitige Zusammentreffen von Individuen, welche sich mittels elektronischer Kommunikation koordinieren, um einem laufenden Arbeitskampf Nachdruck zu verleihen. Das BAG klassifiziert Flashmobs als „nicht generell unzulässig“ und untermauert diese Einstufung mit der Aussage „Der damit verbundene Eingriff in den Gewerbebetrieb des Arbeitgebers kann aus Gründen des Arbeitskampfes gerechtfertigt sein“ .
Im Gegensatz zum traditionellen Arbeitskampfmittel des Streiks, bei dem der Betrieb durch die Zurückhaltung der Arbeitskraft passiv gestört wird, veranlassen Flashmobs eine aktive Störung. Sie dienen der Förderung des Abschlusses von Tarifverträgen und implizieren eine unterstützende Wirkung hinsichtlich der Durchsetzung von Arbeitskampfzielen.
Die Anwendung von Flashmobs steht unter dem Schutz der Betätigungsfreiheit der Gewerkschaften, welche auf Art. 9 Abs. 3 GG zurückzuführen ist. Ferner fällt in gleicher Weise die Wahl der Arbeitskampfmittel in dessen Schutzbereich. Es ist jedoch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit seinen Teilaspekten Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit zu beachten. Um diesen hinreichend bewerten zu können, ist die Möglichkeit der Verteidigung auf Arbeitgeberseite zu überprüfen. Das BAG verweist hierbei auf die Optionen der Ausübung des Hausrechts sowie der kurzfristigen Betriebsschließung. Doch stellen diese Gegenmaßnahmen realistische Reaktionsmöglichkeiten dar?
Die Meinungen divergieren jedenfalls stark. Auf Grund dessen beschäftigt sich diese Hausarbeit mit der Leitfrage nach der Legitimität von Flashmobs. Der erste Teil befasst sich mit der begrifflichen Bestimmung und Abgrenzung zu anderen Streikaktionen. Im Mittelpunkt steht hierbei die Differenzierung vom Arbeitskampfmittel des Streikes. Im zweiten Teil werden die Anerkennung des Flashmobs als Arbeitskampfmittel und seine Grenzen erörtert. Zunächst wird die Interpretation der koalitionsspezifischen Handlungsweisen im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG dargelegt. Im Anschluss wird der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Maßstab zur Beurteilung von Arbeitskampfmitteln aufgezeigt.Den dritten Teil bildet die kritische Auseinandersetzung mit der Legitimität von Flashmobs.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bestimmung und Abgrenzung von „Flashmob"-Aktionen
- Begriffliche Bestimmung des Terminus „Flashmob"
- Abgrenzung der Aktionsform „Flashmob" zur kollektiven Arbeitsniederlegung
- Der Flashmob als anerkanntes Arbeitskampfmittel und seine Grenzen
- Der Weg zur Legitimierung von „Flashmob"-Aktionen und die Interpretation der koalitionsspezifischen Verhaltensweisen im Sinne von Art. 9 Abs. 3 GG
- Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Maßstab zur Beurteilung von Arbeitskampfmitteln
- Kritische Würdigung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Zulässigkeit von „Flashmob"-Aktionen als Arbeitskampfmittel im Einzelhandel. Sie analysiert das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 22. September 2009, in dem das BAG diese Aktionsform als „nicht generell unzulässig" einstufte. Die Arbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Koalitionsfreiheit und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, sowie die Auswirkungen auf die Praxis des Arbeitskampfs.
- Begriffliche Bestimmung und Abgrenzung von „Flashmobs" zu anderen Arbeitskampfmaßnahmen
- Rechtliche Einordnung von „Flashmobs" im Kontext der Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG)
- Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf „Flashmobs" als Arbeitskampfmittel
- Kritische Würdigung der Argumentation des BAG und der Auswirkungen auf die Praxis des Arbeitskampfes
- Diskussion der möglichen Folgen und Herausforderungen, die mit der Zulässigkeit von „Flashmobs" verbunden sind
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz von „Flashmob"-Aktionen im Kontext des Arbeitskampfs. Sie beleuchtet die Besonderheiten dieser Aktionsform und die damit verbundenen Herausforderungen für das Arbeitskampfrecht.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der begrifflichen Bestimmung von „Flashmobs" und grenzt diese Aktionsform von anderen Arbeitskampfmaßnahmen ab, insbesondere vom Streik. Es werden die Merkmale und die Organisation von „Flashmobs" sowie die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten im Arbeitskampf beschrieben.
Im dritten Kapitel wird die Anerkennung von „Flashmobs" als Arbeitskampfmittel im Rahmen der Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) untersucht. Es wird die Interpretation des BAG hinsichtlich der koalitionsspezifischen Handlungsweisen und der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erläutert.
Das vierte Kapitel bietet eine kritische Würdigung des Urteils des BAG und beleuchtet die potenziellen Probleme und Risiken, die mit der Zulässigkeit von „Flashmobs" verbunden sind. Es werden Argumente gegen die Rechtmäßigkeit dieser Aktionsform und die Auswirkungen auf die Praxis des Arbeitskampfes diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Koalitionsfreiheit, Arbeitskampfmittel, Flashmob, Streik, Verhältnismäßigkeit, Tarifautonomie, Rechtmäßigkeit, Eingriff in den Gewerbebetrieb, Hausrecht, Betriebsschließung, Eskalation, Kritik, Rechtsentwicklung, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Kunden, Einzelhandel, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen
Sind Flashmobs im Arbeitskampf rechtlich zulässig?
Laut Bundesarbeitsgericht (BAG) sind arbeitskampfbezogene Flashmobs "nicht generell unzulässig", sofern sie verhältnismäßig sind.
Was unterscheidet einen Flashmob von einem normalen Streik?
Während ein Streik den Betrieb passiv durch Arbeitsniederlegung stört, verursacht ein Flashmob eine aktive Störung durch plötzliche Zusammentreffen.
Auf welcher rechtlichen Grundlage basieren Flashmob-Aktionen?
Sie fallen unter den Schutz der Betätigungsfreiheit der Gewerkschaften gemäß Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG).
Wie können sich Arbeitgeber gegen Flashmobs wehren?
Mögliche Gegenmaßnahmen sind die Ausübung des Hausrechts oder eine kurzfristige Betriebsschließung während der Aktion.
Welche Rolle spielt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz?
Die Aktion muss geeignet, erforderlich und angemessen sein, um das Ziel des Tarifvertragsabschlusses zu fördern, ohne den Betrieb übermäßig zu schädigen.
- Quote paper
- Iris Schüler (Author), 2011, Streikbegleitende „Flashmob“-Aktionen im Einzelhandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212860