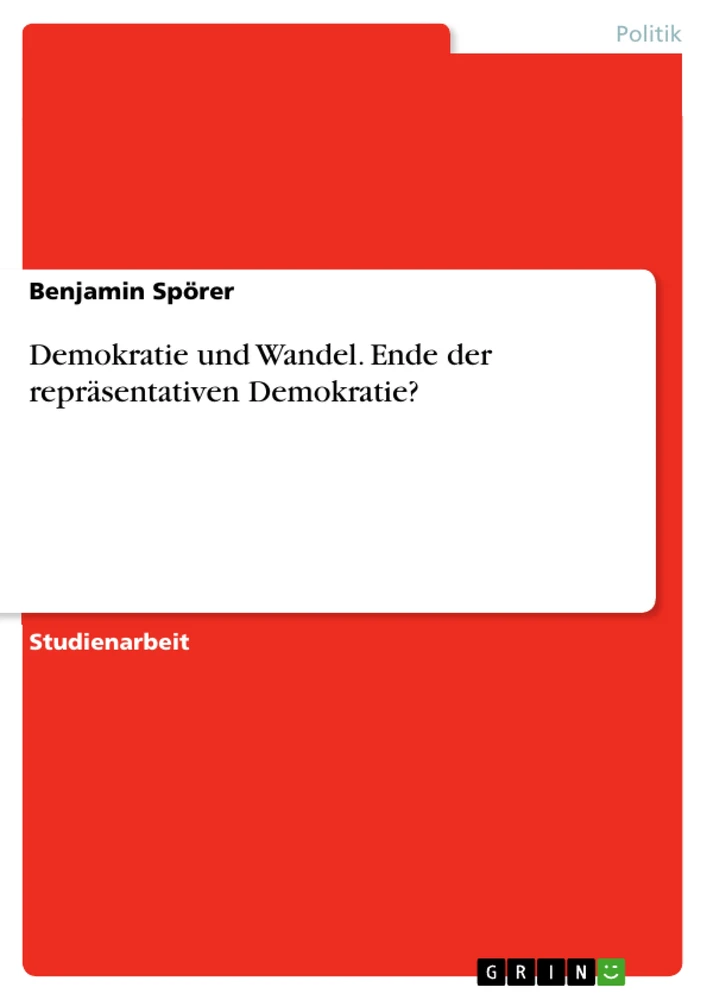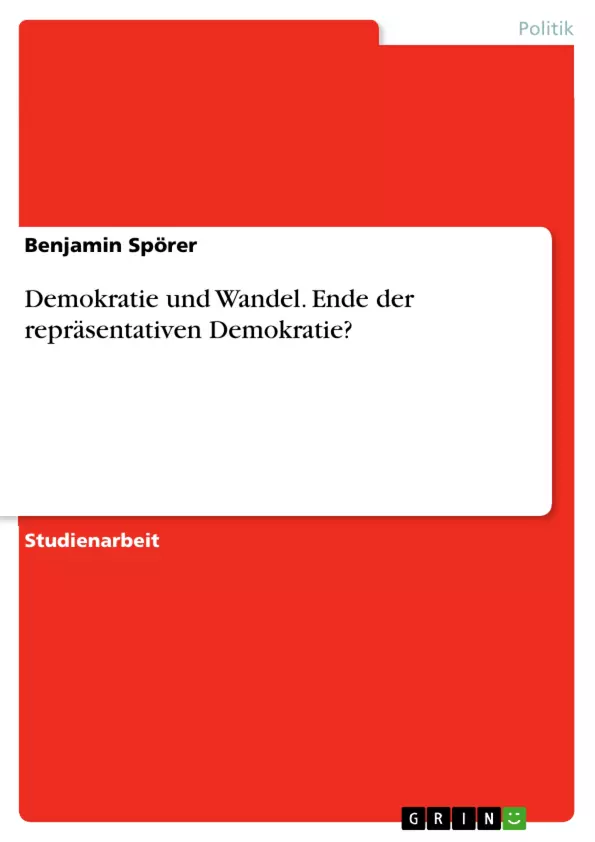Derzeit berichten die Nachrichten überall in Deutschland von Demonstrationen, Volksbegehren und schließlich auch von der Forderung nach mehr plebiszitären Elementen, wie den Volksentscheid auf Bundesebene. In Hamburg war es die Reform des Bildungssystems, in Bayern das Rauchverbot in öffentlichen Räumlichkeiten, in Stuttgart ist es der geplante Bau eines neuen Bahnhofes. Die Bürger nehmen zunehmend ihre Belange selber in die Hand, gehen auf die Straße und kämpfen darum politisch Gehör zu finden. Diese Umstände erwecken den Eindruck als hätte sich die politische Führung verselbstständigt und kein Ohr mehr für die Interessen der Bürger. Zudem sind eine sinkende Wahlbeteiligung, schrumpfende Parteien und ein öffentlicher Ansehensverlust der politischen Klasse zu verzeichnen. Die Feststellung einer Krise der Repräsentation führt schließlich zu der Frage, ob man in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch von einer repräsentativen Demokratie sprechen kann. Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Dazu wird zunächst die Krise der Repräsentation in ihrer Komplexität kurz umrissen. In dem darauf folgenden Abschnitt wird das Verhältnis zwischen Repräsentation und Demokratie analysiert. Hier wird mittels einer theoretischen Herangehensweise ermittelt, was das Repräsentative denn eigentlich ist. In den weiteren Punkten werden dann bestimmte Problemfelder analysiert, welche einerseits eine mögliche Ursache für den Mangel an Repräsentation darstellen und andererseits aber auch als Folge eines solchen Mangels zu verstehen sind. Es wird versucht die verschiedenen Entwicklungen herausstellen, die der Krise der Repräsentation zugrunde liegen. Um die Brisanz der Fragestellung zu verdeutlichen wird dabei auch auf mögliche Probleme für die Demokratie hingewiesen, die solchen Entwicklungen abhängig von ihrer Fortsetzung innewohnen. Auch wenn Entwicklungen auf globaler Ebene, wie der europäischen Integration, einen nicht unerheblichen Teil der Gründe für die heutige Repräsentationsproblematik ausmachen, ist die Analyse, aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit, auf Problemfelder und Entwicklungen die in erster Linie auf nationalstaatlicher Ebene zum Ausdruck kommen, beschränkt. Zum Ende werden dann noch mal die Zusammenhänge zwischen diesen Problemfeldern herausgestellt und in der Zusammenfassung verdichtet. Ob der Begriff der repräsentativen Demokratie noch berechtigt ist Anwendung zu finden, wird schließlich im Fazit beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Krise der politischen Repräsentation
- 2. Repräsentation und Demokratie
- 2.1 Demokratie und der immanente Zwang zur Repräsentation
- 2.1.1 Kritik am unmittelbaren Demokratiekonzept
- 2.1.2 Repräsentation als Prinzip menschlichen Seins
- 2.1.3 Schlussfolgerung
- 2.2 Repräsentation
- 2.1 Demokratie und der immanente Zwang zur Repräsentation
- 3. Problemfelder
- 3.1 Das Politische
- 3.2 Populismus
- 3.3 Medien
- 3.4 Lobbyismus
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Krise der Repräsentation in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, die Komplexität dieser Problematik zu beleuchten, das Verhältnis zwischen Repräsentation und Demokratie zu analysieren und zentrale Problemfelder zu identifizieren, die diese Krise hervorrufen oder verstärken.
- Die Krise der politischen Repräsentation im Kontext der Bundesrepublik Deutschland
- Das Verhältnis zwischen Repräsentation und Demokratie im Wandel
- Problemfelder wie Populismus, Medien und Lobbyismus
- Der Einfluss von Globalisierung und Europäisierung auf die Repräsentation
- Mögliche Folgen für die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Stand der Diskussion um die Krise der Repräsentation, indem sie auf Demonstrationen, Volksbegehren und die Forderung nach mehr plebiszitären Elementen verweist. Die sinkende Wahlbeteiligung, schrumpfende Parteien und der Ansehensverlust der politischen Klasse werden als Symptome dieser Krise dargestellt. Die Einleitung führt schließlich zur Fragestellung, ob man in Deutschland noch von einer repräsentativen Demokratie sprechen kann.
Kapitel 1 widmet sich der Komplexität der Krise der politischen Repräsentation. Es wird die Diskrepanz zwischen den Beschlüssen des Bundestages und der öffentlichen Meinung anhand von Umfragedaten verdeutlicht. Die Kritik an der mangelnden Repräsentanz verschiedener Berufsgruppen und Bevölkerungsgruppen, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, wird thematisiert. Die zunehmende Politikverdrossenheit, die durch eine abnehmende Wahlbeteiligung und den Ansehensverlust der politischen Klasse gekennzeichnet ist, wird als Folge dieser Diskrepanz analysiert.
Kapitel 2 untersucht das Verhältnis zwischen Repräsentation und Demokratie. Es wird das Prinzip der Repräsentation als Ausdruck menschlichen Seins und als notwendiges Element einer modernen Demokratie herausgestellt. Die Kritik an der unmittelbaren Demokratie und die Begründung für das Repräsentationsmodell werden dargelegt.
Kapitel 3 widmet sich verschiedenen Problemfeldern, die zur Krise der Repräsentation beitragen können. Die Bedeutung des Politischen, der Einfluss von Populismus, die Rolle der Medien und die Auswirkungen von Lobbyismus auf die politische Entscheidungsfindung werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Repräsentative Demokratie, politische Repräsentation, Krise der Repräsentation, Demokratie im Wandel, Populismus, Medien, Lobbyismus, Wahlbeteiligung, Politikverdrossenheit, Globalisierung, Europäisierung, Bundestagswahl, öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen
Befindet sich die repräsentative Demokratie in einer Krise?
Sinkende Wahlbeteiligung, schrumpfende Parteien und der Ansehensverlust der politischen Klasse deuten auf eine Krise der Repräsentation hin.
Warum fordern Bürger mehr direkte Mitbestimmung?
Viele Bürger haben das Gefühl, dass die politische Führung ihre Interessen nicht mehr ausreichend berücksichtigt, was zu Forderungen nach Volksentscheiden führt.
Welchen Einfluss hat Lobbyismus auf die Demokratie?
Lobbyismus wird als Problemfeld analysiert, das die politische Entscheidungsfindung beeinflusst und zu einem Mangel an Repräsentation führen kann.
Was ist der "immanente Zwang zur Repräsentation"?
Theoretisch wird argumentiert, dass moderne Demokratien aufgrund ihrer Größe und Komplexität zwangsläufig auf Repräsentationsmodelle angewiesen sind.
Wie wirkt sich Populismus auf das politische System aus?
Populismus wird als Reaktion auf die Repräsentationskrise und gleichzeitig als Gefahr für die Stabilität demokratischer Institutionen untersucht.
- Quote paper
- Benjamin Spörer (Author), 2010, Demokratie und Wandel. Ende der repräsentativen Demokratie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213015