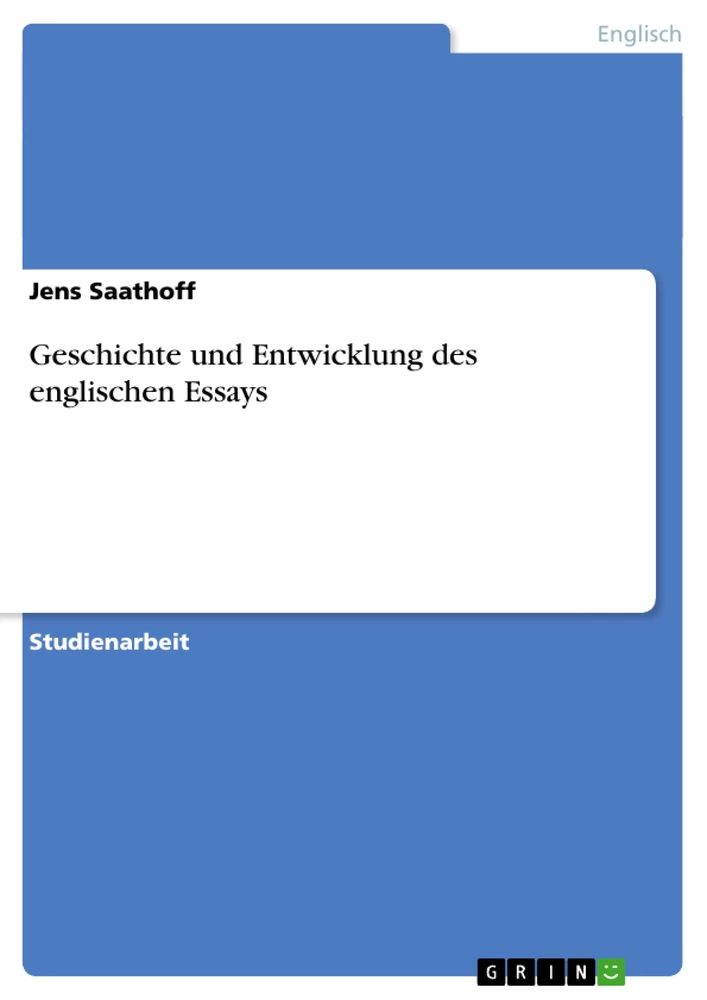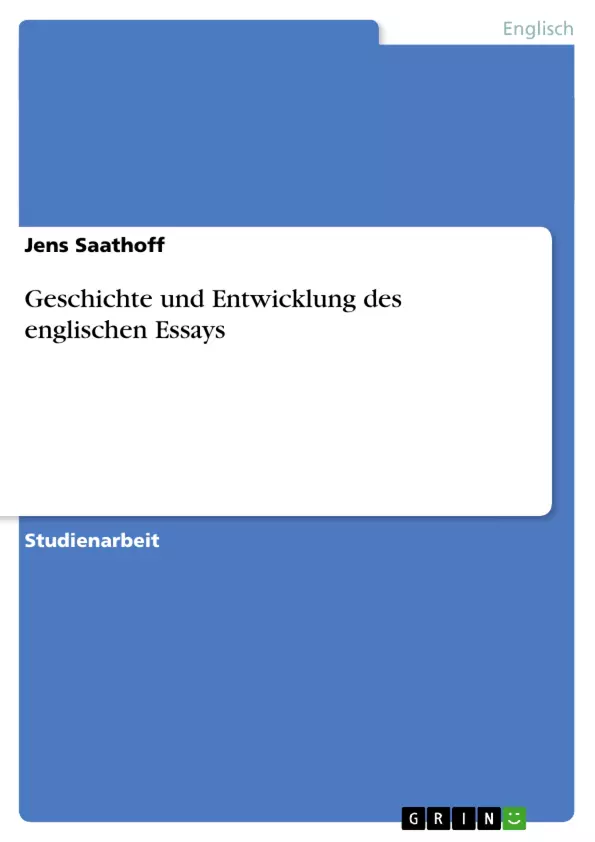Allgemein üblich wurde die Bezeichnung "Essay" für Prosaaufsätze in England erst im 18. Jahrhundert. Unterschiedliche literarische Traditionen und Zielrichtungen beeinflussten die Entwicklung dieser literarischen Gattung, die bis heute als typische Ausprägung des literarischen Diskurses in England gilt.
Inhalt
1. Zur Benennung des Essays
2. Die beiden Haupttraditionen des englischen Essays
3. Das Zitat
4. Verwandtschaften und Abgrenzungen zu anderen Textgattungen
1. Zur Benennung des Essays
Allgemein üblich wurde die Bezeichnung Essay für Prosaaufsätze in England erst im 18. Jahrhundert. Im 17. und 16. Jahrhundert wurden für Texte, die unter den heutigen Begriff von „Essay“ fallen, noch eine ganze Reihe von anderen Namen gewählt, da es an einem einheitlichen Oberbegriff fehlte.[1]
Zum Beispiel nannte Haly Heron die Einzeltexte seines Buches Discourse von 1579, das heute als erste englische Sammlung von Essays angesehen wird, „keys of counsel“. Andere Textsammlungen enthielten ganz unterschiedliche Bezeichnungen für ihre Aufsätze. So sind Texte des Marquis von Winchester unter anderem mit „sage sentences, sweet similitudes, morall examples“ oder „proper comparisons“ benannt.[2]
In Frankreich brachte Montaigne 1580 seine Essays heraus, mit denen er das Literaturgenre begründete.[3] Francis Bacon übernahm diesen Begriff und verfaßte drei Essayausgaben, von denen die erste 1597 veröffentlicht wurde. Wenn er auch nicht der erste in England war, der die Bezeichnung „Essay“ für seine Texte verwendete, so ging doch von ihm die entscheidende Wirkung für die Weiterentwicklung des englischen Essays aus. Bacon beschrieb seine Texte selbst auch als kurze Notizen, die er von regelrechten Abhandlungen hinsichtlich ihres geringeren Anspruchs auf absolute Gültigkeit der Aussagen unterschied. Zu bemerken ist, daß Bacon zwar eine für seine Zeit neue Bezeichnung wählte, aber sehr wohl der Auffassung war, daß schon Senecas Episteln antike Formen des Essays gewesen seien, der Ursprung also in der Antike läge.[4]
2. Die beiden Haupttraditionen des englischen Essays
Montaigne (1533-1592) und Bacon (1561-1626) stehen für die beiden Haupttraditionen. Bacons Ausrichtung des Essays wird von Weber als konstruktiv und Montaignes als assoziativ bezeichnet. Die Kennzeichnung assoziativ meint, daß der Essay dem Gedankenstrom folgt und nicht so sehr an einer folgerichtigen, logischen Strukturierung interessiert ist. Montaignes Tradition folgten mit Abraham Cowley und William Temple zwei bedeutende Essayisten des 17. Jahrhunderts.[5]
Bacons konstruktive Textkomposition weist dagegen eine viel stärker methodisch ausgerichtete Gedankenführung auf. Den Kompositionsprinzipien assoziativ und konstruktiv entsprechen die Stilhaltungen informal und formal, die mit Bezug auf die Einhaltung rhetorischer Regeln gewählt wurden. Der assoziative, informale Essay ist darauf ausgelegt, der Innerlichkeit des Sprechers, seiner Gedankenwelt, Ausdruck zu verleihen. Dagegen betont der konstruktive, formale Essay die Information des Lesers über ein Thema, die Mitteilung eines Sachverhalts.
Weber ordnet den beiden Stilhaltungen die Rollen des höfischen Edelmannes und des Schulmeisters zu. Demzufolge entspricht der formale Stil der Rolle des Schulmeisters, der nur auf die Einhaltung von Formen bedacht ist. Die andere Stilhaltung kommt der Rolle des höfischen Edelmannes entgegen, der ein freies Gespräch unter Gleichgestellten führt und bei der Formulierung seiner Gedanken von überflüssigen Konventionen absieht.[6]
Festzustellen ist, daß die von Montaigne und Bacon geprägten Essays sich deutlich unterscheiden von den Zeitschriftenessays, wie sie später Addison und Steele verfassen. Ein Unterschied besteht darin, daß die früheren Essays nicht als einzelne Texte, sondern im Rahmen eines Buches veröffentlicht wurden, so daß sie letztlich als Elemente eines größeren Systems gesehen werden können.[7] So betrachtete zum Beispiel Montaigne seine Essays insgesamt „als Versuch einer Selbstbeschreibung“[8]. Bacon verstand seine Schriften als „a serious treatise on man“ mit den Themenbereichen „civil and moral1“.[9] Zudem stellen Bacons Essays eine Ergänzung, vielleicht Abrundung, seiner Abhandlung „The Advancement of Learning“ dar, die auf Systematik basiert und empirisch angelegt ist. Mit dem Essay zog Bacon eine von der Abhandlung unterschiedliche Art der Themenerschließung heran.[10] Nicht der Anspruch auf völlige Wahrheit über eine geschlossene Argumentation war dabei entscheidend, sondern die Erkenntnis durch Intuition, womit die Einsicht in die „Unabgeschlossenheit allen Wissens“[11] verbunden ist. Bacons Essays haben seiner eigenen Ansicht nach die Funktion, die Einsichten wissenschaftlichen Intellekts durch eine ansprechende sprachliche Gestaltung verständlich zu machen und somit einem großen Publikum zu vermitteln. Sie dienen insofern der „populär science“, einer populären Gelehrsamkeit.[12]
[...]
[1] Horst Weber: „Einleitung“. In: Der englische Essay. Analysen. Hrsg. von Horst Weber. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1975 (= Ars Interpretandi; Bd. 6). S. 1.
[2] Ebd. S. 1, 2.
[3] Ebd. S. 3.
[4] Ebd. S. 2.
[5] Horst Weber: „Einleitung“. S. 6, 7.
[6] Ebd.
[7] Ebd. S. 3.
[8] Ebd.
[9] Ebd.
[10] Horst Weber: „Einleitung“. S. 3.
[11] Ebd. S. 3.
[12] Ebd. S. 3, 4.
Häufig gestellte Fragen
Wann etablierte sich die Bezeichnung „Essay“ in England?
Allgemein üblich wurde der Begriff für Prosaaufsätze erst im 18. Jahrhundert, obwohl Vorläufer bereits im 16. Jahrhundert existierten.
Wer waren die Begründer der Essay-Tradition?
Michel de Montaigne begründete das Genre in Frankreich (assoziativer Stil), und Francis Bacon adaptierte es in England (konstruktiver Stil).
Was unterscheidet den formalen vom informalen Essay?
Der formale (konstruktive) Essay zielt auf Information und Sachlichkeit ab, während der informale (assoziative) Essay dem persönlichen Gedankenstrom des Autors folgt.
Welche Funktion hatten Bacons Essays?
Sie dienten der „popular science“, um wissenschaftliche Einsichten durch ansprechende Gestaltung einem breiteren Publikum verständlich zu machen.
Wie grenzt sich der Essay von der Abhandlung ab?
Ein Essay hat einen geringeren Anspruch auf absolute Gültigkeit und betont eher die Intuition und die Unabgeschlossenheit des Wissens.
- Quote paper
- Dr. Jens Saathoff (Author), 1991, Geschichte und Entwicklung des englischen Essays, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213029