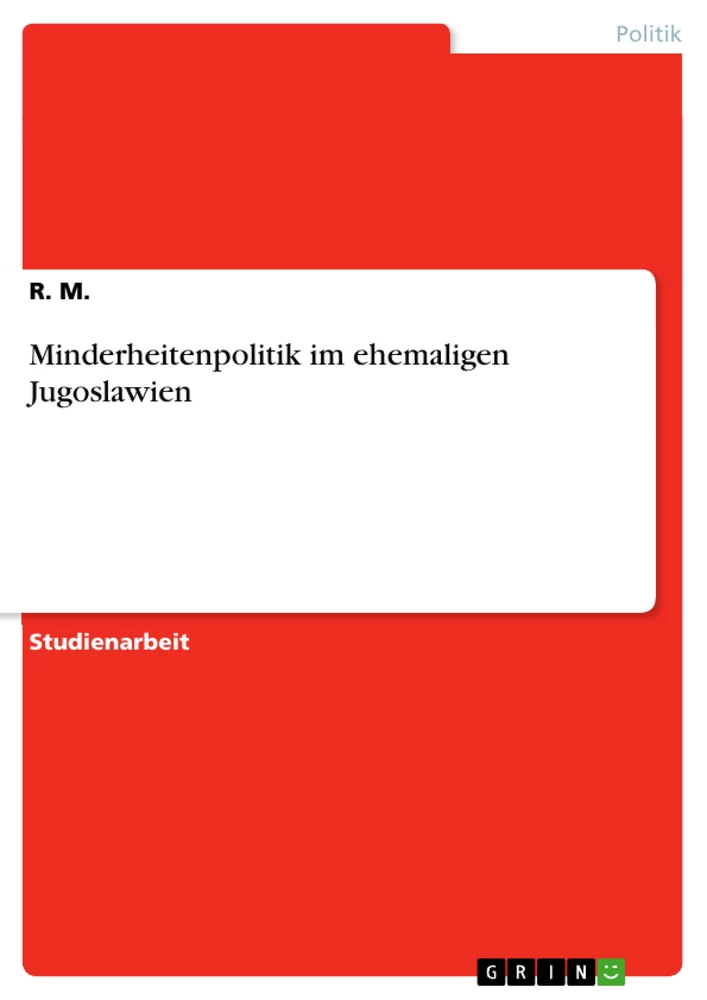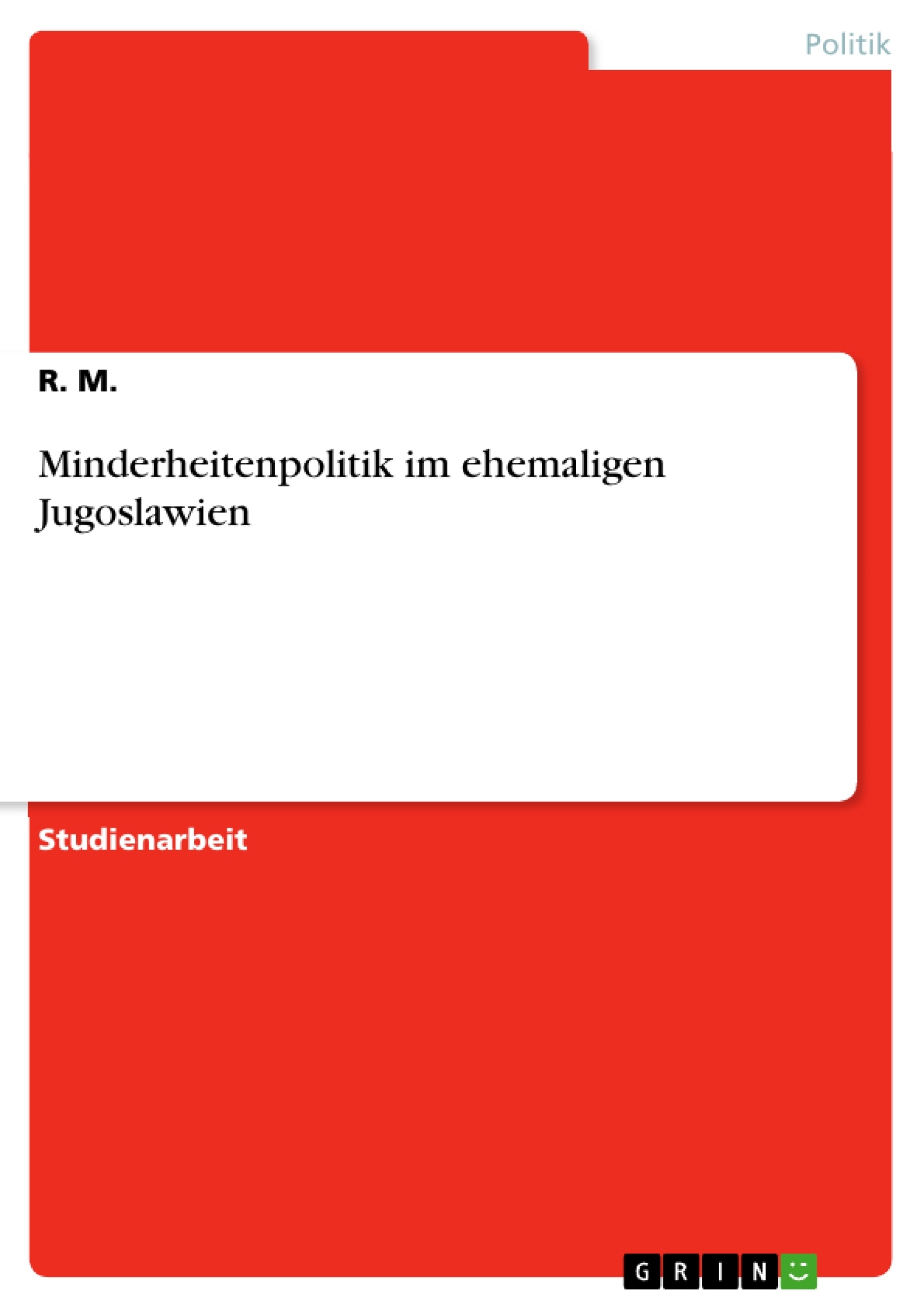Als Katharina Witt 1984 in Sarajevo ihre erste olympische Goldmedaille gewann, konnte sie nicht ahnen, genauso wenig wie alle anderen Teilnehmer und Besucher der Spiele, dass der Begriff ,,Fest der Völker" in Jugoslawien noch ins absolute Gegenteil umschlagen sollte. In weniger als zehn Jahren wandelte sich das Land von einem scheinbar friedlichen und fröhlichen Gastgeber in einen Ort des Grauens, dessen Bürgerkrieg die in Europa als längst überwunden geglaubten Schrecken des Zweiten Weltkrieges in neuer Form wieder aufleben ließ und dessen Folgen noch heute sichtbar sind und wohl auch in naher Zukunft noch nicht überwunden sein werden.Uns allen sind die Bilder von Sarajevo und Srebrenica noch vor Augen, die symbolisch herhalten müssen für den Krieg zwischen Serben, Kroaten, Bosniaken und Albanern, zwischen orthodoxen und katholischen Christen, zwischen ,,Gotteskriegern" und ,,Ungläubigen". Ein in vielen Bereichen unübersichtlich erscheinender Konflikt, dessen Tragweite sich die europäische und die Weltgemeinschaft lange nicht bewusst waren und auch nicht sein konnten oder wollten.Der Hass unter den verschiedenen Völkern ist tief in der Geschichte des Balkans verwurzelt, die zwar im europäischen Kontext betrachtet werden muss, aber dennoch immer ein wenig außer Acht gelassen wurde. Sie kann aber nicht der einzige Grund sein, für das Ausmaß an Gewalt und die scheinbar unlösbare Situation in der sich die Länder heute befinden.Im Zuge der europäischen Integration und des aktuellen Kriegsverbrecherprozesses gegen Radovan Karajic, ist eine Aufarbeitung der Geschichte und ein ernsthafter Versuch zur Zusammenführung aller ethnischen Gruppen unausweichlich. Warum dies allerdings so schwierig ist, welche Fortschritte erzielt wurden und welche Hürden es noch zu überwinden gilt, soll im Folgenden versucht werden zu erläutern. Im Mittelpunkt soll dabei die Frage stehen, ob die Problematik der Minderheiten, wenn sie in den einzelnen Ländern, z.B Bosnien-Herzegowina überhaupt als solche bezeichnen werden können, hinderlich ist für einen künftigen EU-Beitritt, oder ob nicht Europa selbst die Initiative ergreifen muss, indem sie noch mehr auf die Länder zu geht. Denn auch die Verantwortung Europas und der UNO muss hinterfragt werden, wenn es um die Entwicklung des westlichen Balkans geht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kurzer Überblick der Geschichte Jugoslawiens
- Geschichte bis 1945
- 1945 bis 1991
- 1991 bis heute
- Minderheitenpolitik und Probleme
- Kroatien
- Bosnien-Herzegowina
- politische und ethnische Trennungen
- Umsetzung und Probleme der Minderheitenpolitik
- Serbien und Kosovo
- radikale ethnische Trennungen und fehlender Minderheitenschutz
- Unabhängigkeit des Kosovo
- Umgang und Forderungen der Europäischen Union
- Kritik an EU und UN in der Lösung der Balkanfrage
- Minderheitenfrage als Schlüssel zum EU-Beitritt
- Fazit
- Literatur und Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Minderheitenfrage im ehemaligen Jugoslawien und untersucht deren Einfluss auf den möglichen EU-Beitritt der einzelnen Staaten. Dabei werden die historischen Wurzeln der Konflikte beleuchtet und die aktuelle Situation in den ehemaligen Teilrepubliken Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien sowie im Kosovo analysiert.
- Die historischen Wurzeln der Konflikte zwischen den verschiedenen Volksgruppen im ehemaligen Jugoslawien
- Die aktuelle Minderheitenpolitik in Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und im Kosovo
- Die Rolle der EU und der UN in der Lösung der Balkanfrage
- Die Bedeutung der Minderheitenfrage für den EU-Beitritt der ehemaligen jugoslawischen Republiken
- Die Herausforderungen und Chancen für eine friedliche Zukunft im westlichen Balkan
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort skizziert die Tragweite des Bürgerkriegs in Jugoslawien und stellt die zentrale Frage nach dem Einfluss der Minderheitenproblematik auf einen möglichen EU-Beitritt der ehemaligen Teilrepubliken. Kapitel 2 bietet einen historischen Überblick über Jugoslawien, beginnend mit der osmanischen Herrschaft bis hin zum Zerfall des Landes im Jahr 1991. Im Fokus stehen die Entstehung der verschiedenen Volksgruppen und die Entwicklung der ethnischen Konflikte.
Kapitel 3 analysiert die Minderheitenpolitik und die damit verbundenen Probleme in den drei größten ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken: Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die tatsächliche Umsetzung der Minderheitenrechte sowie die Herausforderungen der Integration und Versöhnung beleuchtet. Zusätzlich wird die Situation im Kosovo betrachtet, das im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit erklärt hat.
Kapitel 4 befasst sich mit der Rolle der Europäischen Union in der Lösung der Balkanfrage. Es wird sowohl Kritik an der bisherigen Politik der EU und der UN geübt als auch die Bedeutung der Minderheitenfrage für den EU-Beitritt der ehemaligen jugoslawischen Republiken hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Minderheitenfrage, den ehemaligen Jugoslawien, die ethnischen Konflikte, die EU-Beitrittskandidaten, die Minderheitenpolitik, die Integration, die Versöhnung, die Rolle der EU und der UN sowie die historische Entwicklung des Balkans. Der Text beleuchtet die aktuellen Herausforderungen und Chancen für eine friedliche Zukunft im westlichen Balkan.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Minderheitenpolitik im ehemaligen Jugoslawien so komplex?
Der tiefe Hass zwischen Volksgruppen (Serben, Kroaten, Bosniaken, Albaner) ist historisch verwurzelt und wurde durch den blutigen Bürgerkrieg der 90er Jahre massiv verstärkt.
Welche Rolle spielt die Minderheitenfrage für den EU-Beitritt?
Ein ernsthafter Minderheitenschutz und die Versöhnung der ethnischen Gruppen gelten als zentrale Voraussetzungen für einen künftigen EU-Beitritt der Nachfolgestaaten.
Wie ist die Situation im Kosovo?
Im Kosovo herrscht eine radikale ethnische Trennung. Die Unabhängigkeitserklärung von 2008 hat die Spannungen mit Serbien und die Probleme beim Minderheitenschutz weiter verschärft.
Was wird an der Rolle der EU und UN kritisiert?
Der Weltgemeinschaft wird vorgeworfen, die Tragweite des Konflikts lange unterschätzt zu haben. Die Arbeit hinterfragt die Effektivität ihrer Maßnahmen zur Stabilisierung des Balkans.
Was sind die Symbole für den Krieg in Jugoslawien?
Die Belagerung von Sarajevo und das Massaker von Srebrenica stehen symbolisch für das Grauen des Bürgerkriegs und die ethnischen Säuberungen in Europa.
- Quote paper
- R. M. (Author), 2010, Minderheitenpolitik im ehemaligen Jugoslawien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213046