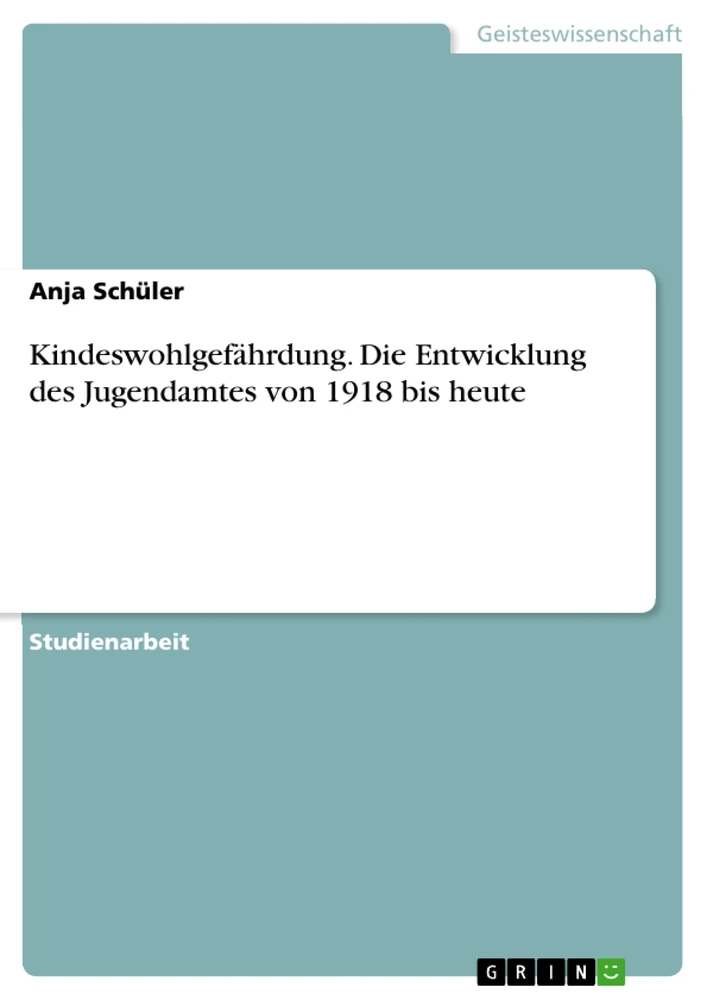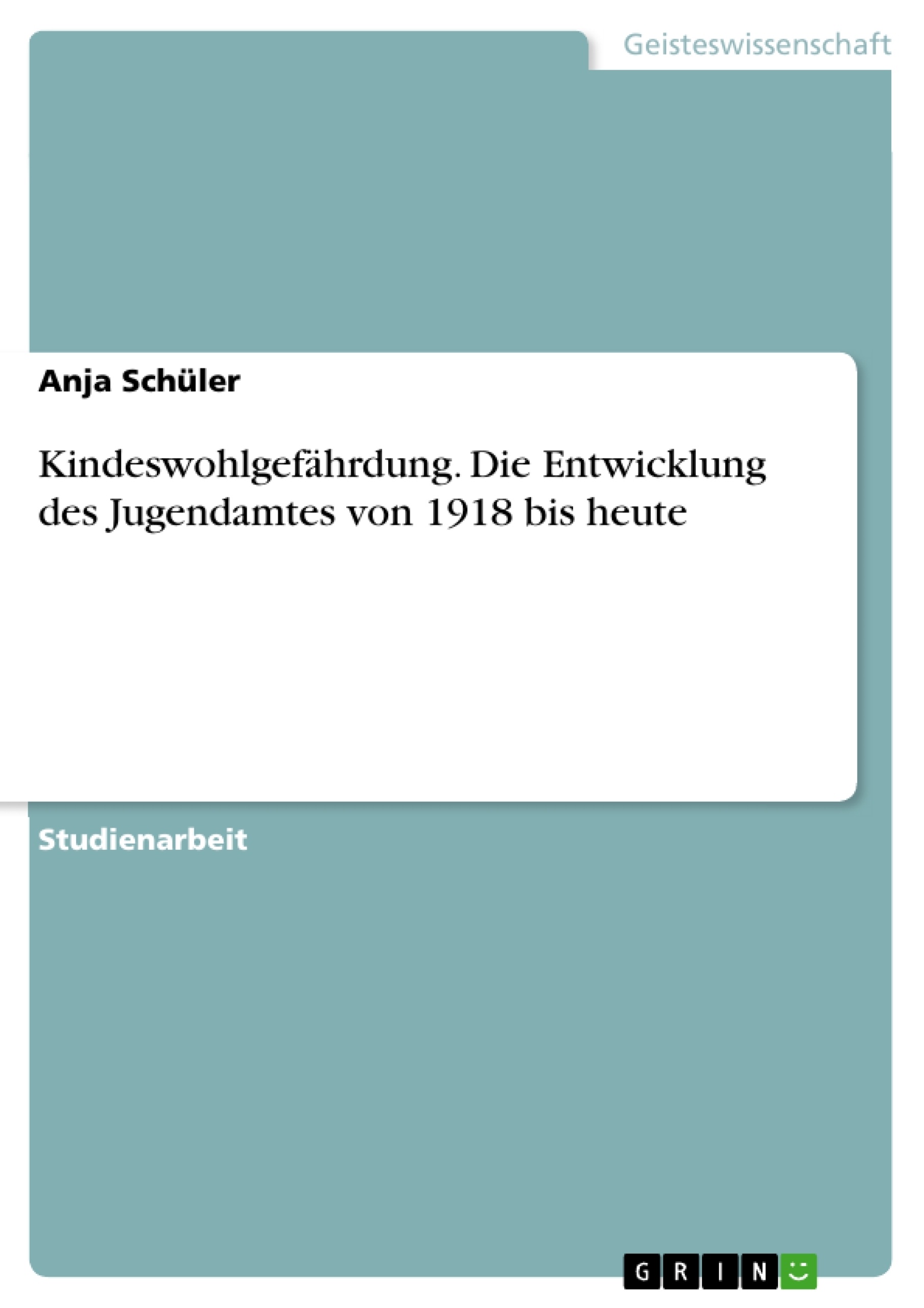Das Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland wurde am 23.05.1949 verkündet. In Artikel 6 des GG würde das Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung in Absatz 1 postuliert und in Absatz 2 wird so wohl der Schutz des Kindeswohl festgesetzt . Die Artikel 1 und 2 GG verpflichten den Staat die freie Entfaltung von jedem einzelnen Menschen zu gewährleisten. Dieses Recht gilt für alle Menschen in Deutschland, da alle Menschen mit der Beendigung der Geburt rechtsfähig sind .
Wie oben bereits benannt existieren diese Rechte in Deutschland erst seit 1949. Lange Zeit galten besonders für Kinder nicht dieselben Rechte wie für Erwachsene oder gar volljährige Männer.
Ein erster Einschnitt in diese aus heutiger rechtliche Schieflage stellt sicherlich das Ende der Feudalherrschaft im Jahr 1918 dar . Mit dem Ende der Feudalherrschaft, wurde auch die Weimarer Republik ausgerufen. Die Weimarer Verfassung garantiert den Menschen in Deutschland das erste Mal gleiche Rechte für Männer und Frauen. Dies hatte auch zur Folge, dass sich die Nationalversammlung 1921 nicht mehr gegen das Begehren der Frauen in der Nationalversammlung wehren konnten und so sich mit dem Entwurf für das erste Reichsjugendwohlfahrtsgesetzt auseinander setzen müsste.
Aufgrund der ideologischen Zielsetzung während der nationalsozialistischen Herrschaft zwischen 1933 und 1945 und der fehlenden reformorientierte Weiterentwicklung des Jugendamtes und der rechtlichen Rahmenbedingungen der Kindeswohlgefährdung werde ich diese Phase der Geschichte nicht genauer betrachten.
Zunächst werde ich anhand des Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922, am Jugendwohlfahrtsgesetz 1961 und an der Entwicklung des §8 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII die Entwicklung des Jugendamtes skizzieren, um im Anschluss die Entwicklung des Begriffs der Kindeswohlgefährdung erörtern zu können. Auf dem Kindeswohl bzw. der Kindeswohlgefährdung wird der Schwerpunkt der Betrachtung liegen, ich werde bei den Hilfen zur Erziehung bewusst nur § 42 SGB VIII, die Inobhutnahme, betrachte.
Daraus werde ich anschließend die Anforderungen an die Soziale Arbeit exzerpieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Jugendamt
- Nach dem ersten Weltkrieg
- Nach dem zweiten Weltkrieg
- Gegenwart
- Entwicklung des Kindeswohlgefährdungs-Begriffs
- Auswirkungen auf die Anforderungen an den Sozialarbeiter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet die Entwicklung des Jugendamtes und die Herausforderungen im Kontext der Kindeswohlgefährdung in Deutschland. Er verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung des Jugendamtes sowie die Veränderung des Begriffs der Kindeswohlgefährdung und deren Auswirkungen auf die Anforderungen an die Soziale Arbeit zu erörtern.
- Die historische Entwicklung des Jugendamtes
- Die Entwicklung des Kindeswohlgefährdungs-Begriffs
- Die Rolle des Jugendamtes im Kontext der Kindeswohlgefährdung
- Die Anforderungen an die Soziale Arbeit im Umgang mit Kindeswohlgefährdung
- Die Bedeutung des Kindeswohlschutzes für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über den rechtlichen Rahmen des Kindeswohlschutzes in Deutschland und die Notwendigkeit der Erörterung des Begriffs der Kindeswohlgefährdung. Das Kapitel "Das Jugendamt" befasst sich mit der historischen Entwicklung des Jugendamtes von der Weimarer Republik bis zur Gegenwart. Dabei werden wichtige Meilensteine und Herausforderungen beleuchtet, die die Aufgaben und Funktionen des Jugendamtes prägten.
Schlüsselwörter
Jugendamt, Kindeswohlgefährdung, Sozialarbeit, Entwicklung, Geschichte, Recht, Sozialgesetzbuch VIII, Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Anforderungen, Aufgaben, Kinderrechte, Jugendwohlfahrt, Weimarer Republik, Nachkriegszeit, Bundesrepublik Deutschland, Rechtliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde das erste Reichsjugendwohlfahrtsgesetz verabschiedet?
Das erste Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) wurde im Jahr 1922 während der Weimarer Republik verabschiedet.
Was versteht man unter Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII?
Die Inobhutnahme ist eine vorläufige Schutzmaßnahme des Jugendamtes, bei der ein Kind oder Jugendlicher in einer Notsituation aus der Familie genommen und sicher untergebracht wird.
Wie hat sich der Begriff der Kindeswohlgefährdung gewandelt?
Früher standen oft Disziplinierung und staatliche Ordnung im Vordergrund; heute liegt der Fokus auf den individuellen Rechten des Kindes und dem Schutz vor physischer, psychischer und sexueller Gewalt.
Welche Rolle spielt Artikel 6 des Grundgesetzes?
Artikel 6 GG postuliert das Recht der Eltern auf Erziehung, setzt aber gleichzeitig das staatliche Wächteramt fest, um das Kindeswohl zu schützen.
Welche Anforderungen stellt Kindeswohlgefährdung an Sozialarbeiter heute?
Sozialarbeiter müssen eine komplexe Risikoabwägung treffen, rechtliche Rahmenbedingungen kennen und zwischen dem Elternrecht und dem Schutzauftrag des Staates vermitteln.
- Arbeit zitieren
- Anja Schüler (Autor:in), 2013, Kindeswohlgefährdung. Die Entwicklung des Jugendamtes von 1918 bis heute, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213061