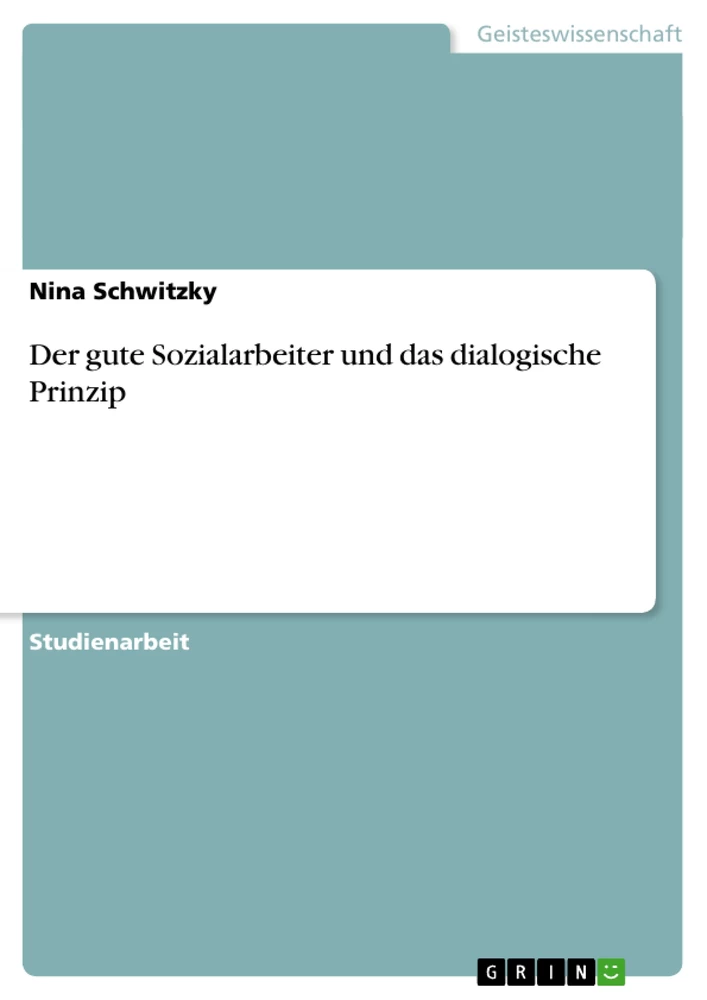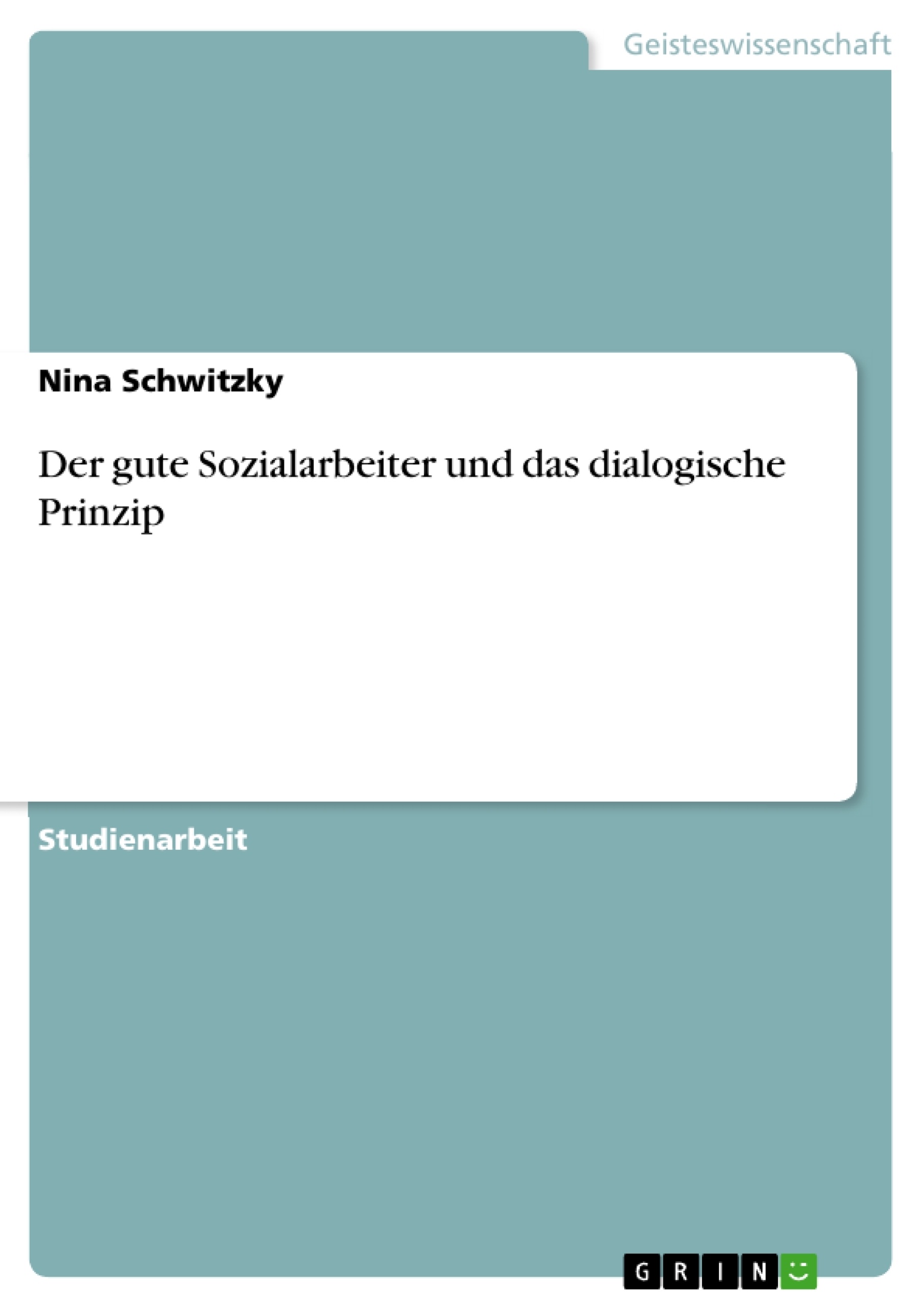Mit der Frage, was macht einen guten Sozialarbeiter/eine gute Sozialarbeiterin aus, sollten sich alle angehenden Sozialarbeiter beschäftigen. Wobei die Heran-gehensweise sehr unterschiedlich sein kann. So habe ich mich als gelernte Er-zieherin während meiner Ausbildung in den vergangenen Jahren schon damit auseinander gesetzt, was eine gute Erzieherin in der heutigen Zeit mitbringen sollte, um ihre Arbeit über einen langen Zeitraum, also bis zur Rente, immer in gleich bleibender Qualität und ohne Gefährdung der eigenen psychischen Ge-sundheit ausführen zu können. Dabei empfand ich es immer als besonders wichtig, trotz der Professionalisierung meiner Arbeit meine Persönlichkeit und meine eigenen Moralvorstellungen nicht aus den Augen zu verlieren.
An die Hausarbeit und die Frage nach einer guten Sozialarbeiterin gab es ver-schiedene Herangehensweisen. Ich entschied mich für eine sehr klassische, aus der Bibliothek der Ostfalia, Hochschule für angewandte Wissenschaft, der Fakul-tät Soziale Arbeit, holte ich einige Bücher zum Thema Ethik, Moral und Soziale Arbeit. In die Literatur las ich mich im weiteren Vorgehen ein und überlegte, wel-chen der Schwerpunkte ich für die Arbeit als Sozialarbeiterin für mich am wich-tigsten und bedeutsamsten empfand. Ich blieb bei Martin Buber und dem dialo-gischen Prinzip hängen, weil es für mich in der Sozialarbeit immer um den Dialog geht, egal ob mit professionsgleichen Kollegen, fachfremden Kollegen oder dem Klienten selbst. Ohne einen gemeinsamen Dialog könnte man nicht miteinander arbeiten, weil jeder Mensch in seiner Sozialisierung andere Werte und Moralvorstellungen erlernt hat. Zwar kann man davon ausgehen, dass allge-meingültige Werte in jeder Erziehung vorkommen, aber dennoch muss man sich, um miteinander arbeiten zu können auf eine gemeinsame Wertebasis einigen, dies geschieht zum Teil nonverbal oder verbal zum Beispiel durch die Ver-einbarung von einfach Regeln zusammen mit dem Klienten.
Nachdem der Schwerpunkt für diese Hausarbeit gefunden war, lasse ich mich noch intensiver in das dialogische Prinzip von Martin Buber ein, welches, obwohl nicht mehr ganz neu, auch heute noch sehr aussagekräftig für die Soziale Arbeit ist. Denn schon immer ging es in der Sozialen Arbeit darum, einen gemeinsamen Kontext zu finden und miteinander im Gespräch zu sein und auch zu bleiben. Darauf werde ich später noch näher eingehen, wenn ich ein Beispiel aus meiner eigenen erlebten Praxis in der Sozialen Arbeit vorstelle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wesensmerkmale Sozialer Arbeit
- Ethik und Moral in der Sozialen Arbeit
- Selbst erlebte Praxis Sozialer Arbeit
- Persönliche Stellungnahme
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Frage nach den Eigenschaften eines guten Sozialarbeiters zu beleuchten und die Bedeutung des dialogischen Prinzips nach Martin Buber in der Sozialen Arbeit zu untersuchen.
- Wesensmerkmale der Sozialen Arbeit
- Ethik und Moral in der Sozialen Arbeit
- Das dialogische Prinzip in der Praxis
- Die Bedeutung von Toleranz und Akzeptanz
- Die Rolle der eigenen Lebensgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Herangehensweise der Autorin an die Frage nach einem guten Sozialarbeiter. Sie betont die Wichtigkeit der eigenen Persönlichkeit und Moralvorstellungen in der professionellen Arbeit und die Bedeutung des Dialogs in der Sozialen Arbeit.
-
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Wesensmerkmalen der Sozialen Arbeit. Die Autorin bezieht sich auf die Definition der International Federation of Social Workers (IFSW) und analysiert deren Kernmerkmale, wie die Förderung des sozialen Wandels, die Befähigung von Menschen zu eigenen Entscheidungen und die Einhaltung von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Sie hinterfragt jedoch, ob diese Definition ausreichend ist und ob Soziale Arbeit nicht mehr sein sollte als eine berufliche Profession.
-
Im dritten Kapitel werden Ethik und Moral in der Sozialen Arbeit beleuchtet. Die Autorin definiert die Begriffe Ethik und Moral und stellt die Frage nach den moralischen und ethischen Grundlagen, die für einen Sozialarbeiter gelten sollten. Sie diskutiert die ethischen Pflichten eines Sozialarbeiters gegenüber sich selbst, dem Berufsstand, den Kollegen, den Institutionen, der Gesellschaft und dem Klienten und verdeutlicht die Komplexität des ethischen Handelns in der Sozialen Arbeit.
-
Das vierte Kapitel präsentiert einen selbst erlebten Fall aus der Praxis der Autorin als Erzieherin in einer multikulturellen Mädchenwohngruppe. Der Fall eines jungen Mädchens, das aufgrund von Zwangsverheiratung und Ehrenmord in der Wohngruppe Zuflucht sucht, verdeutlicht die Herausforderungen der Arbeit mit muslimischen Mädchen und die Konflikte, die sich zwischen den ethischen Pflichten eines Sozialarbeiters gegenüber der Gesellschaft, dem Klienten und sich selbst ergeben können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Grundhaltung in der Sozialen Arbeit, das dialogische Prinzip nach Martin Buber, Ethik und Moral in der Sozialen Arbeit, die Bedeutung von Toleranz und Akzeptanz, die Rolle der eigenen Lebensgeschichte und die Herausforderungen der Arbeit mit Klienten aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Milieus.
- Quote paper
- Nina Schwitzky (Author), 2011, Der gute Sozialarbeiter und das dialogische Prinzip, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213063