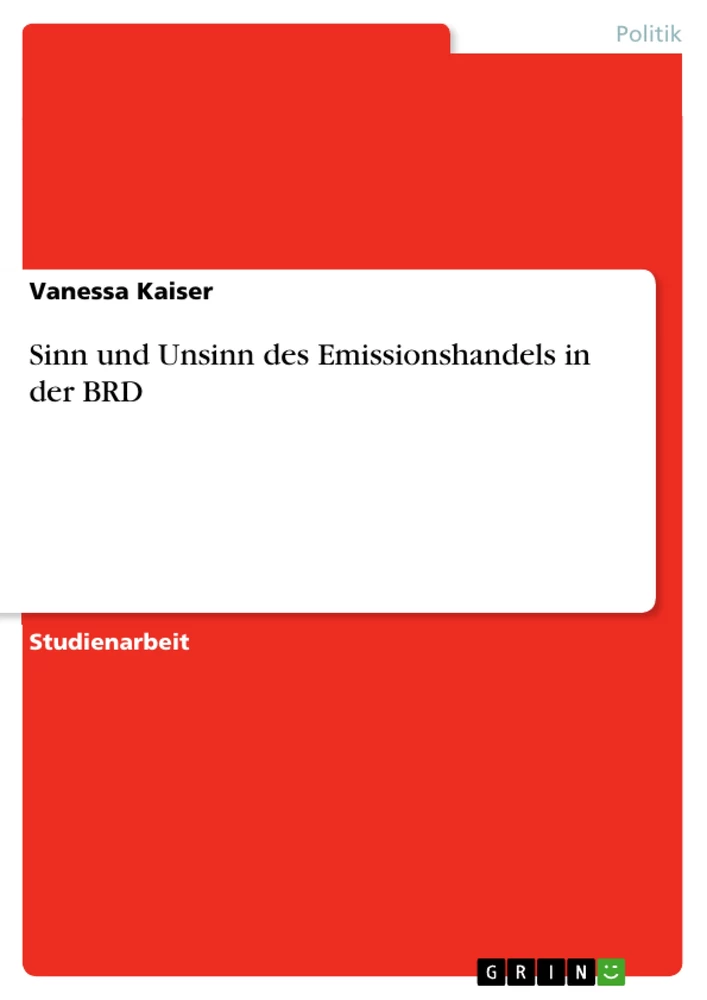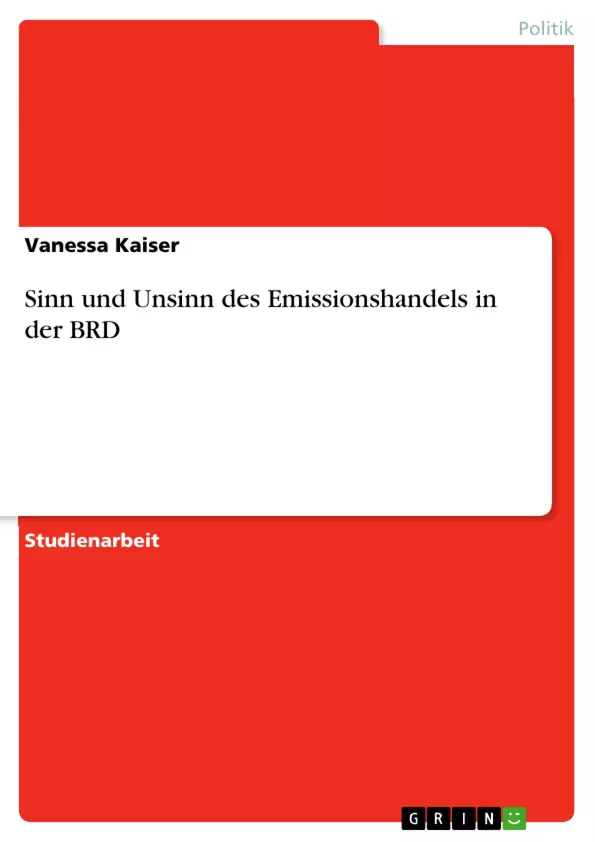Der Klimawandel und seine Folgen sind heutzutage für uns allgegenwärtig. Durch Filme wie „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore und David Guggenheim und durch die regelmäßig erscheinenden Berichte des IPCC, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, wurde die drohende Gefahr des Klimawandels auch der Bevölkerung verständlich gemacht. Die Wissenschaftler sind sich heute zum Großteil einig, dass es zwar einen natürlichen Treibhauseffekt gibt, der in immer wiederkehrenden Zyklen die Temperaturen auf der Erde verändert2, dass die Steigerung der Temperatur in den letzten Jahrzehnten jedoch vermutlich vom Menschen beschleunigt und verstärkt wird.
Durch die Abholzung der Wälder, durch Methoden der Landnutzung und vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, werden sogenannte Treibhausgase freigesetzt. Vordergründig können Gase wie Methan, Ozon, Lachgas, Fluorchlorkohlenwasserstoffe und Kohlendioxid den natürlichen Treibhauseffekt verstärken und zu einer Erwärmung der Atmosphäre und der Erdoberfläche führen.3
Mit fortschreitenden Erkenntnissen über die Auswirkungen des zunehmenden Klimawandels, nahmen auch die geplanten Maßnahmen zu Verhinderung dieser katastrophalen Aussichten zu.
[...]
1 Kerry, John: COP15 Climate Conference, Copenhagen, December 2009.
2 Abegg, Bruno: Klimaänderung und Tourismus, S.30.
3 Ebd., S.29.
Inhalt
1. EINLEITUNG
2. AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND
3. KYOTO- PROTOKOLL
3.1 INKRAFTTRETEN DES KYOTO- PROTOKOLLS
3.2 WESENTLICHE INHALTE UND ZIELE
3.3 VORREITER DEUTSCHLAND
4. EMISSIONSHANDEL IN DER EUROPÄISCHEN UNION
4.1 PRINZIP DES EMISSIONSHANDELS
4.1.1 FUNKTIONSWEISE DES EMISSIONSHANDELS
4.1.3 HANDELSABWICKLUNG
4.2 WEITERE MAßNAHMEN
4.2.1 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM)
4.2.2 JOINT IMPLEMENTATION (JI)
5. DER EMISSIONSHANDEL IN DER BRD
5.1 DER NATIONALE ALLOKATIONSPLAN
5.1.1 NAP1 IM KONFLIKT MIT WIRTSCHAFTLICHEN INTERESSEN
5.1.2 NAP2: AUS DEN FEHLERN GELERNT?
5.2 HANDEL IN DER PRAXIS
5.3 EMISSIONSHANDEL IN DER BRD: HEIßE LUFT?!
6. CHANCEN FÜR DIE ZUKUNFT
7. FAZIT
8. LITERATURVERZEICHNIS
9. ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert der Emissionshandel in der EU?
Unternehmen benötigen Zertifikate für ihren CO2-Ausstoß. Wer weniger emittiert, kann Zertifikate verkaufen; wer mehr ausstößt, muss sie zukaufen.
Was ist das Ziel des Kyoto-Protokolls?
Das Hauptziel ist die völkerrechtlich verbindliche Reduktion von Treibhausgasemissionen zur Bekämpfung des Klimawandels.
Welche Rolle spielt der Nationale Allokationsplan (NAP) in Deutschland?
Der NAP legt fest, wie viele Emissionsberechtigungen den einzelnen Anlagen in Deutschland für einen bestimmten Zeitraum zugeteilt werden.
Was sind CDM und Joint Implementation?
Dies sind projektbasierte Mechanismen des Kyoto-Protokolls, die es ermöglichen, Emissionsminderungen in anderen Ländern auf die eigene Bilanz anzurechnen.
Ist der Emissionshandel in der BRD effektiv?
Die Arbeit diskutiert, ob der Handel tatsächliche Einsparungen bewirkt oder durch Konflikte mit wirtschaftlichen Interessen zu "heißer Luft" führt.
- Quote paper
- Vanessa Kaiser (Author), 2013, Sinn und Unsinn des Emissionshandels in der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213068