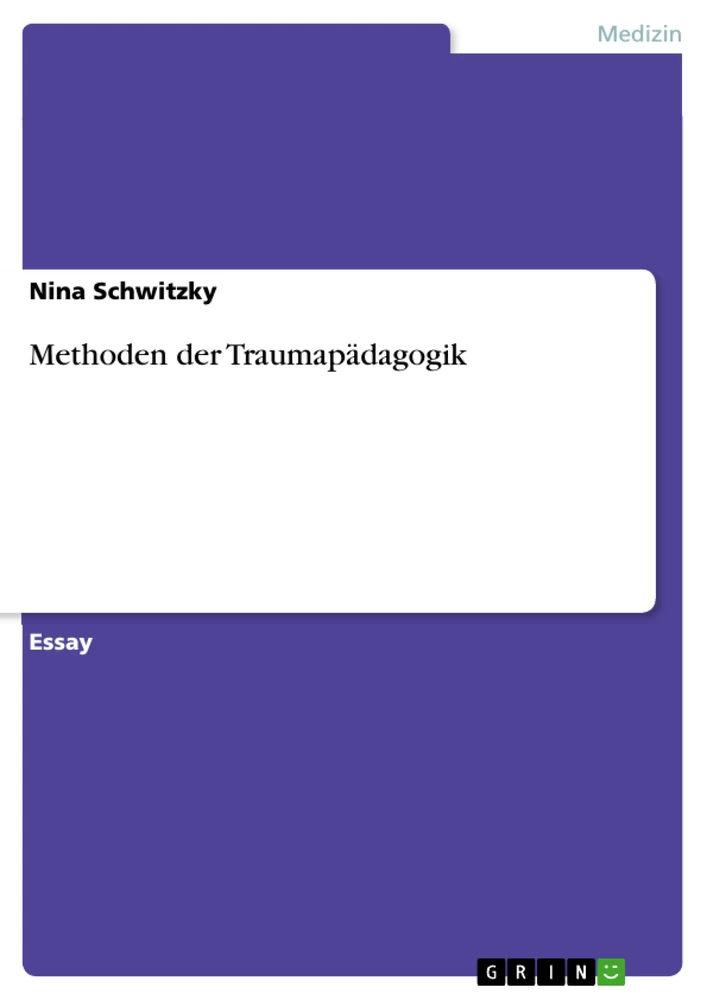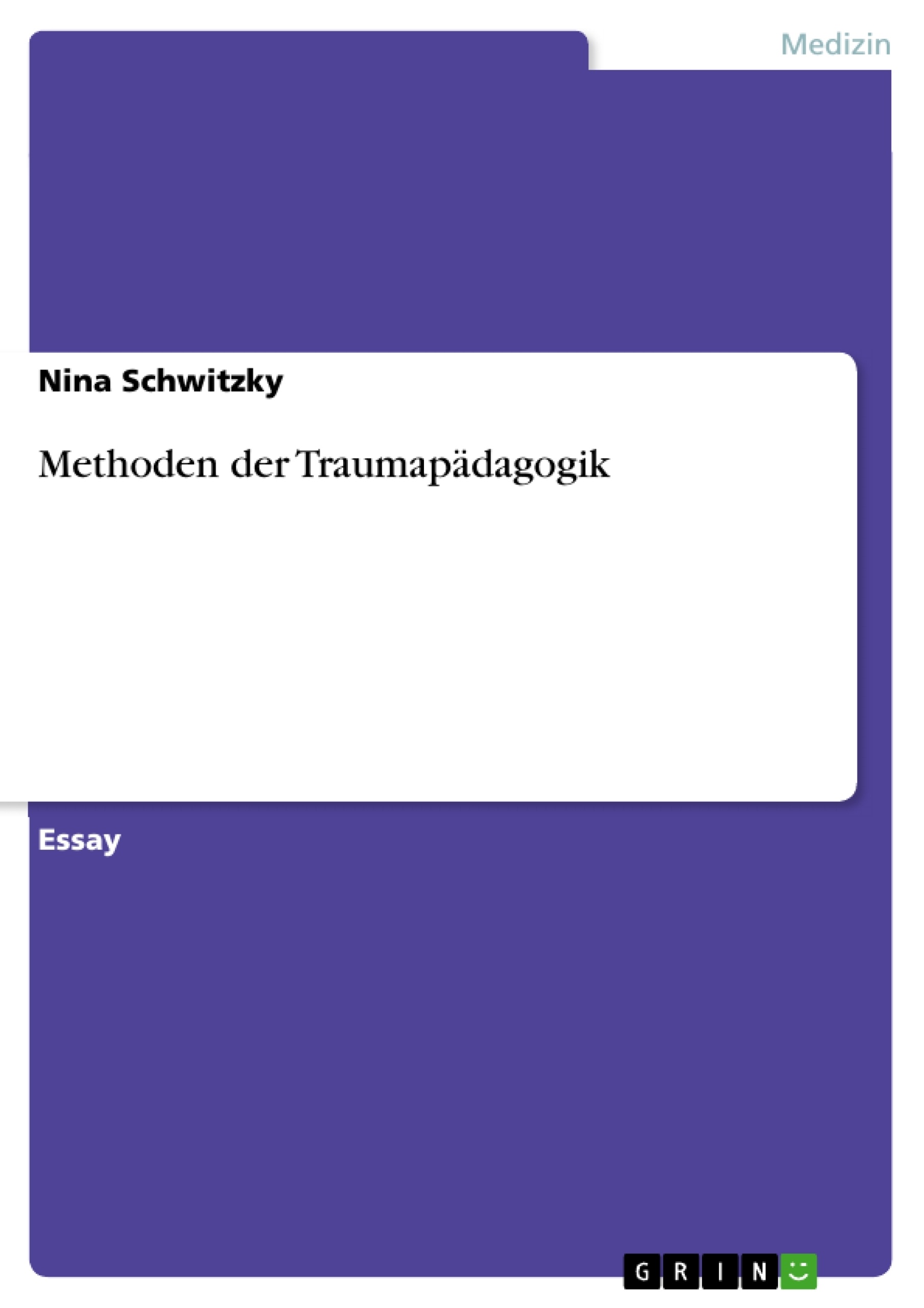Die Entscheidung sich für das Seminar zur Sozialen Arbeit mit traumatisierten Klienten anzumelden fiel mir sehr leicht, da ich in der Arbeit als Erzieherin in einer anonymen multikulturellen Mädchenwohngruppe in Nürnberg gearbeitet habe, in welcher wir hauptsächlich muslimische Mädchen und junge Frauen betreuten, welche von Zwangsheirat und/oder Ehrenmord betroffen oder bedroht waren. Die Mädchen die zu uns kamen, waren alle in irgendeinem Ausmaß traumatisiert, wobei es bei einem jungen Mädchen besonders gravierend war, sie zeigte viele Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung und wurde von unserer hausinternen Therapeutin zu einem Spezialisten für Traumatherapie weiter vermittelt. Wir als pädagogisches Team haben uns darüber ausgetauscht, ob es für uns möglich wäre, sich dem Problem mit Methoden aus der Traumapädagogik anzunähern. Leider verlief diese Idee im Sande, da die Wohngruppe einige Wochen später aus finanziellen Gründen mit einer anderen Wohngruppe zusammengelegt wurde und die meisten Mitarbeiter wechselten oder aufhörten. So verließ auch ich zu dieser Zeit die Wohngruppe um in Wolfenbüttel zu studieren, das Thema und unsere Handlungsunfähigkeit bei einigen von ihr gezeigten Symptomen blieben mir dennoch im Hinterkopf, so dass ich die Gelegenheit nutzen möchte, mich mit den Inhalten und Methoden der Traumapädagogik im Rahmen der mündlichen Prüfung auseinanderzusetzen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Traumapädagogik
2.1 Aufgaben von Betreuungspersonen (Pädagogen) in der Fremdunterbringung
2.2 Selbstbemächtigung und Partizipation
2.3 Aus der Praxis: Beispiel Ubuntu und ReehiRa
2.4 Unterstützung von Eltern mit traumatisierten Kindern Ein Ausflug in die systemischen Lösungswege
3. Schlussfolgerungen und Fazit
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Entscheidung sich für das Seminar zur Sozialen Arbeit mit traumatisierten Klienten anzumelden fiel mir sehr leicht, da ich in der Arbeit als Erzieherin in einer anonymen multikulturellen Mädchenwohngruppe in Nürnberg gearbeitet habe, in welcher wir hauptsächlich muslimische Mädchen und junge Frauen betreuten, welche von Zwangsheirat und/oder Ehrenmord betroffen oder bedroht waren. Die Mädchen die zu uns kamen, waren alle in irgendeinem Ausmaß traumatisiert, wobei es bei einem jungen Mädchen besonders gravierend war, sie zeigte viele Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung und wurde von unserer hausinternen Therapeutin zu einem Spezialisten für Traumatherapie weiter vermittelt. Wir als pädagogisches Team haben uns darüber ausgetauscht, ob es für uns möglich wäre, sich dem Problem mit Methoden aus der Traumapädagogik anzunähern. Leider verlief diese Idee im Sande, da die Wohngruppe einige Wochen später aus finanziellen Gründen mit einer anderen Wohngruppe zusammengelegt wurde und die meisten Mitarbeiter wechselten oder aufhörten. So verließ auch ich zu dieser Zeit die Wohngruppe um in Wolfenbüttel zu studieren, das Thema und unsere Handlungsunfähigkeit bei einigen von ihr gezeigten Symptomen blieben mir dennoch im Hinterkopf, so dass ich die Gelegenheit nutzen möchte, mich mit den Inhalten und Methoden der Traumapädagogik im Rahmen der mündlichen Prüfung auseinanderzusetzen.
2. Traumapädagogik
Das Wort Trauma kommt aus dem griechischen und bedeutet übersetzt so viel wie Wunde/Verletzung. Von daher gibt es vielfältige Arten von Traumata, zum Beispiel körperliche (Bsp. Schädel-Hirn-Trauma) und seelische/psychische Traumen, die sich in unterschiedlicher Intensität zeigen können und je nach der vergangenen Zeit seit dem Auslöser, welches zum Trauma führt und der Art, in welcher das Trauma erlebt wurde unterschiedliche Bezeichnungen haben. Am bekanntesten ist wahrsÖüächeinlich die Posttraumatische Belastungsstörung, wobei Pädagogen häufig auch in Kontakt mit akuten Belastungsstörungen kommen.[1]
Besonders betroffen von Traumatisierung sind häufig Kinder und Jugendliche, diein Einrichtungen zur Erziehungshilfe sind. Ursachen bzw. Risikofaktoren für eine Traumatisierung bei Kindern können emotionale, körperliche und sexuelle Misshandlung, sowie körperliche und emotionale Vernachlässigung, elterlicher Alkohol- und Drogenmissbrauch, ärmliche Verhältnisse, Trennung/Scheidung, Psychische und/oder körperliche Erkrankungen der Eltern, chronische familiäre Disharmonie, elterlicher Verlust der Arbeit, Umzüge, Schulwechsel, Wiederverheiratung eines Elternteils, ernste Erkrankungen in der Kindheit, väterliche Abwesenheit, mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr, Kriminalität und Dissozialität eines Elternteils, schwere Körperliche Erkrankung eines Elternteils, körperliche Gewalt in der Familie, anhaltende Abweisung, ungebührliche elterliche Machtausübung (Bsp. Münchhausen by Proxy), Unfälle, Krankenhausaufenthalte, (gewaltsamer) Tod eines Familienangehörigen, Obdachlosigkeit, Flucht, Krieg, Naturkatastrophen, geistige und körperliche Behinderung sein.[2]
All diese Gründe, sind nicht nur Risikofaktoren für eine Traumatisierung von Kindern, sondern können zum Teil auch die Gründe und Ursachen für eine Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen sein, so dass hier schon die Erklärung dafür liegt, warum Pädagogen immer wieder mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten, auch ohne, dass diese eine Diagnose für eine Posttraumatische oder akute Belastungsstörungen haben.
Traumapädagogik soll als Bindeglied zwischen Alltagsarbeit der Betreuer in den Einrichtungen und dem Therapeuten verstanden werden. Es geht darum die Kommunikation zu verbessern und es soll den Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden eine stabile Beziehung aufzubauen, in der sie sich sicher sind, dass sie so wie sie sind ausgehalten und angenommen werden.
2.1. Aufgaben von Betreuungspersonen (Pädagogen) in der Fremdunterbringung
Da Traumapädagogik grundlegend erstmals eine Orientierung geben soll, vor allem für professionelles Helfen, gibt es nicht den einen Weg oder die eine Methode, sondern es geht um die Haltung den Kindern gegenüber und wie man sich ihrem Problem näher.
Es geht darum sich intensiv und bewusst auf eine Beziehung zu einem Kind einzulassen und die Beziehung nicht bei jeder kleinen Krise abzubrechen und das Kind abzuschieben. Dem Kindern soll vermittelt werden, dass man obwohl das Verhalten vielleicht nicht angebracht war, versteht warum es dieses getan hat. Vielleicht war dieses Verhalten früher nötig um sich selbst und die Geschwister zu schützen oder das Überleben zu sichern. Es geht also darum die Kinder zu halten, sie mit all ihren Problemen und schwierigen Verhaltensmustern auszuhalten und mit ihnen gemeinsam einen anderen „neuen“ Weg zu gehen. Den Kindern und Jugendlichen soll ein sicherer Ort geboten werden, sowohl in der realen Welt sowie in ihrer inneren Welt, dazu gehören einige Übungen, wie zum Beispiel die Übung „innerer Tresor“, welche wir im Seminar auch kennengelernt haben.
So sollen den Kindern in der Einrichtung neue Wurzeln gegeben werden, aber auch die alten Wurzeln wieder gestärkt und wieder entdeckt werden. Dies kann zum Beispiel mit sogenannten „Lebensbüchern“ geschehen, in diesen werden gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen Episoden aus ihrem Leben festgehalten, dazu gehört die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die Kinder und Jugendlichen stehen zwischen ihrer Herkunftsfamilie und z.B. ihrer Pflegestelle, sie müssen auch in der Schule häufig erklären, warum sie fremduntergebracht sind. Bei der Bewältigung dieser beiden Situationen können Lebensbücher helfen. Gemeinsam mit dem Betreuer kann zum Beispiel durch Gespräche mit der Herkunftsfamilie oder durch Erzählungen von Dritten, den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit gegeben werden, sich gemeinsam mit dem Betreuer eine „angemessene“ Begründung für ihre Fremdunterbringung zu finden. Häufig haben die Kinder das Gefühl, schuld daran zu sein, dass sie nicht bei ihrer Familie leben können, besonders wenn eventuelle Geschwister in der Herkunftsfamilie verblieben sind oder die vorherige familiäre Situation von den Kindern idealisiert und verherrlicht wird.[3]
Des Weiteren wird in einer Einrichtung mit traumapädagogischen Ansatz auch dem Aufnahmeverfahren und der Wahl des Bezugsbetreuers eine wichtige Position bei- gemessen. Wenn möglich sollten, die Kinder und Jugendlichen den neuen Betreuer zu Hause oder zumindest in einer für sie sicheren Umgebung kennen lernen. Erst im nächsten Schritt sollten sie die neue Einrichtung kennen lernen und nach Möglichkeit sollten sie „Probewohnen“ können und sich erst danach entscheiden müssen, ob diese Einrichtung und dieser Bezugsbetreuer für sie zu einem sicheren Ort bzw. ob sie sich auf diesen Menschen als Bezugsperson einlassen können. Häufig haben Kinder aus schwierigen Familiensystemen Probleme stabile Beziehungen aufzubauen und zu halten, da ihre Bezugsperson während der ersten Lebenswochen/-monaten nicht immer konstant verfügbar waren oder nicht adäquat auf die Bedürfnisse des Säuglings eingegangen sind. Deswegen ist es nötig, dass sie lernen, wie wichtig es ist in Beziehungen zu investieren und dass Bezugspersonen immer einfühlend und mit ausreichend Zeit für sie da sind. Nur so können diese Kinder später erfühlende Beziehungen zu gleichaltrigen eingehen ohne in dieselben Beziehungsmuster wie ihre Eltern zu geraten, denn genau da liegt die Gefahr, wenn sie keine sicheren Bindungsmuster kennen lernen.[4]
[...]
[1] Thematische in der Vorlesung behandelt
[2] Vgl. Weiß (2011) Seite 27f
[3] Vgl. Bausum (2011): Seite 121 ff
[4] Vgl. Bausum (2011): Seite 145 ff
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Traumapädagogik?
Traumapädagogik dient als Bindeglied zwischen Alltagsarbeit und Therapie. Sie soll Kindern helfen, stabile Beziehungen aufzubauen und sich an einem „sicheren Ort“ angenommen zu fühlen.
Welche Ursachen führen bei Kindern häufig zu Traumatisierungen?
Häufige Ursachen sind emotionale, körperliche oder sexuelle Misshandlung, Vernachlässigung, Fluchterfahrungen, Krieg sowie elterlicher Drogen- oder Alkoholmissbrauch.
Was ist ein „Lebensbuch“ in der pädagogischen Arbeit?
Ein Lebensbuch dokumentiert gemeinsam mit dem Kind Episoden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, um die eigene Identität zu stärken und Gründe für die Fremdunterbringung zu verarbeiten.
Was versteht man unter der Übung „innerer Tresor“?
Es ist eine Imaginationsübung, bei der traumatisierte Kinder lernen, belastende Bilder oder Gefühle geistig an einem sicheren Ort (dem Tresor) zu verwahren, um im Alltag handlungsfähig zu bleiben.
Wie wichtig ist die Beziehungsstabilität in der Traumapädagogik?
Essentiell. Pädagogen müssen schwieriges Verhalten „aushalten“ und dem Kind vermitteln, dass die Beziehung auch in Krisen nicht abgebrochen wird, um neue, sichere Bindungsmuster zu ermöglichen.
Was ist der Unterschied zwischen akuter Belastungsstörung und PTBS?
Eine akute Belastungsstörung tritt unmittelbar nach einem Trauma auf, während eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) eine längerfristige psychische Erkrankung infolge eines traumatischen Erlebnisses ist.
- Quote paper
- Nina Schwitzky (Author), 2012, Methoden der Traumapädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213074