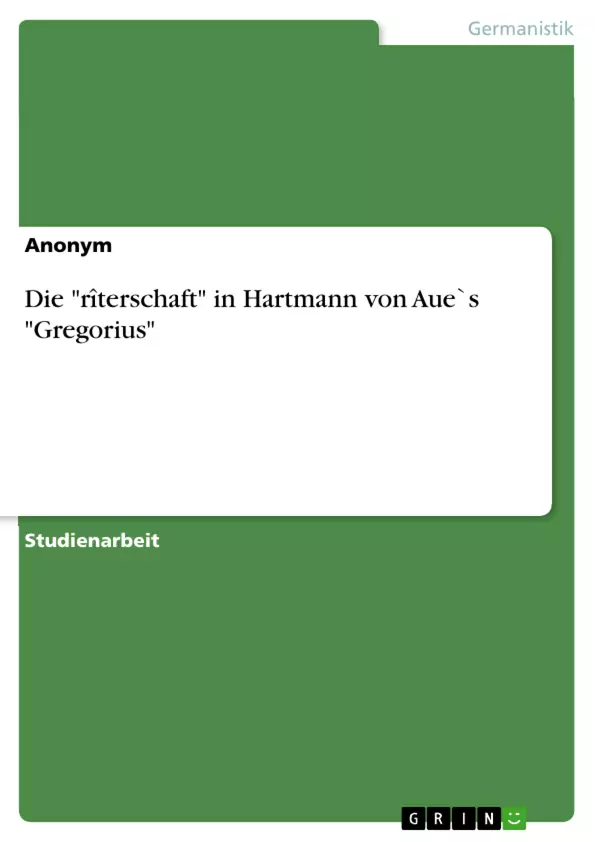Zu Beginn dieser Arbeit soll der Tugendenkatalog des Großvaters des Protagonisten der Untersuchungsgegenstand sein, da sich hier der adelige Sohn am Sterbebett des Landesherrn verpflichtet, die höfischen Verhaltensweisen einzuhalten weil dies der Sicherung der Herrschaft dient. Da die demonstrative Darstellung einer Machtposition eng verbunden ist mit dem Ritterdasein, scheint es lohnenswert zu sein, auch das höfische Leben zu beleuchten. Im zweiten Teil meiner Untersuchungen soll das Gespräch zwischen clericus und miles analysiert werden, um die Argumentation sowohl des Abtes als auch insbesondere von Gregorius anzuführen und ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. In diesem Dialog wird als Ergebnis zwar keine eindeutige Stellungnahme des Erzählers deutlich, jedoch kann Gregorius Vorstellung der ritterlichen Lebensform erkannt werden. Im nächsten Verlauf der Untersuchungen, werden die höfischen Merkmale vertiefter betrachtet, mit den Unterkategorien „schônheit“, „Die Ausbildung zum rîter“ und „rîterschaft“. Da die schônheit des Protagonisten häufiger genannt wird, scheint sie von Bedeutung zu sein und weist auch explizit auf seine edle Abstammung hin, die ihm zudem selbst im Kindesalter auf der Klosterinsel einen Sonderstatus einbringt. Kern und Ziel der wissenschaftlichen Arbeit soll sein, die Ritterschaft im Gregorius intensiv zu beleuchten, sodass nach einigen hinführenden Aspekten, mit den beiden vorletzten Gliederungspunkten der Höhepunkt der Untersuchung thematisiert werden soll. Dies ist insofern außergewöhnlich anders, da keine klassische Ausbildung in dem Sinne stattfindet, sondern diese viel mehr gedanklich seiner Phantasie entspringt. Eigenverantwortlich möchte er sein bequemes Leben im Kloster aufgeben, es gegen ein mühevolles und auf die Probe gestelltes Ritterdasein tauschen, um so die Sünde seiner Eltern und dadurch die seinige zu bereinigen und sich selbst zu finden. Mein Fazit wird zusammenfassend reflektieren, ob es Gregorius gelungen ist in der rîterschaft sein Glück zu finden und hier zu berücksichtigen, wie im Vergleich zum ihm, der Ritter realhistorisch tatsächlich ausgebildet wurde bzw. die Wirklichkeit mit der Darstellung der Ritterschaft hier in der mittelalterlichen Literatur in Ansätzen zu vergleichen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Tugendenkatalog des Vaters
3. Die Analyse des textimmanenten Streitgesprächs zwischen clericus und miles
4. Höfische Elemente
4.1. Schônheit
4.2 Die Ausbildung zum rîter
4.3 rîterschaft
5. Fazit
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Die "rîterschaft" in Hartmann von Aue`s "Gregorius", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213096