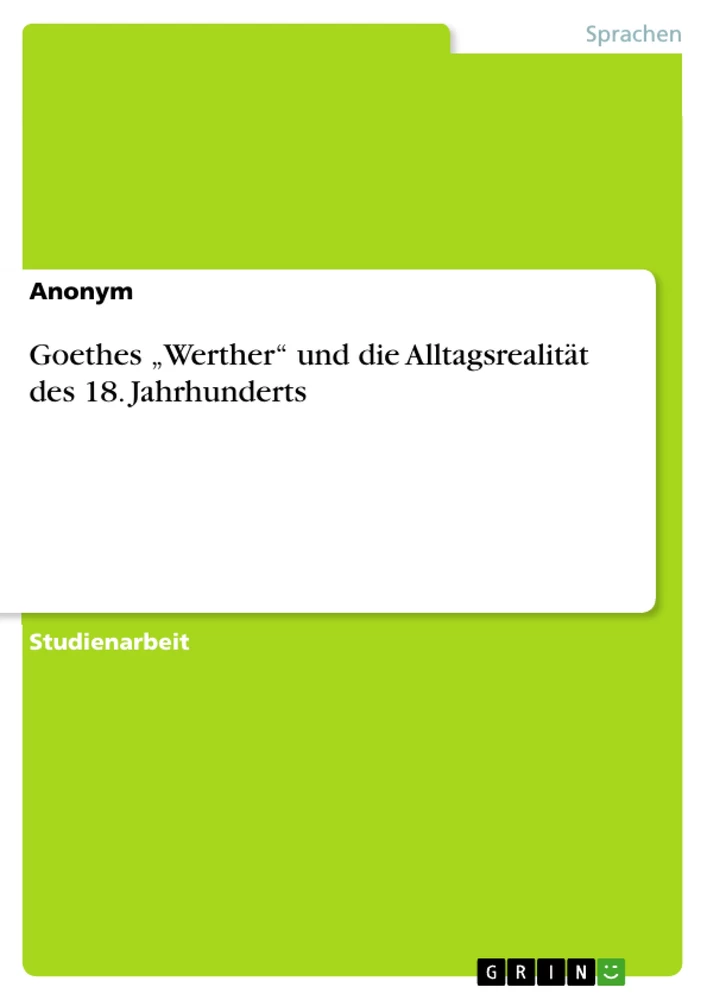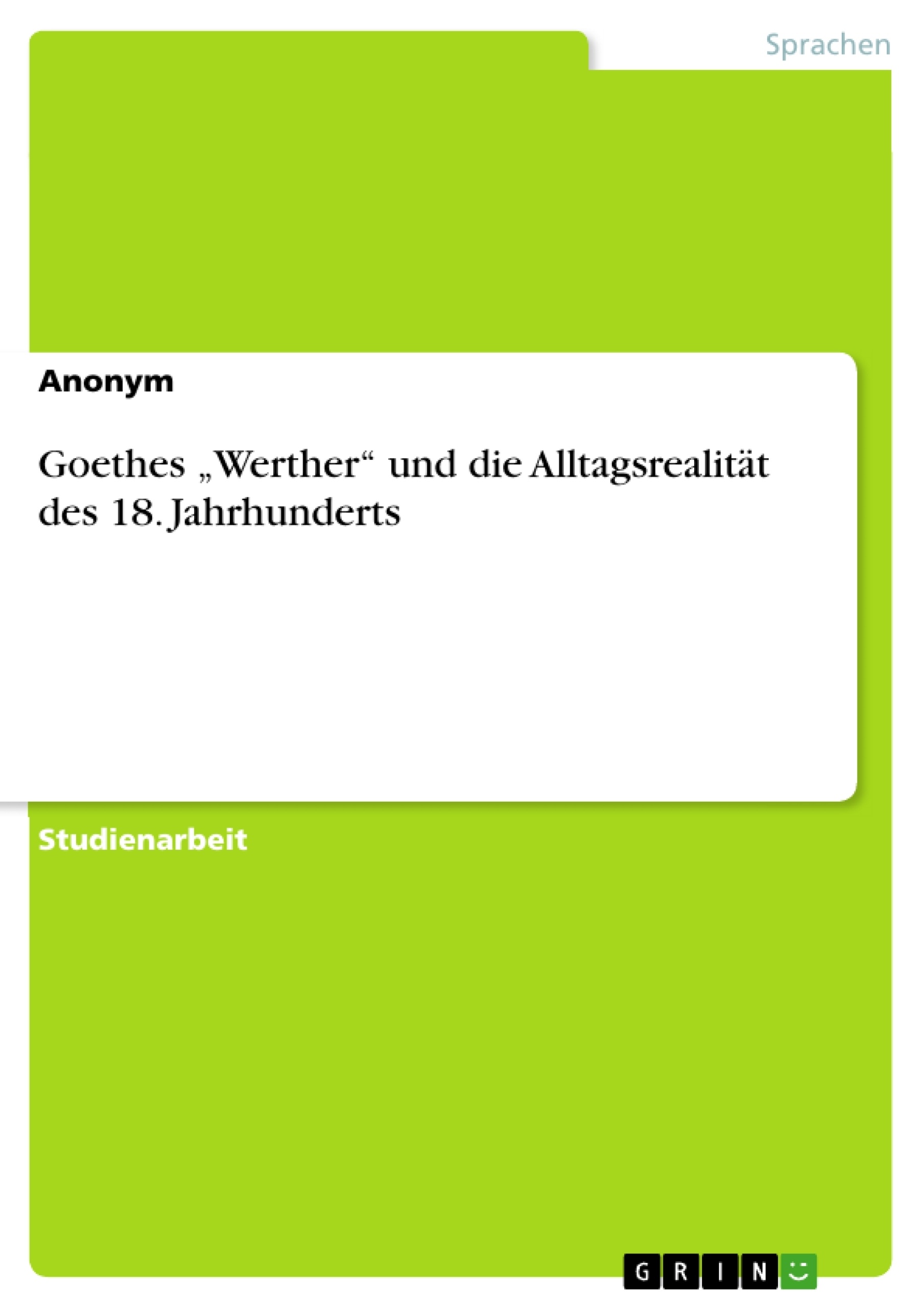n Johann Wolfgang Goethes 1774 veröffentlichtem Werk „Die Leiden des jungen Werther“1, kann man die Thematik des Versinkens in sich Selbst und den dadurch resultierenden Verlust der Realitätswahrnehmung wiederfinden. Der Titelheld schreibt immer wieder Briefe an seinen Freund Wilhelm, welche diesen Verlust im fortlaufenden Briefroman, immer stärker offenbaren. Diese Möglichkeit der Deutungsperspektive unterstützt auch Ernst Feise, welcher sich mit der psychoanalytischen Untersuchung Werthers beschäftigte2. Der Blickwinkel ist etwas ungewöhnlicher, da sich die meisten Überlegungen beispielsweise nur auf den Selbstmord, die Zusammenhänge zwischen Autor und Erzähler, der Gesellschaftskritik oder auf die vermeintliche Liebesbeziehung konzentrieren, jedoch scheint mir mein Ansatz beziehungsweise der von Feise, für mich und mein persönliches Weiterkommen, interessanter zu sein. Dies kann und soll keine psychologische Untersuchung werden, allerdings ist es faszinierend zu sehen, wie in der fiktionalen Literatur, speziell in diesem Werk, die subjektive Wahrnehmung der handelnden Personen dargestellt wird. Nach einer ersten Lektüre kann unter anderem festgestellt werden, dass sich der Zustand des Erzählers ohne echten objektivierenden Kommunikationsaustausch immer weiter verschlechtert und ihn letzten Endes bis in den Tod treibt. Daher soll konkret in meiner Arbeit der Fragestellung nach der Darstellung dieser psychischen Entwicklung im Text, den möglichen Entstehungsaspekten seiner Krankheit und dessen Folgen nachgegangen werden. Dies meint, dass ich im ersten Untersuchungsschritt zwei Punkte beleuchten möchte: Zum einen, wie der Text in seiner Erzählform, als umstrittener Briefroman, präsentiert wird und zum anderen wie sich an Hand dessen erkennen lässt, in welcher Art und Weise der Protagonist sein subjektives Empfinden ausdrückt. Dies führt zu einer tiefergehenden Frage, nämlich die nach den Ursachen. Des Realitätsverlustes. Warum verliert er den Bezug zur Realität?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textpräsentation
- Ein Beispiel für den Briefroman?
- Subjektives Erleben des Protagonisten
- Die Kindheit des Erzählers
- Die Abkehr von der Menschenwelt
- Mögliche Konsequenzen seines Rückzugs
- Fehlinterpretation der Natur
- Fehlinterpretation von Lottes Verhalten
- Seelisches Leiden und darauffolgender Freitod
- Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ unter dem Aspekt des Verlusts der Realitätswahrnehmung des Protagonisten. Ziel ist es, die Darstellung dieser psychischen Entwicklung im Text zu analysieren, mögliche Entstehungsaspekte seiner Krankheit zu beleuchten und die daraus resultierenden Konsequenzen zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Erzählform als Briefroman und der subjektiven Wahrnehmung des Protagonisten.
- Die Darstellung des Realitätsverlustes bei Werther
- Die Analyse der Erzählform als (umstrittener) Briefroman
- Die Ursachen des Realitätsverlustes im Kontext von Kindheit und Rückzug aus der Gesellschaft
- Die Fehlinterpretationen von Natur und Lottes Verhalten
- Die Konsequenzen der psychischen Entwicklung und der Selbstmord
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Werkes ein und benennt die zentrale Fragestellung: die Darstellung des psychischen Zerfalls Werthers und die Ursachen seines Realitätsverlustes. Der Fokus liegt auf der Analyse der Erzählform und der subjektiven Perspektive des Protagonisten. Die Arbeit grenzt sich von anderen Interpretationen ab, die sich stärker auf den Selbstmord oder die Gesellschaftskritik konzentrieren, und begründet die Wahl des psychoanalytischen Ansatzes nach Ernst Feise.
Textpräsentation: Ein Beispiel für den Briefroman?: Dieses Kapitel diskutiert die Einstufung von Goethes „Werther“ als Briefroman. Obwohl die Form der Briefsammlung vorliegt, wird die Einseitigkeit der Perspektive, die Monolog-artige Natur der Briefe und das Fehlen eines echten Dialogs hervorgehoben. Der Autor betont die fehlende Interaktion mit dem Adressaten Wilhelm und die daraus resultierende Vereinsamung Werthers. Die einseitige Perspektive wird als ein Mittel der Steuerung des Rezipienten analysiert, wobei die bewusste Gestaltung der Textform im Hinblick auf Goethes Überarbeitung des Werkes und seine Unzufriedenheit mit der ursprünglichen Rezeption diskutiert wird.
Subjektives Erleben des Protagonisten: Dieses Kapitel befasst sich mit der subjektiven Wahrnehmung und dem psychischen Zustand Werthers. Es werden seine Kindheit und seine Abkehr von der menschlichen Welt detailliert untersucht, wobei Parallelen zu Rousseaus Menschen- und Naturbild gezogen werden. Die Isolation und der Mangel an echtem Austausch verschlimmern Werthers Zustand kontinuierlich. Die Kapitel beleuchten, wie die Erzählperspektive die Leser dazu bringt, Werthers subjektive Sichtweise zu übernehmen und die damit verbundenen Probleme.
Mögliche Konsequenzen seines Rückzugs: Das Kapitel analysiert die Konsequenzen von Werthers Rückzug in die Isolation. Es werden seine Fehlinterpretationen der Natur und von Lottes Verhalten ausführlich untersucht, um zu zeigen, wie diese Missverständnisse zu seiner zunehmenden Verzweiflung und seinem seelischen Leiden beitragen. Schließlich wird der Selbstmord als letzte Konsequenz seines psychischen Zerfalls dargestellt.
Schlüsselwörter
Goethes Werther, Briefroman, Realitätsverlust, Subjektive Wahrnehmung, Psychische Entwicklung, Selbstmord, Isolation, Rousseau, Fehlinterpretation, Gesellschaft, Liebesbeziehung.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“
Was ist der Hauptfokus dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ unter dem Aspekt des Verlusts der Realitätswahrnehmung des Protagonisten Werther. Es werden die Darstellung dieser psychischen Entwicklung, mögliche Ursachen und die daraus resultierenden Konsequenzen untersucht.
Welche Aspekte von Werthers psychischer Entwicklung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Werthers Kindheit, seinen Rückzug aus der Gesellschaft, seine Fehlinterpretationen der Natur und von Lottes Verhalten, sowie seinen daraus resultierenden seelischen Zerfall und Selbstmord. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der Erzählform als Briefroman und der subjektiven Wahrnehmung des Protagonisten.
Wie wird die Erzählform des Briefromans analysiert?
Die Seminararbeit hinterfragt die Einstufung von Goethes „Werther“ als klassischen Briefroman. Es wird die Einseitigkeit der Perspektive, der monologartige Charakter der Briefe und das Fehlen eines echten Dialogs hervorgehoben. Die einseitige Perspektive wird als Mittel zur Steuerung der Leser und im Kontext von Goethes Überarbeitung des Werkes diskutiert.
Welche Rolle spielt Rousseaus Denken in der Analyse?
Die Arbeit zieht Parallelen zwischen Werthers Abkehr von der menschlichen Welt und Rousseaus Menschen- und Naturbild. Rousseaus Einfluss auf Werthers Weltanschauung und seine Isolation werden untersucht.
Welche Konsequenzen von Werthers Rückzug werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Fehlinterpretationen der Natur und von Lottes Verhalten als Konsequenzen von Werthers Isolation. Diese Missverständnisse tragen zu seiner zunehmenden Verzweiflung und seinem seelischen Leiden bei, welches letztendlich in seinem Selbstmord gipfelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thematik der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethes Werther, Briefroman, Realitätsverlust, Subjektive Wahrnehmung, Psychische Entwicklung, Selbstmord, Isolation, Rousseau, Fehlinterpretation, Gesellschaft, Liebesbeziehung.
Welche Methode wird in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet einen psychoanalytischen Ansatz, angelehnt an die Ansätze von Ernst Feise, um Werthers psychischen Zerfall zu analysieren und zu verstehen.
Wie grenzt sich diese Arbeit von anderen Interpretationen ab?
Im Gegensatz zu Interpretationen, die sich stärker auf den Selbstmord oder die Gesellschaftskritik konzentrieren, fokussiert sich diese Arbeit auf die Darstellung des psychischen Zerfalls Werthers und die Ursachen seines Realitätsverlustes aus einer psychoanalytischen Perspektive.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2013, Goethes „Werther“ und die Alltagsrealität des 18. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213098