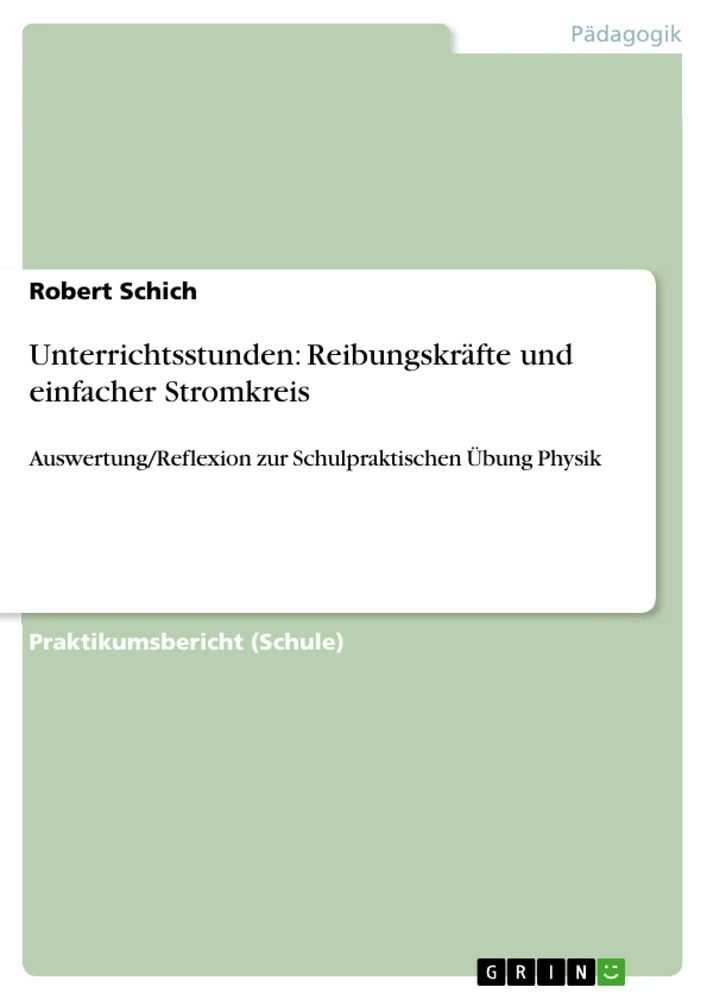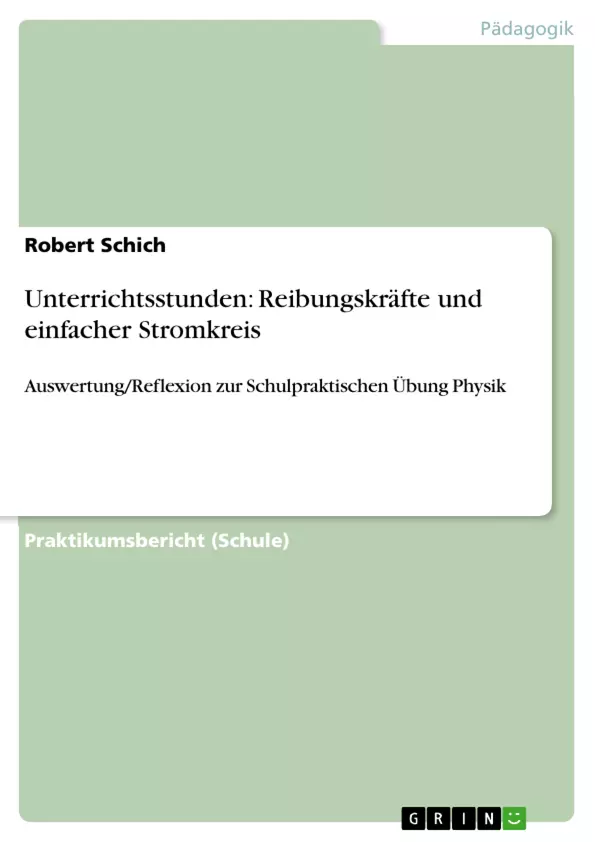„Im 1980 erschienenen Ergebnisband über den bundesweiten „Studieneingangstest Physik 1978“ heißt es resümierend: „Es steht nicht gut um das mathematisch-physikalische Wissen der von uns befragten Absolventen der höheren Schulen.“ Alle für die Schulbildung in der grundlegenden Naturwissenschaft „Physik“ Verantwortlichen müßen [sic!] sich für schnelle Verbesserungen einsetzen. Lehrer und Hochschullehrer müßen [sic!] verstärkt pädagogische Anstrengungen leisten.“1 Diese Aussage von Herrn Euler wurde vor 20 Jahren getätigt und es soll und kann in diesem reflexiven Bericht nicht überprüft werden, ob sich die Sachlage inzwischen geändert hat, doch besitzt das Zitat dennoch einen relevanten Stellenwert für den Autoren dieses Berichts und den Korrektor2, da beide Parteien in dem von Herrn Euler angesprochenen Prozess involviert sind und somit Einfluss auf die Entwicklung der Lehre von Physik generell und auch auf die persönliche Entwicklung einer Vielzahl von Personen (vorrangig Schülern und Studenten) ausüben. Besonders in Zeiten, in denen die gesellschaftliche Entwicklung relativ offen ist und die Erziehungsaufgabe sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren immer mehr auf die Schule verlagert, sollten sich Lehrende ihrer Stellung und ihrem Einfluss bewusst sein und diese bewusst annehmen und diese kritisch hinterfragen. Mit der Position des Physiklehrers, sei es an Schule oder Hochschule, geht also eine hohe Verantwortung einher, sodass zwei sehr wichtige Faktoren berücksichtigt werden müssen: Zum einen die Tatsache der Übung (besonders für angehende Physiklehrer, wie den Autoren) und zum anderen vor allem die (Selbst-)Überprüfung und –Reflexion. Besonders vor dem offenen Kontext der Didaktik („Eine abgeschlossene Theorie kann und will sie nicht vorweisen.“3), die sich stets weiterentwickelt und keine statische Maxime ausgibt, ist es von Bedeutung, sich ebenfalls weiter zu entwickeln. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Eine dieser Möglichkeiten bietet die Reflexion, die das Feedback anderer mit einschließt. Aus diesem Grund soll zum Teil der Übung (welchen die Schulpraktische Übung (SPÜ) in der siebten Klasse des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Dresden darstellte) nun der Teil der reflexiven Aufarbeitung mittels dieses Beleges zu den von mir im Laufe des Semesters absolvierten Unterrichtsstunden erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Reflexion der ersten Stunde. Thema: Reibungskräfte.
- Analyse der Phase fünf: Schülerexperiment zur Gleitreibungskraft und mögliche Alternative.
- Reflexion zur zweiten Stunde. Thema: Einfacher Stromkreis.
- Analyse der Phase drei: Schülerexperiment zum einfachen Stromkreis und mögliche Alternative.
- Fazit
- Eidesstattliche Erklärung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Reflexion beleuchtet zwei gehaltene Unterrichtsstunden im Fach Physik, die sich mit den Themen Reibungskräfte und einfache Stromkreise auseinandersetzen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Stunden, die Reflexion der Lernziele und die Evaluation des Unterrichtsverlaufs anhand der Schüleraktivitäten und der Interaktion zwischen Lehrer und Schülern. Darüber hinaus werden konkrete Kritikpunkte und Optimierungsmöglichkeiten der Stunden aufgezeigt, um zukünftigen Unterricht effektiv zu gestalten.
- Analyse der Lernziele und deren Erreichung in beiden Unterrichtsstunden.
- Kritik und Reflexion der Unterrichtsgestaltung, insbesondere der Schülerexperimente.
- Bewertung der Schüleraktivitäten und des Interaktionsmusters im Unterricht.
- Identifizierung von Verbesserungspotenzialen in Bezug auf Didaktik und Methodik.
- Zusammenfassende Beurteilung der Unterrichtsstunden und deren Wirksamkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Reflexion der ersten Stunde. Thema: Reibungskräfte.
In der ersten Unterrichtsstunde zum Thema Reibungskräfte wurden den Schülern die verschiedenen Arten der Reibung, ihre Einwirkung auf unterschiedliche Körper und das Wechselwirken von Kräften (Gewicht und Reibung) näher gebracht. Die Stunde beinhaltete ein Schülerexperiment zur Gleitreibungskraft, bei dem die Schüler Messwerte erhoben und in Tabellen und Diagrammen auswerteten. Die Reflexion zeigt, dass die Lernziele trotz des umfangreichen Inhalts erreicht wurden, jedoch einige Aspekte der Unterrichtsgestaltung wie die Länge der Stunde, die Gestaltung der Merksätze und die Interaktion mit den Schülern verbessert werden könnten.
Reflexion zur zweiten Stunde. Thema: Einfacher Stromkreis.
Die zweite Unterrichtsstunde behandelte das Thema des einfachen Stromkreises. Die Schüler führten ein Experiment durch, um die Funktionsweise eines einfachen Stromkreises zu verstehen und die einzelnen Komponenten zu identifizieren. Auch hier werden die Lernziele der Stunde analysiert und auf die Wirksamkeit des Unterrichts, die Schüleraktivitäten und die Interaktion im Unterricht eingegangen. Weiterhin werden konkrete Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die Durchführung des Schülerexperiments und die Gestaltung der Unterrichtsmaterialien aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Schülerexperiment, Reibungskräfte, Gleitreibung, einfache Stromkreise, Unterrichtsreflexion, Didaktik, Methodik, Schüleraktivität, Interaktion, Optimierungspotenzial, Verbesserungsmöglichkeiten, Kritikpunkte.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Reflexion für Physiklehrer wichtig?
Didaktik ist keine statische Wissenschaft. Durch Reflexion können Lehrer ihren Unterricht kritisch hinterfragen und methodisch an die Bedürfnisse der Schüler anpassen.
Was sind die Kerninhalte einer Stunde über Reibungskräfte?
Themen sind verschiedene Reibungsarten (wie Gleitreibung), das Wechselwirken von Kräften und die Durchführung von Messungen in Schülerexperimenten.
Wie wird das Thema „Einfacher Stromkreis“ im Unterricht vermittelt?
Durch Experimente identifizieren Schüler die Komponenten eines Stromkreises und verstehen dessen grundlegende Funktionsweise in der Praxis.
Welche Probleme können bei Schülerexperimenten auftreten?
Häufige Probleme sind Zeitmangel, unklare Instruktionen oder Schwierigkeiten bei der Auswertung der erhobenen Messdaten in Tabellen und Diagrammen.
Wie kann die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler verbessert werden?
Die Arbeit schlägt vor, Merksätze klarer zu gestalten und den Schülern mehr Raum für eigenständige Entdeckungen innerhalb der Experimente zu lassen.
- Quote paper
- Robert Schich (Author), 2012, Unterrichtsstunden: Reibungskräfte und einfacher Stromkreis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213119