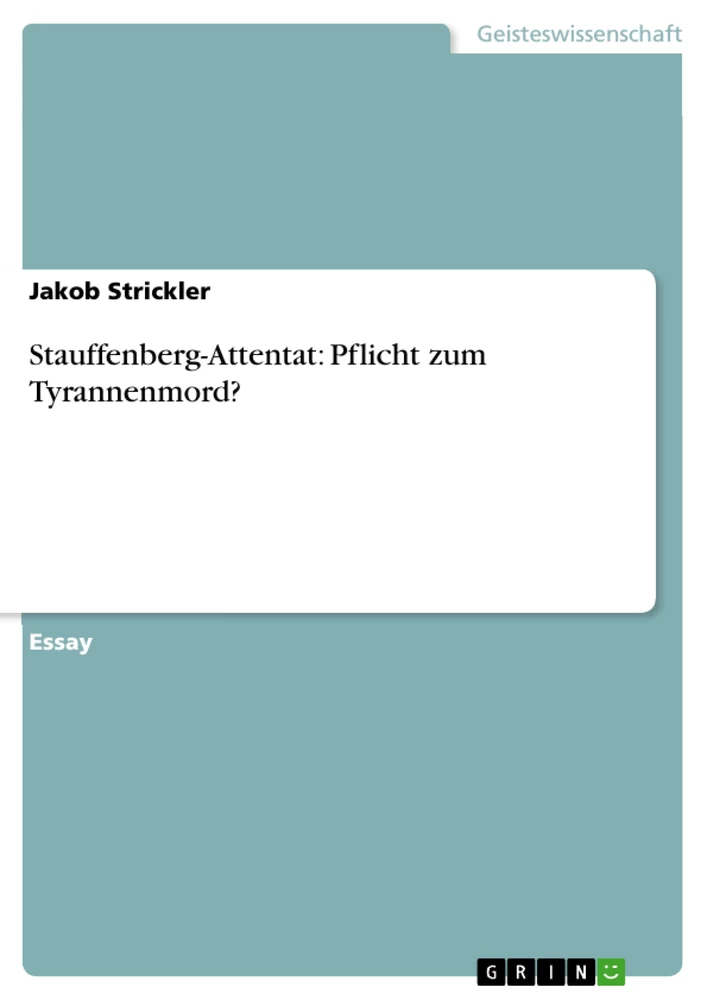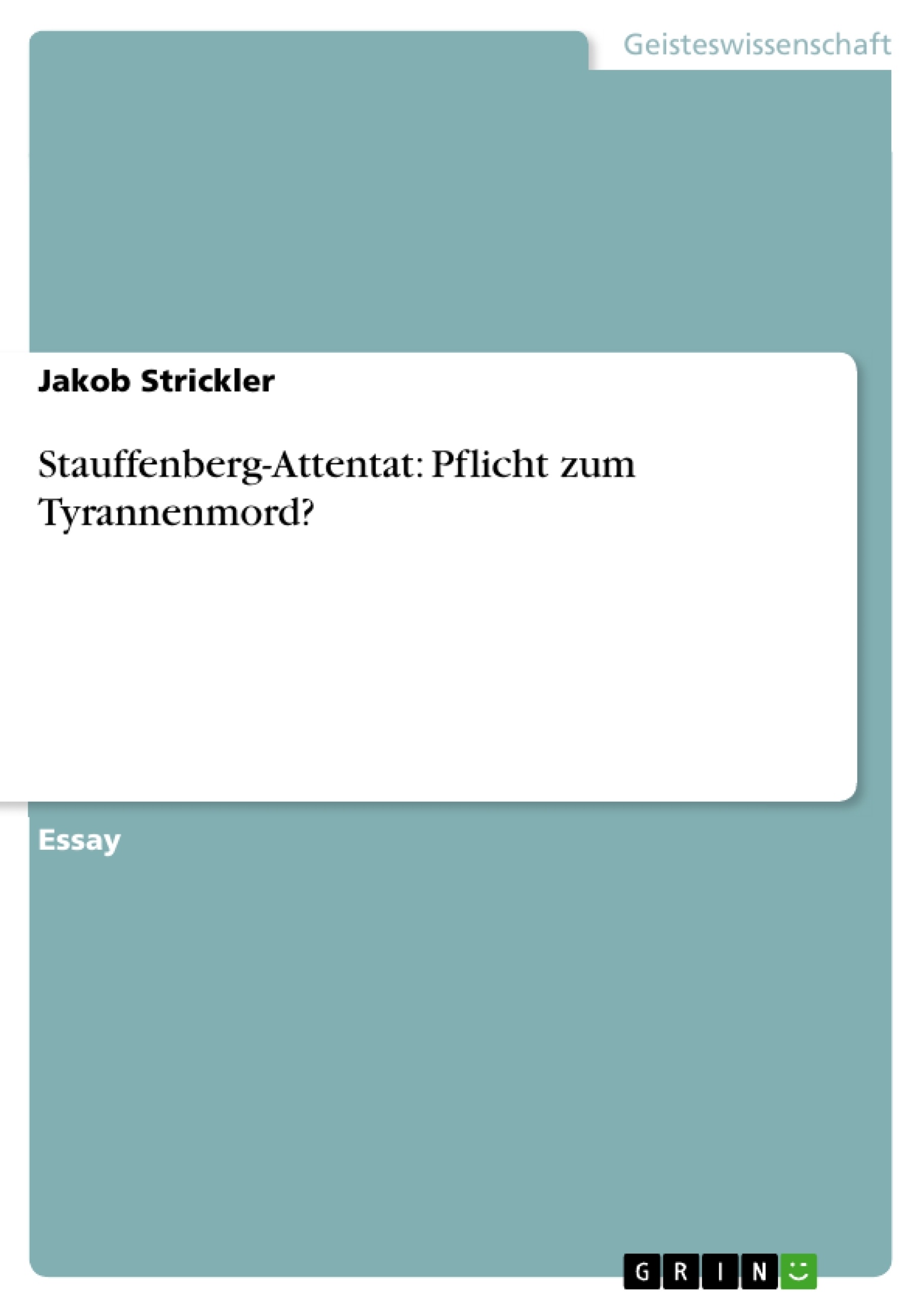In dem Essay wird die Fragestellung der Pflicht zum Tyrannenmord nach staatsphilosophischer Argumentation, vor allem im Bezug auf die Analysen Hannah Arendts diskutiert. Desweiteren folgt eine Einbeziehung der Positionen von Jürgen Habermas, Robert Spaemann und Hermann Lübe zum Widerstand im Nationalsozialismus, welche miteinander vergleichen und argumentativ erörtert wird. Schlussendlich wird auf Basis der Diskussion eine eigene Sichtweise begründet dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Hannah Arendt: Elemente der totalitären Herrschaft
- Robert Spaemann: Legitimität des Widerstandes gegen den Staat
- Jürgen Habermas: Recht auf Widerstand
- Hermann Lübbe: Moralische Grundsätze der Menschenrechte
- Schluss / Konklusion
- Quellen
- Literaturnachweis
- Sonstige Quellen (Internet)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay „Stauffenberg-Attentat" befasst sich mit der ethischen Frage der Pflicht zum Tyrannenmord im Kontext des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Der Autor analysiert die Positionen verschiedener Philosophen, darunter Hannah Arendt, Robert Spaemann und Hermann Lübbe, um die Legitimität des Widerstandes gegen eine totalitäre Herrschaft zu erörtern.
- Totalitäre Herrschaft und Propaganda
- Legitimität des Widerstands
- Tyrannenmord und moralische Rechtfertigung
- Rolle der Ideologie im Nationalsozialismus
- Der kategorische Imperativ und das Recht auf Leben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Fallbeispiel des Stauffenberg-Attentats vor und skizziert die Fragestellung des Essays: die Pflicht zum Tyrannenmord unter staatsphilosophischen Gesichtspunkten. Der Autor kündigt an, die Positionen von Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Robert Spaemann und Hermann Lübbe zum Widerstand im Nationalsozialismus zu analysieren und im Anschluss seine eigene Sichtweise zu darlegen.
Im Hauptteil wird zunächst Hannah Arendts Analyse der Elemente der totalitären Herrschaft vorgestellt. Arendt identifiziert Propaganda und Terror als wesentliche Bestandteile des totalitären Regimes, die zur Unterdrückung von Pluralismus und zur vollständigen Unterwerfung der Gesellschaft führen. Die Konzentration auf die Selbsterhaltung des eigenen Lebens und die Beseitigung von Andersdenkenden durch Gewalt sind weitere Kennzeichen der totalitären Herrschaft. Arendt fordert jedoch nicht explizit zum Widerstand auf, sondern plädiert dafür, die Welt so zu verändern, dass Verfolgung und Versklavung nicht mehr möglich sind.
Robert Spaemann argumentiert, dass der Staat einen Teil der Gewalt beansprucht, um die Freiheit des Individuums zu garantieren. Eine Gefährdung dieser Grundordnung kann durch Anarchie oder Despotismus entstehen. Spaemann sieht den Nationalsozialismus als Rechtsbrecher, der die unveräußerlichen Rechte des Individuums verletzt. Er argumentiert, dass die Aufflebung der Redefreiheit und der Freiheit auf Wahl des Aufenthaltsortes auch außerhalb des eigenen Landes durch Auswanderung notwendig sind, um sich der Zustimmung des Staates zu entziehen. Spaemann leitet aus diesem Recht auf Auswanderung die Legitimation zur Anwendung von Gewalt zum Widerstand gegen den Staat ab.
Hermann Lübbe argumentiert, dass das Recht auf Widerstand bereits aus den moralischen Grundsätzen der Menschenrechte resultiere und daher im Grundgesetz nicht explizit erwähnt werden müsse. Er kritisiert die außerparlamentarische Opposition, da sie die Fähigkeit zur objektiven Beurteilung der Lage und die Feststellung der Altemativlosigkeit der politischen Handlungsmöglichkeiten fehle. Lübbe sieht den Nationalsozialismus als legitim, da er sich durch freie Wahlen etablierte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Tyrannenmord, den Widerstand gegen den Staat, die totalitäre Herrschaft, die Propaganda, die Ideologie des Nationalsozialismus, die Menschenrechte, die moralische Rechtfertigung von Gewalt und den kategorischen Imperativ. Der Text analysiert die Frage, ob der Widerstand gegen eine totalitäre Herrschaft, auch unter Einsatz von Gewalt, gerechtfertigt ist, und diskutiert die moralischen und politischen Implikationen des Tyrannenmords.
Häufig gestellte Fragen
War das Stauffenberg-Attentat moralisch gerechtfertigt?
Der Essay diskutiert diese Frage anhand staatsphilosophischer Argumente, wobei der Widerstand gegen ein totalitäres Regime als Schutz der Menschenrechte betrachtet wird.
Wie analysiert Hannah Arendt die totalitäre Herrschaft?
Arendt identifiziert Propaganda und Terror als Kernmittel totalitärer Systeme, die darauf abzielen, Pluralismus zu vernichten und Menschen vollständig zu unterwerfen.
Welche Position vertritt Robert Spaemann zum Widerstandsrecht?
Spaemann sieht den Nationalsozialismus als Rechtsbrecher und leitet aus der Verletzung unveräußerlicher Individualrechte eine Legitimation für gewaltsamen Widerstand ab.
Was versteht man unter der "Pflicht zum Tyrannenmord"?
Es ist die ethische Überlegung, ob Bürger verpflichtet sind, einen Despoten zu beseitigen, wenn dieser die Grundordnung und das Leben der Menschen massiv gefährdet.
Wie sieht Hermann Lübbe das Recht auf Widerstand?
Lübbe argumentiert, dass das Widerstandsrecht direkt aus moralischen Menschenrechten resultiert, sieht aber die Gefahr subjektiver Fehlbeurteilungen bei außerparlamentarischem Widerstand.
- Arbeit zitieren
- Jakob Strickler (Autor:in), 2013, Stauffenberg-Attentat: Pflicht zum Tyrannenmord?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213302