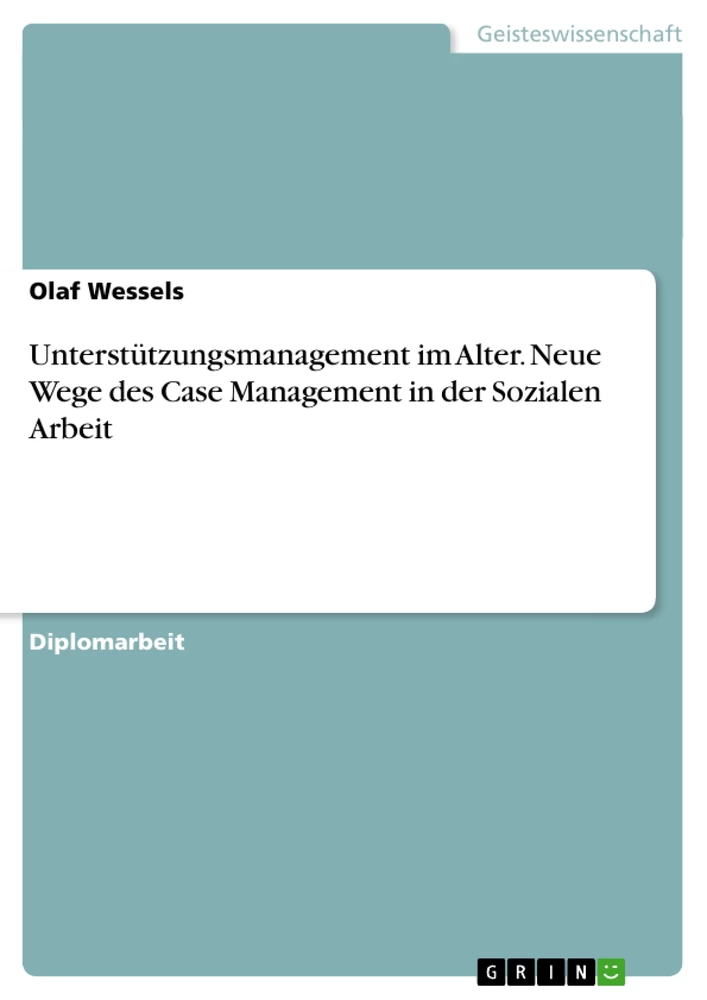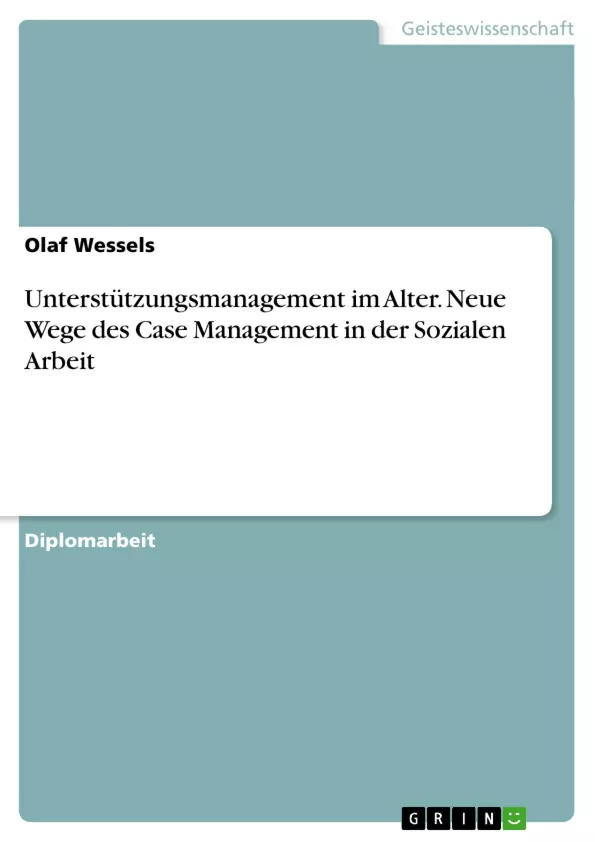Case Management und Unterstützungsmanagement sind Schlagworte, die in der Diskussion um die Neu- bzw. Umstrukturierung unserer Gesundheits- und Sozialsysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen. Stetig steigende Kosten im Sozial- und Gesundheitswesen und demgegenüber die notorisch leeren Kassen der öffentlichen Hand zwingen dazu, vorhandene materielle und finanzielle Ressourcen gezielter zu steuern und trotzdem eine hohe Versorgungsqualität für die betroffenen Bevölkerungsgruppen zu erhalten.
Diese Ressourcen-Steuerung kann zukünftig durch sogen. Case Manager erfolgen, die für öffentl. Institutionen, Wohlfahrtsverbände, etc. arbeiten. Ihre Aufgabe wird es sein, die Bedürfnisse der Hilfeempfänger einerseits mit den Vorgaben von Politik und Gesellschaft in Bezug auf die damit verbundenen Kosten andererseits, zu einer akzeptablen Synthese zu führen. Ein möglicher Weg ist dabei die Verselbständigung der im sozialen Bereich beschäftigten Berufsgruppen. Im Rahmen dieses Buches soll daher geklärt werden, ob in der BRD eine freiberufliche Tätigkeit als Case Manager denkbar ist und inwieweit dies eine Alternative zu bisherigen Beschäftigungsverhältnissen darstellt. Es wird untersucht, ob die Arbeit als Freiberufler den Sozialpädagogen realistische Zukunftsperspektiven bietet und welche Vor- bzw. Nachteile sich hieraus für die Adressaten ihrer Leistung ergeben.
Dabei bezieht sich meine Betrachtung schwerpunktmäßig auf die Bereiche erwachsene und ältere Menschen, sowie Frauen und Familien als Adressaten der Unterstützungsleistung und es werden die diesbezüglich beeinflussenden demographischen und soziologischen Entwicklungen skizziert. Es folgen Begriffsbestimmung, Definitionen, Ziele und Funktionen von Case Management, dessen Adressaten bzw. Zielgruppen werden bestimmt, verschiedene Konzepte aufgelistet, klassifiziert und unterschieden. Danach betrachte ich das Arbeitsverhältnis zwischen Case Manager und Klient und die einzelnen Phasen des Unterstützungsprozesses werden beschrieben. Weiter erfolgt ein Ausblick auf eine freiberufliche Tätigkeit als Case Manager.
Der Frage der Finanzierung, sowie der passenden Rechtsform einer freiberuflichen Tätigkeit im Sozialsektor wird nachgegangen. Es werden drei mögliche Kooperationsmodelle mit anderen Professionen vorgestellt und diskutiert. Abschließend folgen Zusammenfassung und Bewertung der untersuchten Sachverhalte, sowie ein Ausblick auf die zukünftigen Perspektiven, die sich hieraus für Freiberufler im Sozialsektor ergebe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftliche Entwicklungen in der Bundesrepublik
- Die Entwicklung unserer Bevölkerung
- Geburtenhäufigkeit
- Bevölkerungsstruktur und Altersverteilung
- Aus- und Zuwanderungen
- Familien- und Haushaltsstrukturen
- Einstellung und Wertorientierung in unserer Gesellschaft
- Frauen zwischen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit
- Die Konsequenzen dieser Entwicklung
- Was ist Unterstützungs- bzw. Case Management?
- Begriffsbestimmung
- Definition
- Warum brauchen Menschen einen Unterstützungsmanager?
- Externe Behinderungen
- Eigenes Unvermögen
- Interne Hemmungen
- Ziele und Funktionen von Unterstützungs- oder Case Management
- Der Unterstützungsmanager als „Anwalt“ des Klienten
- Der Unterstützungsmanager als „Vermittler“
- Der Unterstützungsmanager als „Torwächter“
- Case Management Konzepte und ihre Klassifizierung
- Die verschiedenen Stadien des Unterstützungsmanagements
- Stadium 1: Verpflichtung oder Engagement
- Stadium 2: Einschätzung oder Assessment
- Stadium 3: Planung
- Stadium 4: Erschließung der Ressourcen
- Stadium 5: Koordination
- Stadium 6: Entpflichtung oder Disengagement
- Der Sozialpädagoge als selbstständiger Unterstützungsmanager
- Berufliche Selbstständigkeit versus Anstellung in einer Organisation
- Anstellung oder Selbstständigkeit – eine Gegenüberstellung
- Der Unterstützungsmanager als freiberuflicher Dienstleister
- Das Arbeitsfeld und die Zielgruppe der Unterstützungsleistung
- Aufgaben des Unterstützungsmanagers
- Zusätzliche Qualifikationen des Unterstützungsmanagers
- Die Finanzierung der freiberuflichen Unterstützungsleistung
- Die Privatisierung sozialer Dienstleistungen
- Die Berufsbetreuung als Vorbild eines Finanzierungskonzeptes für freiberufliches Unterstützungsmanagement
- Rechtsformen für Freiberufler im Sozialsektor
- Der Hausarzt als Ansprechpartner bei gesundheitlichen Problemen und psychosozialen Krisen
- Kooperation des Hausarztes mit anderen Berufsgruppen
- Unterschiedliche Kooperationsmodelle
- Der Unterstützungsmanager als Angestellter des Hausarztes
- Der Unterstützungsmanager als selbstständiger Partner des Hausarztes
- Die Kooperation des Unterstützungsmanagers mit anderen Berufsgruppen und Institutionen
- Gegenüberstellung der einzelnen Modelle
- Zusammenfassung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Unterstützungs- bzw. Case Managements im Kontext der Herausforderungen, die sich durch die demographische Entwicklung, die zunehmende Individualisierung und die sich wandelnden Bedürfnisse im Sozial- und Gesundheitswesen ergeben. Sie analysiert die Notwendigkeit und die Funktionen von Case Management als Instrument zur Steuerung von Ressourcen und zur Optimierung der Unterstützung für Bedürftige. Zudem werden die Möglichkeiten der Selbstständigkeit im Sozialbereich für Case Manager beleuchtet und verschiedene Kooperationsmodelle mit anderen Berufsgruppen, insbesondere mit Hausärzten, untersucht.
- Steigende Kosten und Ressourcenknappheit im Sozial- und Gesundheitswesen
- Demographischer Wandel und seine Auswirkungen auf die Soziale Arbeit
- Case Management als Instrument der Ressourcen-Steuerung und Bedarfsorientierung
- Selbstständigkeit im Sozialbereich und Möglichkeiten für Case Manager
- Kooperationsmodelle von Case Managern mit anderen Berufsgruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz von Case Management im Kontext der demographischen Entwicklung und der aktuellen Herausforderungen im Sozial- und Gesundheitswesen heraus. Kapitel 2 analysiert die demographischen Entwicklungen in der Bundesrepublik und deren Konsequenzen für die soziale Arbeit. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Begriff, der Definition und den Zielen des Unterstützungsmanagements. Es werden die verschiedenen Stadien des Case Managements und die Rolle des Case Managers als „Anwalt“, „Vermittler“ und „Torwächter“ erläutert. Kapitel 4 betrachtet die Selbstständigkeit von Sozialpädagogen als Case Manager. Es werden die Vorteile und Herausforderungen der Selbstständigkeit, die Finanzierungsmöglichkeiten und die Bedeutung von Kooperationen mit anderen Berufsgruppen, insbesondere mit Hausärzten, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Case Management, Unterstützungsmanagement, Ressourcen-Steuerung, Demographischer Wandel, Soziale Arbeit, Selbstständigkeit, Kooperation, Hausarzt, Gesundheitssystem, Sozialsystem.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel von Case Management in der Sozialen Arbeit?
Das Ziel ist die gezielte Steuerung vorhandener Ressourcen bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität für Hilfeempfänger.
Welche Rollen nimmt ein Unterstützungsmanager ein?
Er fungiert als „Anwalt“ des Klienten, als „Vermittler“ zwischen verschiedenen Parteien und als „Torwächter“ bezüglich der Ressourcensteuerung.
Welche Phasen umfasst der Unterstützungsprozess?
Der Prozess gliedert sich in sechs Stadien: Verpflichtung, Einschätzung (Assessment), Planung, Erschließung der Ressourcen, Koordination und Entpflichtung.
Ist eine freiberufliche Tätigkeit als Case Manager in Deutschland möglich?
Die Arbeit untersucht diese Möglichkeit als Alternative zum Angestelltenverhältnis und analysiert dabei Finanzierungskonzepte und Rechtsformen.
Wie können Case Manager mit Hausärzten kooperieren?
Es werden Modelle wie die Anstellung beim Arzt, die Partnerschaft als Selbstständiger oder die institutionelle Kooperation diskutiert.
- Citar trabajo
- Diplom Sozialpädagoge Olaf Wessels (Autor), 2001, Unterstützungsmanagement im Alter. Neue Wege des Case Management in der Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21340