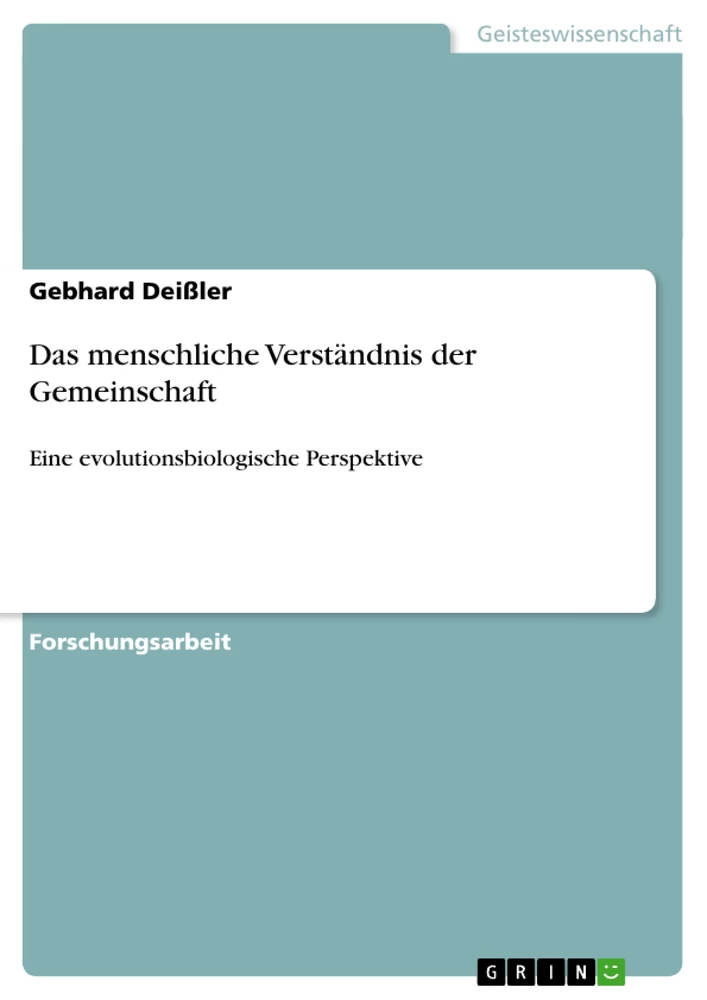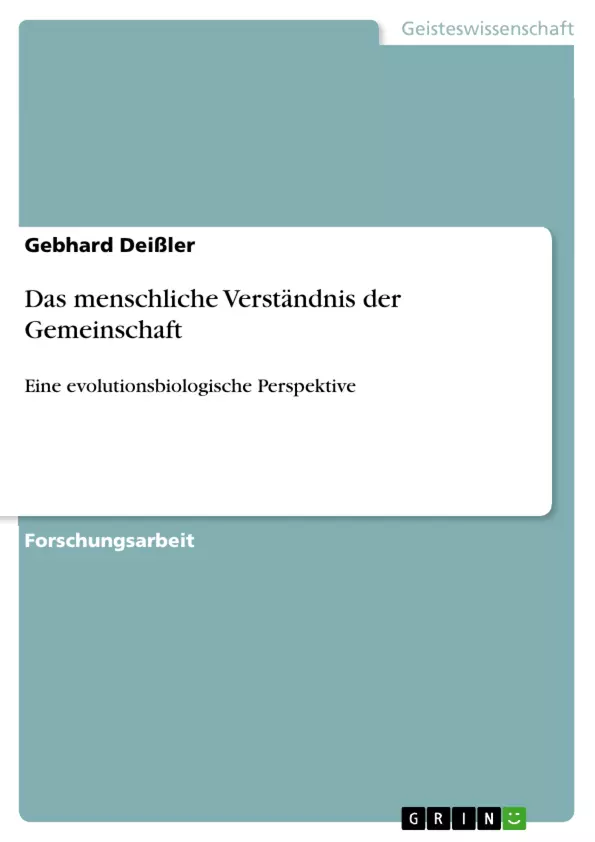Überlebens-, Macht- und Selbstbehauptungsmotive haben den Menschen veranlasst, in kollektivistischen Strukturen zu verharren und sie zu seinem vermeintlichen Wohle weiterzuentwickeln. Während die Menschen sich in früheren Epochen der menschlichen Entwicklung zu Horden zusammenschließen mussten, um gegen die Übermacht der Natur und für den Nahrungserwerb erfolgreich zu bestehen, wurde dem ursprünglich überlebensförderlichen Kollektivisierungsmotiv des Menschen in späteren Zeiten und insbesondere durch die scheinbare soziale Erfordernis der Selbstbehauptung und des Machtstrebens zwischen Gruppen ein weiteres bedeutendes Kollektivisierungsmotiv hinzugefügt. Der Krieg ist der Gipfel der kollektivistischen Bündelung aller materiellen und menschlichen Ressourcen auf ein Ziel hin: den Sieg über den Feind.
Inhaltsverzeichnis
- Das menschliche Verständnis der Gemeinschaft
- Uberlebens-, Macht- und Selbstbehauptungsmotive
- Die Kollektivisierungsdynamik
- Der Krieg als Replikation des Jagdmotivs
- Die Verherrlichung des Jagdmotivs in Kunst und Kultur
- Die Sozialisierung auf archaische Verhaltensmuster
- Die Durchdringung von Zivilisationsphasen
- Die interkulturelle Forschung und ihre Grenzen
- Die soziale Verantwortung von Wissenschaftlern
- Die Fragmentierung der menschlichen Belange
- Die Reaktivierung des Jagdmotivs in der Gegenwart
- Das Christentum und die Schöpfung
- Das christliche Menschenbild und die Reevangellisierung
- Die Bewusstwerdung der Integrationserfordernis
- Der Mensch auf dem falschen Schlachtfeld
- Die Bewusstseinsanatomie und der transkulturelle Profiler
- Die 12-Ebenen Architekturmetapher des internationalen strategischen Akteurs
- DI Cosmics
- D2 Noetics
- D3 Operationalization
- D4 Ethics
- D5 Evolution
- D6 ICP Individual Culture profile
- D7 NCP National Culture Profile
- D8 Communications Profile
- D9 Corporate Management Profile
- DIO Intercultural management competencies
- DII Trust
- DI2 Planetary interface
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch „Das menschliche Verständnis der Gemeinschaft: Eine evolutionsbiologische Perspektive“ von Gebhard Deißler untersucht die Wurzeln des menschlichen Kollektivismus und dessen Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft. Es analysiert die Rolle von Uberlebens-, Macht- und Selbstbehauptungsmotiven in der Menschheitsgeschichte und beleuchtet, wie diese Motive zu einem archaischen Jagd- und Machtinstinkt geführt haben, der bis heute in verschiedenen Formen präsent ist.
- Die Entwicklung des menschlichen Kollektivismus
- Der Einfluss des Jagd- und Machtinstinkts
- Die Rolle des Christentums in der Menschheitsgeschichte
- Die Herausforderungen des Interkulturellen Managements
- Der transkulturelle Profiler als Modell für eine integrative Bewusstseinsdynamik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Buches beleuchtet die Uberlebens-, Macht- und Selbstbehauptungsmotive, die den Menschen veranlasst haben, in kollektivistischen Strukturen zu verharren. Es wird gezeigt, wie diese Motive in Urzeiten aus biologisch-umweltlichen Uberlebensbeweggründen entstanden sind und wie sie sich im Laufe der Menschheitsgeschichte weiterentwickelt haben.
Das zweite Kapitel analysiert die Kollektivisierungsdynamik und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft. Es wird die Rolle von mythischen, rassischen und ideologischen Triebkräften in der Konsolidierung des Kollektivs untersucht und die Bedeutung des Krieges als Ausdruck des Jagdinstinkts hervorgehoben.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Verherrlichung des Jagdmotivs in Kunst und Kultur und zeigt, wie dieses Motiv in der menschlichen Psyche verankert ist und sich in verschiedenen Formen manifestiert. Es wird die Rolle der Sozialisierung in der Weitergabe dieser Verhaltensmuster und die Folgen für die heutige Gesellschaft untersucht.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Durchdringung von Zivilisationsphasen und die Herausforderungen des Interkulturellen Managements. Es wird die Rolle der interkulturellen Forschung und ihre Grenzen diskutiert und die Notwendigkeit einer ethischen Dimension im Umgang mit kultureller Diversität betont.
Das fünfte Kapitel untersucht das christliche Menschenbild und dessen Bedeutung für die Integration des Jagd- und Machtinstinkts. Es wird die Rolle der Reevangellisierung und die Notwendigkeit einer bewussten Integration älterer Strukturen in neuere Bewusstseinsstrukturen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den menschlichen Kollektivismus, den Jagd- und Machtinstinkt, das Christentum, die interkulturelle Forschung, das transkulturelle Management und die Bewusstseinsdynamik. Der Autor beleuchtet die Herausforderungen der Integration von Diversität in der modernen Gesellschaft und die Notwendigkeit einer ethischen und integrativen Bewusstseinsentwicklung. Der Text analysiert die verschiedenen Ebenen des menschlichen Bewusstseins und ihre Auswirkungen auf das menschliche Verhalten in interkulturellen Kontexten. Die evolutionsbiologische Perspektive bietet einen umfassenden Rahmen für die Analyse der Menschheitsgeschichte und die Herausforderungen der Gegenwart.
Häufig gestellte Fragen
Welche Motive treiben Menschen in kollektivistische Strukturen?
Ursprünglich waren Überlebens-, Macht- und Selbstbehauptungsmotive entscheidend, um gegen die Natur und beim Nahrungserwerb erfolgreich zu sein.
Warum wird Krieg als Gipfel des Kollektivismus betrachtet?
Der Krieg bündelt alle materiellen und menschlichen Ressourcen auf ein einziges Ziel: den Sieg über einen Feind, was eine radikale Form der Kollektivierung darstellt.
Was ist das "Jagdmotiv" in der modernen Gesellschaft?
Es handelt sich um ein archaisches Verhaltensmuster des Machtstrebens, das in Kunst, Kultur und modernen Wettbewerbsstrukturen reaktiviert wird.
Welche Rolle spielt das christliche Menschenbild?
Das Buch thematisiert das Christentum und die Schöpfung als mögliche Wege zur Reevangelisierung und Bewusstwerdung der notwendigen Integration des Menschen.
Was ist die "12-Ebenen Architekturmetapher"?
Es ist ein Modell für internationale strategische Akteure, das von kosmischen und ethischen Ebenen bis hin zu individuellen Kulturprofilen reicht.
- Citar trabajo
- D.E.A./UNIV. PARIS I Gebhard Deißler (Autor), 2013, Das menschliche Verständnis der Gemeinschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213626