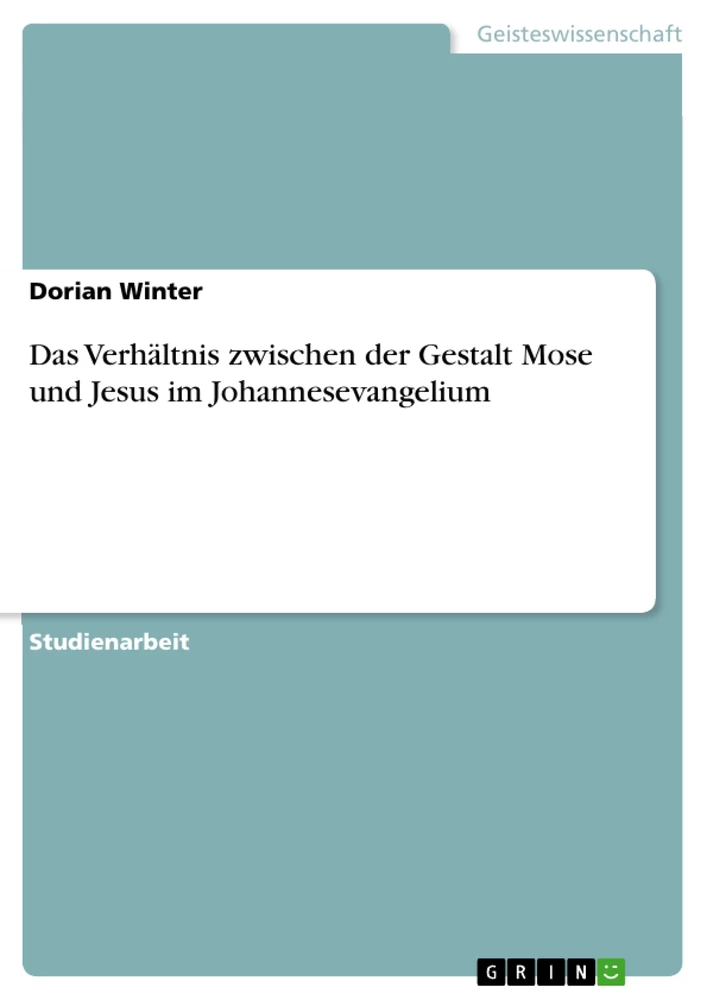Die folgende Arbeit befasst sich mit der Gestalt des Mose im Johannesevangelium. Der
Umstand, dass das Johannesevangelium Mose insgesamt sieben Mal namentlich nennt, macht
die Rezeption des Moses durch dessen Autor zu einem beachtenswerten Objekt. Zunächst soll
die literarische Situierung der Mose-Erwähnungen im Gesamtzusammenhang des
Johannesevangeliums betrachtet werden. Danach analysiert die Arbeit schwerpunktmässig
jede der sieben namentlichen Erwähnungen zunächst einzeln und versucht zu verstehen, wie
der Evangelist Johannes Mose darstellt. Dabei werden der inhaltliche und literarische Kontext
beleuchtet und hinsichtlich der Frage nach Gestalt des Mose und dem Verhältnis zur Person
Jesu ausgewertet. Anschließend sollen die daraus resultierenden Ergebnisse auf eine mögliche
Systematik untersucht werden, die Auskunft über das Verhältnis zwischen Moses und Jesus in
der Intention des Autors des Evangeliums geben soll. Abschließend soll verbunden mit dem
Fazit der Frage nachgegangen werden, ob anhand des selektiven Verhältnisses zwischen
Mose und Jesus von einer Kontinuität oder einer Diskontinuität der beiden Testamente
ausgegangen werden kann. In Anbetracht dessen, dass die frühneuzeitlichen protestantischen
Schriften gerne die Formulierung „das Gesetz Mosij“ in abwertender Polemik zwecks
christozentrischer Absichten verwendeten, bekommt der gewählte Schwerpunkt eine
Bedeutung, die nicht nur von Interesse für die antike johanneischen Gemeinde war. Als
Textgrundlage dient die Übersetzung der Elberfelder Bibel, wo es von semantischer
Bedeutung ist, wird der griechische Urtext herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2. Intertextuelle Einordnung des Mose-Erwähnungen
3.1. Mose im Johannesprolog (1,17)
3.2. Mose in der Berufungserzählung (1,45)
3.3. Mose im Nikodemusgespräch (3,14)
3.4. Mose in der ersten Verteidigungsrede Jesu (5,45f.)
3.5. Mose in der Brotrede (6,32)
3.6. Mose im Streitgespräch während des Laubhüttenfestes (7,19.22f)
3.7. Mose im Gespräch über den Blindgeborenen (9,28)
4. Systematik der Mose-Erwähnungen
5. Fazit
6 Quellen- und Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie oft wird Mose im Johannesevangelium erwähnt?
Mose wird im Johannesevangelium insgesamt sieben Mal namentlich erwähnt, was seine Bedeutung für den Autor unterstreicht.
In welchem Verhältnis stehen Mose und Jesus laut Johannes?
Die Arbeit untersucht, ob das Verhältnis als Kontinuität oder Diskontinuität zwischen dem Alten und Neuen Testament zu verstehen ist, wobei Jesus oft als Erfüllung oder Übersteigerung des mosaischen Gesetzes dargestellt wird.
Welche biblischen Szenen mit Mose-Bezug werden analysiert?
Analysiert werden unter anderem der Prolog (1,17), das Nikodemusgespräch (3,14), die Brotrede (6,32) und das Gespräch über den Blindgeborenen (9,28).
Warum ist der Begriff "Gesetz Mosis" historisch belastet?
In frühneuzeitlichen protestantischen Schriften wurde der Begriff oft in abwertender Polemik verwendet, um christozentrische Absichten zu untermauern.
Dient der griechische Urtext als Grundlage der Arbeit?
Ja, während die Elberfelder Bibel als Textgrundlage dient, wird bei semantisch wichtigen Stellen der griechische Urtext zur Analyse herangezogen.
- Arbeit zitieren
- Dorian Winter (Autor:in), 2013, Das Verhältnis zwischen der Gestalt Mose und Jesus im Johannesevangelium, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213834