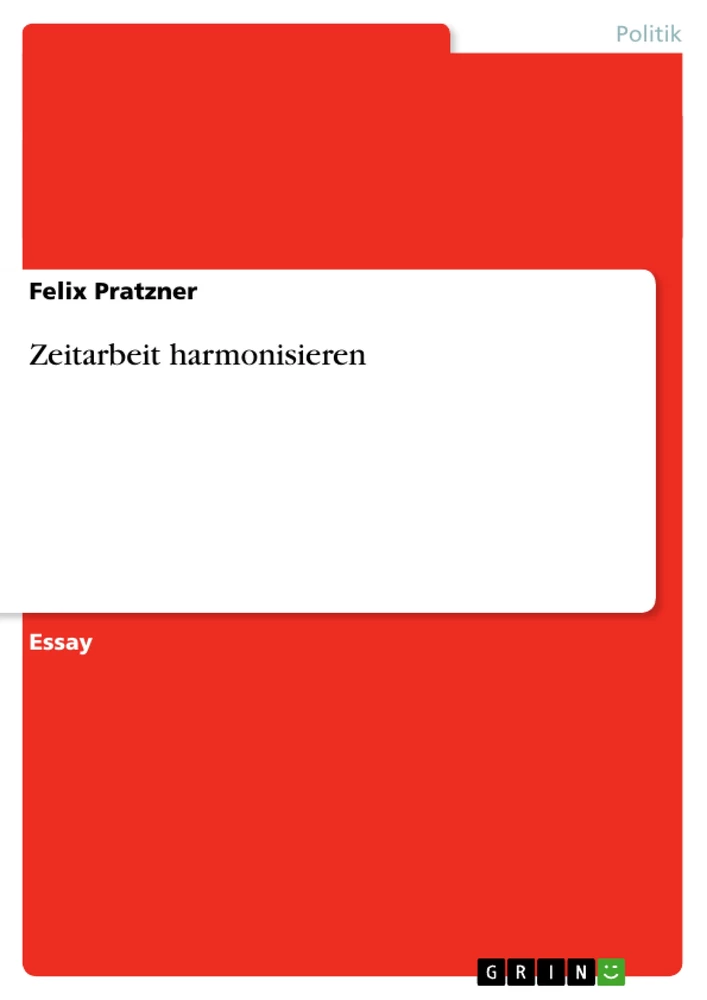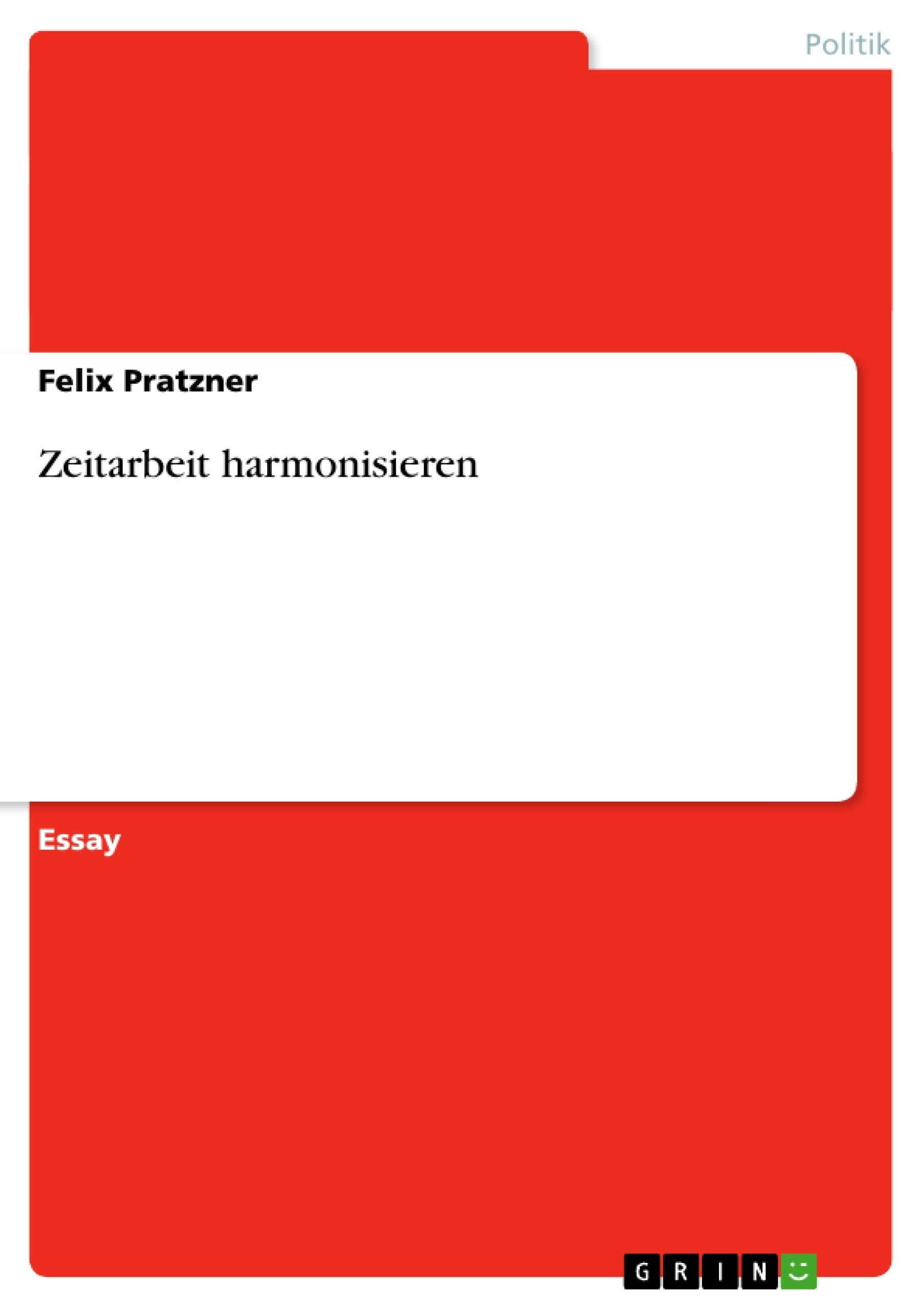Dieser Essay stellt sich der Forschungsfrage: Reicht die aktuelle Regulierungsformen der Zeitarbeit auf EU-Ebene aus oder sollte eine vertiefte Harmonisierung angestrebt werden?
Hierzu werden Konzepte der Wirtschaftswissenschaften, der Politikwissenschaften und spezieller der Internationalen Politischen Ökonomie verwendet.
Zeitarbeit harmonisieren
Würde Günther Wallraff heutzutage noch ein Buch ähnlich seines „Ganz Unten“ schreiben, würde er es wahrscheinlich „Legal Ganz Unten“ nennen und Zeitarbeiter werden. Unternehmen sorgen gefühlt ständig mit Zeitarbeitsskandalen für Schlagzeilen. Nun auch noch Amazon obwohl die EU regulierend mit der Richtlinie 2008/104/EG eingriff, die equal pay und equal treatment vorschrieb und die schon 2012 umgesetzt sein sollte. Diese Richtlinie wurde von Deutschland zwar umgesetzt jedoch äußerst un- genügend. Der Sachverständigenrat nennt in seinem Jahresgutachten 2011/2012 für Zeitarbeit drei Urteilskriterien, nämlich Entlohnung, Beschäftigungsstabilität und Brü- ckenfunktion in den ersten Arbeitsmarkt, die als Klebewahrscheinlichkeit operationali- siert wird. Diese beträgt nach dem Sachverständigenrat 17 %. Der Lohn von Zeitarbei- tern wird auf etwa 1/3 weniger als Festangestellte geschätzt, mit Berücksichtigung des Humankapitals nennt der Sachverständigenrat eine Bezahlung, die um 10 - 20 % unter dem von festangestellten Arbeitern liegt.1 Angesichts solcher drastischen Abweichun- gen vom Ziel nach Fristablauf der Umsetzung in nationales Recht ist fraglich ob diese Harmonisierung sinnvoll war und wie wichtig diese Harmonisierung ist.
Dieser Essay bewertet die Wichtigkeit der Harmonisierung von Zeitarbeit. Hierbei wird anhand der Theorie des schädlichen Steuerwettbewerbs untersucht, ob Zeitarbeit die Eigenschaften eines Kriteriums der Race-to-the-Bottom-These, auch Wettlauf-nach- unten genannt, hat bzw. dieses anschieben könnte. Dafür hinreichende Kriterien sind auf nationaler Ebenen die Erhöhung der Mobilität des Unternehmen oder von Unterneh- mensteilen durch ein Absenken von Kündigungsfristen oder Kündigungskosten, die die Wechselkosten senken, also einen Länderwechseln von Unternehmen oder Unterneh- mensteilen erleichtern. Dies könnte schwächend auf die Verhandlungsposition von Leiharbeitnehmern in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber wirken, da je höher die Mo- bilität des Unternehmens ist, desto glaubwürdiger ist die Androhung des Arbeitgebers die exit-option zu nutzen.2
Auf supranationaler Ebene bestehen die Kriterien aus strukturellen Defiziten in den be- stehenden Richtlinien, die den Ländern auf nationaler erhebliche Spielräume einräumen um möglicherweise einseitig zu ihrem Vorteil zu agieren. Ebenso ist der jeweilige Poli- tikbereich auf ein Gefangenendilemma zu untersuchen. Das wichtigste Kriterium ist jedoch, ob im Rahmen dieses Gefangenendilemma wirklich grenzüberschreitende Phänomene bezüglich Zeitarbeit durch eine fehlende Harmonisierung vorhanden sind und ob diese klar auf die fehlende Harmonisierung zurückzuführen sind, Zeitarbeit also nachweißbar ein klar abgrenzbarer Spill-over-Effekt ist. Je mehr dieser Kriterien erfüllt sind desto wichtiger ist eine klare einklagbare Harmonisierung der Zeitarbeit auf EUEbene, die über die heutige Form hinausgeht.
Ein Gefangenendilemma besteht, wenn durch einseitiges Handelns eines Akteurs Vor- teile für diesen errungen werden können. In Falle der Zeitarbeit wären dies neue Unternehmen, die Steuer bezahlen und Arbeitsplätze schaffen, die durch das Absenken der Arbeitskosten oder die Erhöhung der Mobilität von Unternehmen oder Unternehmensteilen in das jeweilige Land kommen, das in der unvollkommenen Vereinbarung Schlupflöcher nutzt, also defektiert. Dies ist grundsätzlich möglich, da niedrigere Arbeitskosten bei gleicher Humankapitalbildung die Gewinnmarge steigern. Dementsprechend Unternehmen, rational betrachtet, wechseln wollten. Für die Zeitarbeit besteht also ein Gefangenendilemma.
Die Europavorgaben durch die Richtlinie 2008/104/EG, die regulierend eingreifen, um diesem Gefangendilemma mit den Equal Pay- und Equal Treatment-Grundsätzen vorzubeugen und sich stark an der „flexicurity“-Forschung3 orientiert, hat strukturelle De- fizite. Diese sind einerseits das Verleihfirmen von den Equal Pay- und Equal Treatment- Grundsätzen abweichen dürfen wenn die Leiharbeitnehmer auch in einsatzfreien Zeiten bezahlt werden oder in Tarifverträgen Ausnahmen geregelt wurden. Für Soost ist dies ein klares Einfallstor für Lohndumping.4 Ebenso stellt es für ihn eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung dar und verstößt somit nicht nur für ihn sondern auch für Heu- schmid und Klauk gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in der EU-Grundrechte- Charta und ist deren Meinung nach damit primärrechtswidrig.5 Ebenso fehlt in der Richtlinie die klare Definition von „vorübergehend“.6 Dementsprechend kann sich ein Land einseitig einen Vorteil durch einen größeren Zeitraum der Definition des Begriffes vorübergehend verschaffen, da durch einen längeren Einsatz das Humankapital von Leiharbeitnehmern steigt und dementsprechend ein Vorteil für eine Unternehmensan- siedelung geschaffen ist.
[...]
1 Vgl. http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/an2011/ga11_ges.pdf, am
02.03.2013, S. 289 - 304.
2 Vgl. Schirm, Stefan, Globale Märkte, nationale Politik und regionale Kooperation in Europa und den Amerikas, 2. Aufl., Baden-Baden 2001, 64-66.
3 Vgl. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/21/en/1/ef0721en.pdf, am 02.03.2013
4 Vgl. Soost, Stefan, Leiharbeit: Prekariat auf Abruf, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 9/2012, S. 24f.
5 Vgl. Heuschmid, Johannes/ Klauk, Melanie, Zur Primärrechtswidrigkeit der Leiharbeitsrichtlinien, in „Soziales Recht“, 2/2012, S. 84 - 94.
6 Vgl. Zimmer, Reingard, Leiharbeit - aber nur vorübergehend, in: „Arbeit und Recht“, 3/2012, S. 89.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird eine Harmonisierung der Zeitarbeit auf EU-Ebene angestrebt?
Ziel ist es, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und Lohndumping sowie einen "Wettlauf nach unten" (Race-to-the-bottom) bei Sozialstandards zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern.
Was besagen die Prinzipien "Equal Pay" und "Equal Treatment"?
Diese Prinzipien fordern, dass Zeitarbeitnehmer für die gleiche Arbeit die gleiche Vergütung und die gleichen Arbeitsbedingungen erhalten wie festangestellte Mitarbeiter im Entleihbetrieb.
Was ist das Problem mit der Definition von "vorübergehend" in der EU-Richtlinie?
Die Richtlinie definiert nicht genau, was "vorübergehend" bedeutet. Dies lässt den Nationalstaaten Spielräume, die dazu führen können, dass Zeitarbeit als dauerhafter Ersatz für reguläre Stellen missbraucht wird.
Was versteht man unter dem "Gefangenendilemma" bei der Zeitarbeit?
Es beschreibt die Situation, in der einzelne Länder Anreize haben, ihre Standards zu senken, um Unternehmen anzulocken, was jedoch langfristig allen Ländern schadet, wenn sie diesem Beispiel folgen.
Welche Rolle spielt die "Flexicurity" in der Debatte?
Flexicurity ist ein Konzept, das Flexibilität für Arbeitgeber mit sozialer Sicherheit für Arbeitnehmer verbinden soll. In der Zeitarbeit wird oft kritisiert, dass die Flexibilität zulasten der Sicherheit geht.
- Citation du texte
- Felix Pratzner (Auteur), 2013, Zeitarbeit harmonisieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213841