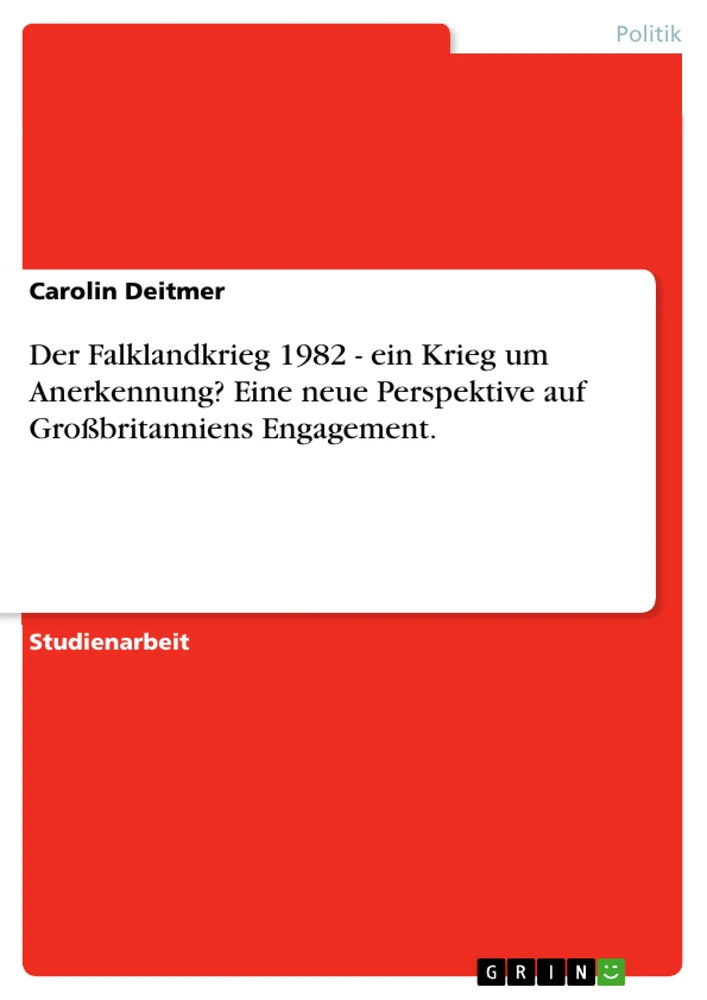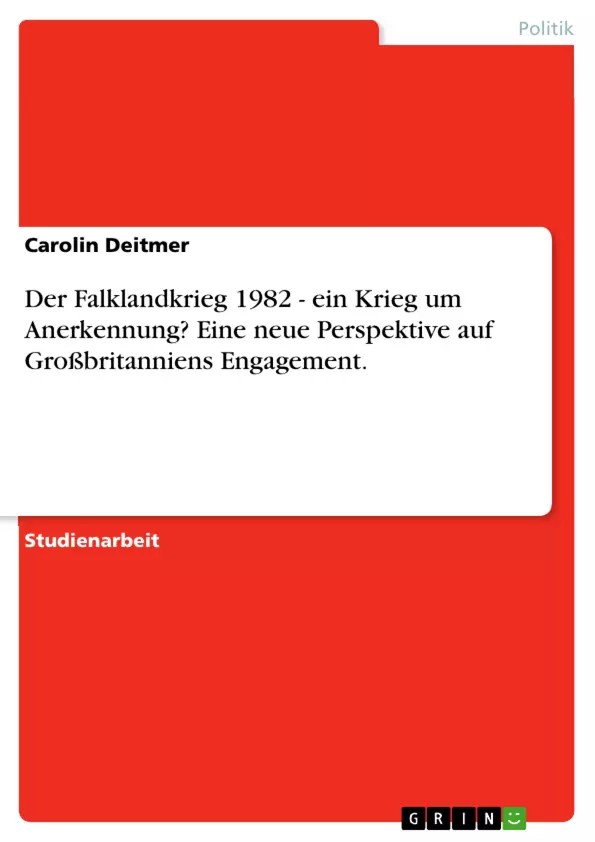Die folgende Arbeit versucht sich an einer Neuerklärung des britischen Engagements im Falklandkrieg 1982 auf Grundlage des Anerkennungstheorems von Thomas Lindemann:
Der Arbeit wird die These zu Grunde gelegt, dass Großbritannien die argentinische Invasion als Nichtanerkennung interpretiert hat und daher die Inselgruppe mit Waffengewalt zurückerobert hat. Jedoch fallen auch andere Motive ins Gewicht, die auf britisches Macht-interesse verweisen.
Diese These wird im Laufe der Arbeit plausibilisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Falkland 1982: Krieg einer ehemaligen Großmacht um Anerkennung in der Staatenwelt?
- Vorschub: Die Anerkennungstheorie als theoretischer Hintergrund
- Nichtanerkennung als Kriegsursache: Thomas Lindemanns theoretischer Ansatz
- Lindemanns Hauptargument und die Abgrenzung zu gängigen Kriegsursachentheorien.
- Die vier Hypothesen
- Hypothese 1: Krieg um Prestige
- Hypothese 2: Krieg aus Antipathie
- Hypothese 3: Krieg um die universelle Würde eines Staates
- Hypothese 4: Krieg um die partikulare Würde eines Staates
- Lindemann auf dem Prüfstand: Nichtanerkennung als kriegsauslösendes Moment im Falklandkrieg?
- Der Falklandkrieg: Grundlagen
- Prüfung der vier Hypothesen
- Hypothese 1: Krieg um Prestige
- Hypothese 2: Krieg aus Antipathie
- Hypothese 3: Krieg um die universelle Würde eines Staates
- Hypothese 4: Krieg um die partikulare Würde eines Staates
- Plausibilisierung der vier Hypothesen
- Fazit und kritische Abwägung: Nichtanerkennung oder doch Macht-/Profitstreben?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob das britische Engagement im Falklandkrieg 1982 als ein Kampf um Anerkennung in der Staatenwelt interpretiert werden kann. Dabei werden die Theorien der Anerkennung und ihre Relevanz im Kontext internationaler Konflikte beleuchtet.
- Die Anerkennungstheorie als theoretischer Hintergrund
- Die Rolle der Nichtanerkennung als Kriegsursache nach Thomas Lindemann
- Die Anwendung von Lindemanns Hypothesen auf den Falklandkrieg
- Die Bedeutung von Prestige, Würde und Selbstbild in der internationalen Politik
- Eine kritische Abwägung von Anerkennung und Macht-/Profitstreben im Falklandkrieg
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt den Falklandkrieg 1982 vor und skizziert die unterschiedlichen Interpretationen des britischen Engagements. Dabei werden insbesondere die Motive Großbritanniens beleuchtet und die gängigen Konfliktursachentheorien (Realismus, Liberalismus) eingeführt.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Anerkennungstheorie als theoretischen Rahmen für die Untersuchung des Falklandkriegs. Dabei wird die Relevanz der Anerkennung für Individuen und Staaten aufgezeigt und die theoretischen Ansätze von Axel Honneth, Niklas Luhmann und anderen Autoren vorgestellt.
- Das dritte Kapitel widmet sich dem theoretischen Ansatz von Thomas Lindemann, der Nichtanerkennung als Kriegsursache in den Mittelpunkt stellt. Lindemanns Hauptargument wird erläutert und die vier Hypothesen zur Erklärung von Kriegsentscheidungen aus Sicht der Nichtanerkennung dargestellt.
- Im vierten Kapitel wird Lindemanns Ansatz auf den Falklandkrieg angewandt. Dabei werden die vier Hypothesen auf die konkreten Gegebenheiten des Konflikts angewendet und auf ihre Plausibilität hin überprüft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Falklandkrieg, Anerkennungstheorie, Nichtanerkennung, Kriegsursachen, Thomas Lindemann, Prestige, Würde, Selbstbild, Machtpolitik, Großbritannien, Argentinien, internationale Politik.
Häufig gestellte Fragen
War der Falklandkrieg ein Kampf um Anerkennung?
Die Arbeit untersucht die These, dass Großbritannien die argentinische Invasion als Nichtanerkennung interpretierte und zur Wiederherstellung seines Prestiges und seiner Würde militärisch reagierte.
Was besagt Thomas Lindemanns Anerkennungstheorie?
Lindemann postuliert, dass Nichtanerkennung (z. B. Verletzung von Prestige oder Würde) eine zentrale Kriegsursache sein kann, die oft schwerer wiegt als rein materielle Interessen.
Welche vier Hypothesen werden im Kontext des Krieges geprüft?
Es wird geprüft, ob der Krieg aus Gründen des Prestiges, aus Antipathie, zur Verteidigung der universellen Würde oder der partikularen Würde eines Staates geführt wurde.
Spielten Macht- und Profitstreben im Falklandkrieg eine Rolle?
Ja, die Arbeit wägt kritisch ab, inwieweit neben dem Streben nach Anerkennung auch klassische machtpolitische Motive das britische Handeln beeinflussten.
Wie wird "Nichtanerkennung" als kriegsauslösendes Moment definiert?
Als Moment, in dem ein Staat sein Selbstbild durch die Handlungen eines anderen Staates so stark verletzt sieht, dass er eine gewaltsame Antwort zur Wiederherstellung seines Status für notwendig hält.
- Quote paper
- B.A. Carolin Deitmer (Author), 2012, Der Falklandkrieg 1982 - ein Krieg um Anerkennung? Eine neue Perspektive auf Großbritanniens Engagement., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214051