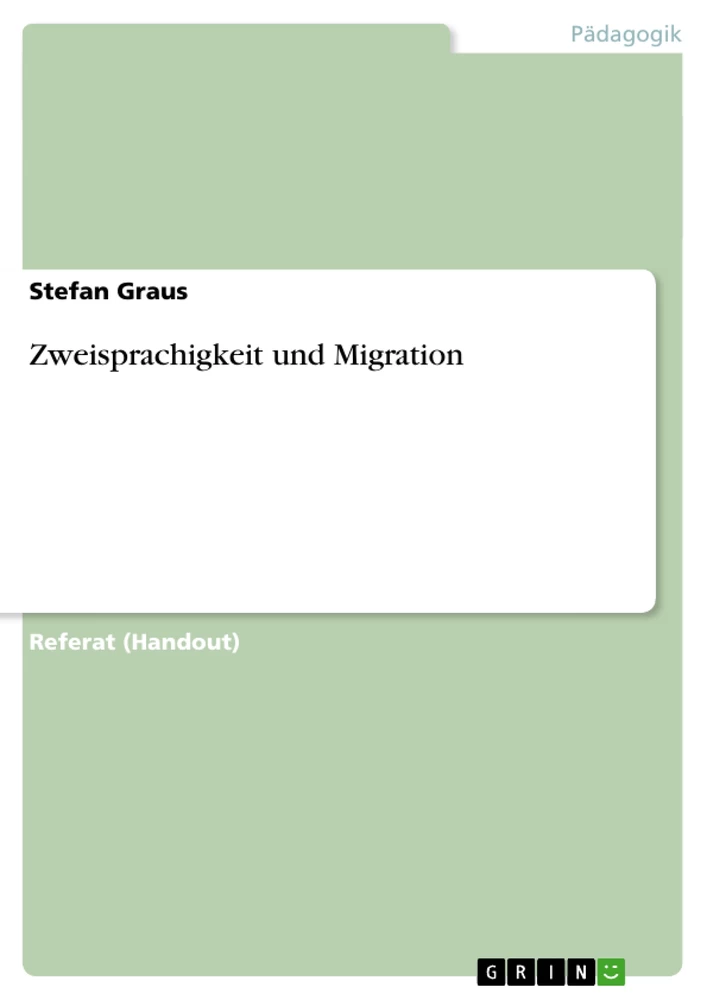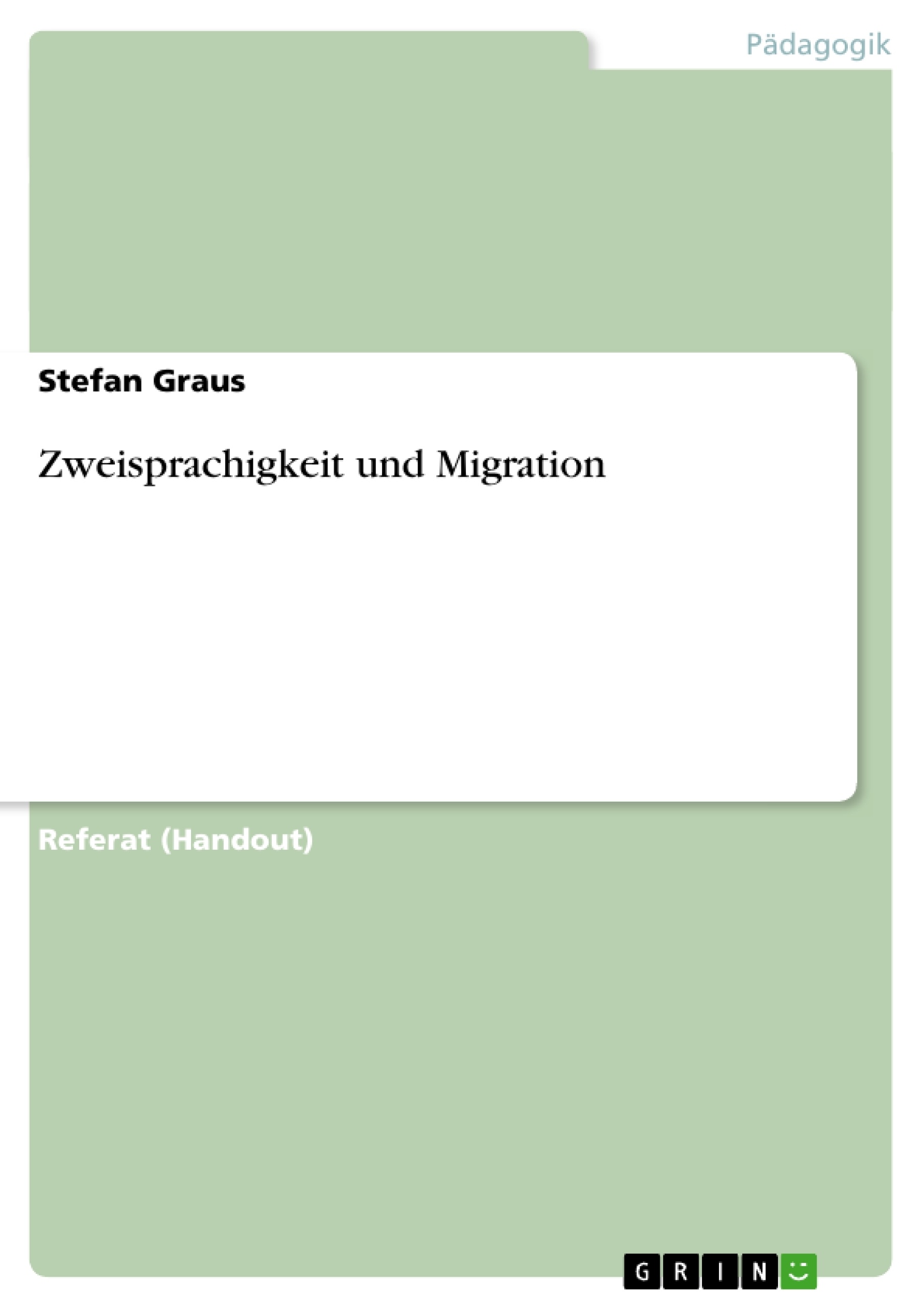Referatshandout zum aktuellen Forschungsstand des Zweitspracherwerbs von Kindern mit Migrationshintergrund auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitionen des Migrationshintergrundes und der Rolle der Muttersprache im gesamten Spracherwerb.
Besondere Berücksichtigung erfahren auch die Kinder der dritten Generation der Einwanderer, die heute im Schulalter sind.
Gliederung:
1. Begriffsbestimmungen
a. Juristische Grundlage
b. Pädagogische Grundlage
c. Kinder mit Migrationshintergrund – wer ist damit gemeint?
2. Rolle der Erstsprache
a. Interdependenztheorie
b. Sprachbarrierendiskussion
c. (Doppelseitige) Halbsprachigkeit (Semilingualismus)
3. „Es ist schwer nicht rassistisch zu sein“ - Interkulturelle Umgebung schaffen S.7
4. Konsequenzen für die Praxis
5. Literatur
a. Links zum Thema
1. Begriffsbestimmungen
In Bezug auf den Begriff des Migrationshintergrundes zeigt sich die Definition als recht schwierig, da viele einzelne Grundfaktoren eine Rolle spielen und Kategorisierungen sich als nur bedingt zutreffend erweisen.
a Juristische Grundlage
Die juristische Grundlage bildet die Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung MighEV.
„ Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn
1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder
2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte oder
3. der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1955 erfolgte.“[1]
Diese Grunddefinition liegt auch den entsprechenden Zahlen des Statistischen Bundesamtes zugrunde und wird für die meisten staatlichen Statistiken zugrunde gelegt.
Kinder der dritten und folgenden Generationen werden nur dann erfasst, wenn sie noch bei ihren Eltern im Haushalt leben, da diese Eltern noch definitorisch einen Migrationshintergrund haben können, wenn sie z.B. die deutsche Staatsangehörigkeit nicht angenommen haben. Diese Generation finden wir heute in der Schule. In den Angaben des Statistischen Bundesamtes findet sich dazu folgende Bemerkung:
„Vertreter der 3. Generation sind nach wissenschaftlichen Studien aus allen klassischen Einwanderungsländern integrationspolitisch besonders „schwierig“[2]
Im Gegensatz zur 1. Und 2. Generation fällt es Angehörigen der Dritten Generation besonders schwer ihre eigene Identität zu finden. Sie sind meist vollständig in Deutschland sozialisiert und kennen ihr „Heimatland“ nur aus Erzählungen oder dem Urlaub. Der Erwerb der Erstsprache ist häufig rudimentär und auf den Kontext in der eigenen Familie beschränkt.
Bei Besuchen im Herkunftsland werden sie als Deutsche wahrgenommen und sind auch oftmals kulturell fremd, in Deutschland sind sie aber weiterhin „Ausländer“ und werden entsprechend betitelt. Dies führt häufig zu einer starken Isolation und dem Bilden eigener Subkulturen mit gleich Betroffenen.
Für die pädagogische Arbeit ist diese Definition wenig tauglich, da sie die individuellen Lernvoraussetzungen nicht erfasst und eine große, sehr heterogene Gruppe beschreibt, die weder kulturell noch individuell vergleichbar ist und auch Personen mit dem gleichen familiären Hintergrund nach der Staatsangehörigkeit unterschiedlich betrachtet werden können.
b Pädagogische Grundlage
Aus diesem Grund wird oftmals im Zusammenhang mit der pädagogischen Arbeit der sprachliche Hintergrund als sinnvollere Alternative der Einschätzung herangezogen.
Hierbei hat sich eine Vielzahl von Begrifflichkeiten eingebürgert,
„Heimsprache, heritage language, Muttersprache, Erstsprache, Standardsprache, Staatssprache, community language, Eigensprache, Herkunftssprache, Bildungssprache, Minderheiten-/MigrantInnensprache, Schulsprache, Unterrichtssprache , Zweitsprache, Verkehrssprache, Familiensprache, Umgebungssprache, Fremdsprache, language(s) of education/schooling/school education[3] “
die bereits auf den ersten Blick die Komplexität des Themas zeigt.
Viele Untersuchungen gehen hierbei von einer Zuordnung in Erst-, Zweit und Fremdsprachen aus, die bedeutet:
Erstsprache (Muttersprache) ist die Sprache die im familiären Umfeld im Rahmen eines natürlichen Spracherwerbs erworben wird.
Zweitsprache ist die Sprache die im weiteren Umfeld (z.B. Schule, Kindergarten) erworben wird und meist mit der Umgebungssprache gleich zu setzen ist. Hierbei läuft der Erwerb in natürlichen und regelhaft gelenkten Bahnen ab. Die Unterrichtssprache kann aufgrund ihrer Struktur durchaus davon abweichen. (Deutsch als Unterrichtssprache ist weitgehend nicht mit dem gesprochenen Deutsch der Umgangssprache gleich zu setzen)
Fremdsprache ist jede Sprache die im regelhaft gelenkten Sprachunterricht im Laufe des Lebens erworben wird.
Im Rahmen des Deutscherwerbs wird bei Kindern mit Migrationshintergrund meist vom Zweitspracherwerb ausgegangen. Allerdings ist dieser Begriff durchaus nicht eindeutig besetzt.
Zweitsprachen können schon im Elternhaus in der frühen Kindheit erworben werden oder auch erst in Rahmen des Schulunterrichts (DaF) erlernt werden. Daher ist eine differenzierte Betrachtungsweise notwendig im Blick auf:
- Erwerbsalter
- Lernen (im Unterricht) oder Erwerben (ohne Unterricht)
- Ist es reine Schul- /Unterrichtssprache oder Verkehrssprache?
- Welche Herkunftssprache spricht das Kind
- Und in welchem Umfang beherrscht es diese?[4]
- Wie gut ist das Kind in die Umgebung integriert?
c Kinder mit Migrationshintergrund - wer ist damit gemeint?
Im Rahmen der Diskussion werden hier verschiedenste Personengruppen, mit vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen zusammengefasst.
Darunter fallen Kinder und Enkel der,
- Gastarbeiter der 60er und 70er Jahre
- Spätaussiedler, vor allem aus Osteuropa
- Flüchtlinge und AsylbewerberInnen
- MitbürgerInnen europäischer Länder,
- Multinationalen Ehen aber auch verstärkt
- jugendliche Flüchtlinge ohne Begleitung.
Genauso unterschiedlich wie die Gründe einer Einwanderung in Deutschland sind auch die Sprachvoraussetzungen der Kinder, auch wenn dies auf den ersten Blick kaum statistisch erkennbar ist.
Sie reicht von Kindern, die bei Beginn des Schulbesuchs die eigene Muttersprache nur unzureichend beherrschen und aus sprachlich und sozial schwierigen Verhältnissen stammen, bis zu Kindern, die 2 Muttersprachen in altersadäquater Form beherrschen und aus sprachlich wie sozial fördernden Elternhäusern stammen.
Die Bandbreite ist also in Kurzform dieselbe wie bei monolingual deutschsprachigen Kindern und wird nur um den Aspekt einer anderen/weiteren Muttersprache erweitert.
Daher ist es wichtig, neben der Freischaltung der fördernden Ressourcen, eine gute sprachliche Diagnostik (nicht zwangsläufig Deutschtests) zu Grunde zu legen. Dabei sollten die Fähigkeiten in der Erstsprache nach Möglichkeit mit erfasst werden. Dies kann meist nur in Zusammenarbeit mit den Eltern geschehen. Wichtig ist dabei diese als LernpartnerInnen zu gewinnen und die Diagnose in einer kompetenzorientierten Sichtweise zu gestalten. Defizitbeschreibungen schrecken eher ab und sind daher kontraproduktiv.
2. Rolle der Erstsprache
Die Erstsprache wird normalerweise durch den Umgang mit einem (mehreren) kompetenten Sprecher in der kindlichen Umgebung von Geburt an erworben. Meist ist dies die Muttersprache der Eltern.
Im Besonderen bei Kindern von Eltern mit Migrationshintergrund sind die Kenntnisse der Deutschen Sprache der Eltern nicht immer mit einem Muttersprachler gleich zu setzen. Daraus ergibt sich das Problem, dass Kinder, neben der kompetenten Muttersprache, Deutsch im direkten Umfeld nur unzureichend erwerben können. Die neuere Sprachforschung zeigt, dass es daher sinnvoll ist, dass die Eltern die Sprache sprechen, die sie gut beherrschen und gleichzeitig dem Kind
[...]
[1] Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung vom 29. September 2010 (BGBl. I S. 1372) §6
[2] Vgl Statistisches Bundesamt 2010 S. 5
[3] Vgl Boeckmann 2008 S. 21
[4] Vgl. Boeckmann 2008
Häufig gestellte Fragen
Wer gilt laut Gesetz als Person mit Migrationshintergrund?
Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn die Person keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, außerhalb Deutschlands geboren wurde (nach 1949) oder mindestens ein Elternteil zugewandert ist (nach 1955).
Welche Besonderheiten weist die dritte Generation der Einwanderer auf?
Diese Generation ist oft vollständig in Deutschland sozialisiert, erlebt aber häufig Identitätskonflikte, da sie im Herkunftsland als „deutsch“ und in Deutschland oft als „Ausländer“ wahrgenommen wird.
Was ist der Unterschied zwischen Erstsprache und Zweitsprache?
Die Erstsprache (Muttersprache) wird im familiären Umfeld natürlich erworben. Die Zweitsprache wird im weiteren Umfeld (Schule/Kindergarten) gelernt und dient meist als Umgebungssprache.
Was besagt die Interdependenztheorie im Spracherwerb?
Die Theorie geht davon aus, dass die Kompetenzen in der Erstsprache eine wesentliche Grundlage für den erfolgreichen Erwerb der Zweitsprache bilden.
Warum ist eine kompetenzorientierte Diagnostik wichtig?
Anstatt nur Defizite im Deutschen festzustellen, sollten Lehrer die vorhandenen Fähigkeiten in der Erstsprache als Ressource begreifen und die Eltern als Lernpartner einbinden.
- Citar trabajo
- Stefan Graus (Autor), 2013, Zweisprachigkeit und Migration, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214072