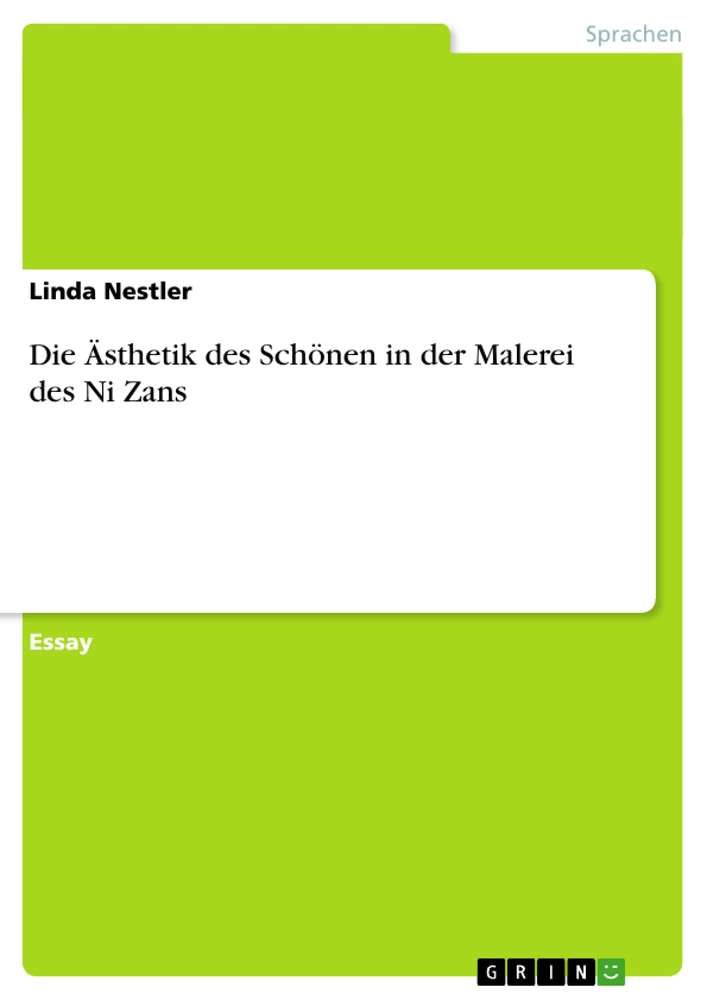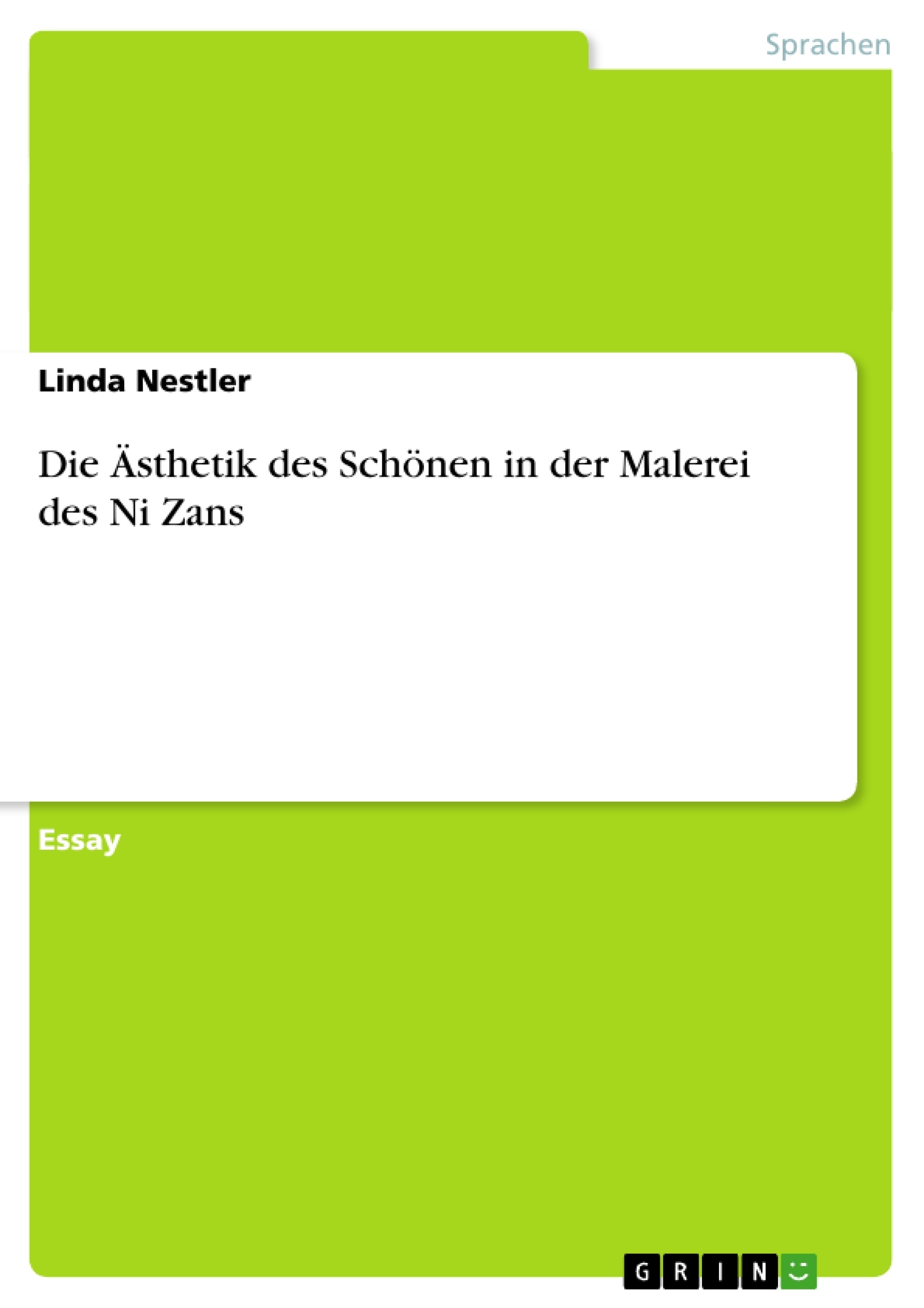Der Schmetterlingstraum des daoistischen Meisters Zhuangzi (Dschuang Dschou) erzählt uns von einer Fanatsie, in der Zhuangzi zu einem Schmetterling verwandelt sein Leben genießt und fröhlich hin- und herflattert. Doch als er aufwacht, fragt er sich, ob er wirklich Zhuangzi selbst ist oder ein Schmetterling, der träumt Zhuangzi zu sein. Diese Verwandlung bezeichnet er als die Wandlung der Dinge, kurzum, wie Wangheng es beschreibt, die Einheit von Mensch und Natur (tian ren he yi) In Anbetracht der Betonung der Schönheit der Natur und des tianren heyi-Prinzips als einem signifikanten Teil der „kulturell-psychischen Struktur“ chinesischer Philosophie, scheint eine Untersuchung verschiedener Faktoren, welche die Landschaftsmalerei des Ni Zan beschreiben, gerechtfertigt. Zum Begriff der Schönheit beziehe ich mich hauptsächlich auf Arbeiten chinesischer Autoren, um deren chinesische Sicht auf verschiedene Schönheitskonzepte aufzugreifen. Es wird versucht, deren Konzepte auf Stimmungen in Ni Zans Malerei, wie Leere und Räumlichkeit sowie Techniken, wie Pinselstrich und Komposition zu übertragen. Abschließend werde ich mich unter Rekurs auf das vorher Genannte, zum Begriff der Harmonie in der chinesischen Vorstellung äußern.
„Einst traumte Dschuang Dschou, daE er ein Schmetterling sei, ein flatternder Schmetterling, der sich wohl und glucklich fuhlte und nichts wuEte von Dschuang Dschou. Plotzlich wacht er auf: da war er wieder wirklich und wahrhaftig Dschuang Dschou. Nun weiE ich nicht, ob Dschuang Dschou getraumt hat, daE er ein Schmetterling sei, oder ob der Schmetterling getraumt hat, daE er Dschuang Dschou sei, obwohl doch zwischen Dschuang Dschou und dem Schmetterling sicher ein Unterschied ist. So ist es mit der Wandlung derDinge“ (Richard 1912: 52f.).
Der Schmetterlingstraum des daoistischen Meisters Zhuangzi (Dschuang Dschou) erzahlt uns von einer Fanatsie, in der Zhuangzi zu einem Schmetterling verwandelt sein Leben genieEt und frohlich hin- und herflattert. Doch als er aufwacht, fragt er sich, ob er wirklich Zhuangzi selbst ist oder ein Schmetterling, der traumt Zhuangzi zu sein. Diese Verwandlung bezeichnet er als die Wandlung der Dinge, kurzum, wie Wangheng es beschreibt, die Einheit von Mensch und Natur (tian ren he yi) (Chen 1995: 324).
Li Zehou zu Folge spiegelt sich diese Einheit von Natur und Mensch vor allem in der Kunst auf mannigfaltiger Art und Weise wider (Li 1992: 14f.). Malereien chinesischer Kunstler haben haufiger als im Westen naturliche Objekte, wie Bambus, Orchideen oder Kraniche zum Thema. Im Falle Ni Zans (1301-1374), dem laut Renee Violet eigenwilligsten der Vier Meister der Yuan- Malerei, dominieren weitlaufige Landschaften seine Malereien.
Ganz im Gegensatz zu unseren westlichen Gemalden, die seit dem Mittelalter stark von Religion beeinflusst wurden, haben chinesische Malereien diese religiose Pragung nicht. Dies ist allerdings nur insofern der Fall, als dass man Daoismus und Buddhismus nicht im Sinne klassischer Religionen der Aufopferung und des starken Glaubens an eine ubernaturliche Kraft versteht.Die daoistische Naturphilosphie des Zhuangzi sieht nichts uber sich stehen, auEer den Himmel beziehungsweise die Natur (tian). Die Basis des Daoismus ist es, Eins mit der Natur zu werden, sowie Inspiration und Erleuchtung in ihr zu suchen. Die Natur besitzt laut Li Zehou einen hoheren Stellenwert fur den Daoisten als die vergangliche Welt mit ihrem Luxus (Li 1992: 314). Somit ist auch das, was im Daosimus als schon bezeichnet wird - das Freie, Spontane und Naturliche - weitab der Zivilisation.
Nun stellt sich die Frage, wie der Begriff schon eigentlich definiert wird. Li Zehou antwortet darauf, indem er meint, dass das Schone nicht gewohnliche Formschonheit sei, sondern eine Form in der sich bedeutungsvolle gesellschaftliche Inhalte abgelagert haben. Diese Ablagerung versteht er als kulturspezifische Gestaltwerdung von gesellschaftlichem und geschichtlichem Inhalt, welche als „kulturell-psychische Struktur“ wenhuaxinli jiegou bezeichnet wird (Li 1992: 71). Seiner Meinung nach ist ein Teil dieser Struktur der kulturellen Gestaltwerdung Chinas ist der Daoimus Zhuangzis und der Ubergang dessen in den Chan Buddhismus, welche beide ein Leben in Einklang mit der Natur als hochstes Ideal anstreben.
In Anbetracht der Betonung der Schonheit der Natur und des tianren heyi-Prinzips als einem signifikanten Teil der „kulturell-psychischen Struktur“ chinesischer Philosophie, scheint eine Untersuchung verschiedener Faktoren, welche die Landschaftsmalerei des Ni Zan beschreiben, gerechtfertigt. Zum Begriff der Schonheit beziehe ich mich hauptsachlich auf Arbeiten chinesischer Autoren, um deren chinesische Sicht auf verschiedene Schonheitskonzepte aufzugreifen. Es wird versucht, deren Konzepte auf Stimmungen in Ni Zans Malerei, wie Leere und Raumlichkeit sowie Techniken, wie Pinselstrich und Komposition zu ubertragen. AbschlieEend werde ich mich unter Rekurs auf das vorher Genannte, zum Begriff der Harmonie in der chinesischen Vorstellung auEern.
Die Einheit von Mensch und Natur - Stimmungen in Ni Zans Malerei
Das Prinzip der Leere - um nicht nur den rein technischen Begriff Farblosigkeit zu verwenden - zahlt meiner Ansicht nach zu den wichtigsten Begriffen, die Ni Zans Landschaften charakterisieren. Abbildung 1 zeigt nur einige zierliche Baume, sparliche Vegetation und auch „Felsen deuten nur Konturen des Uferstrichs an, auf die Leere des Wassers, was die mittlere Bildpartie ausfullt antwortet die grundlose Klarheit des Himmels, ein Dach aus Stroh ist der einzige Hinweis auf mogliche menschliche Gegenwart“, so Jullien (1999: 24). Fur ihn ist Leere ein Ausdruck von Fadheit. Dabei darf man jedoch Fadheit nicht pauschal negativ konnotieren. Ganz im Gegenteil: das Fade in der Landschaft sieht Jullien als den Ausdruck von Weisheit sowie als ein Ideal und nicht als kunstlerischen Effekt. Nichts soll darauf abzielen, den Blick festzuhalten oder Aufmerksamkeit zu erzeugen, denn jeder augenblickliche Reiz sei verfuhrerisch und trugerisch. Im Gegensatz zu oberhalb, die sich ebenfalls in einen solchen Raum verlieren. Diese groEen, farblosen, freien Flachen spiegeln neben der Fadheit des dao, wie es Jullien sieht, das dao selbst wider. Es ist unsichtbar und durchdringt alles. Es umfangt uns, wir konnen es aber nicht mit unseren normalen Sinnen wahrnehmen, sondern nur mit dem Sinn unseres Geistes jingshen. Diese Beobachtung lasst sich anhand der Schonheitstheorie Chun Ying-Chengs erlautern. Seiner Ansicht nach befindet sich die wahre Schonheit und Vollkommenheit weder im Objekt noch im Subjekt, sondern in der naturlichen Reiz-Reaktions-Beziehung und im kreativen Prozess der Wechselwirkungen zwischen Subjekt und Objekt. Deshalb kann man sagen, dass Schonheit ein kreativer Prozess ist, der zwischen dem Subjekt und dem Objekt stattfindet. Dies passiert, sobald das Subjekt seinen Geist und sein Herz offnet und auch das Objekt (zum Beispiel die Natur, Malereien) sich selbst offnet um wahrgenommen zu werden. Dies geschieht aber nur, wenn sich beide - Subjekt und Objekt - in Harmonie befinden. Schonheit kann daher auch als eine kreative Einheit und dynamische Harmonie zwischen Subjekt und Objekt verstanden werden (Chung 2006: 70). Da das dao selbst nicht sichtbar ist, muss es sich daher dem Betrachter des Bildes offnen, indem es ihn in den Leerstellen des Gemaldes umflieEt. Der Betrachter, das Subjekt, offnet dafur seinen Geist jingshen und geht eine kreative Einheit mit dem dao des Bildes ein. Sobald eine dynamische Harmonie zwischen beiden entsteht, findet das Ereignis Schonheit statt.
Neben der Leere spielt auch die Perspektivlosigkeit der Malerei eine herausragende Rolle in China. Dieses Merkmal ist daher nicht nur in den Gemalden Ni Zans zu finden, sondern in den meisten Arbeiten traditioneller chinesischer Kunstler. Trotzdem will ich am Beispiel Ni Zans etwas naher darauf eingehen. Das Fehlen von raumlichen Perspektiven in chinesischen Gemalden durfte wohl jedem, der damit vertraut wurde, bereits einmal aufgefallen sein. Westlichen Gemalden verleiht der Sinn des Kunstlers fur die realistisch genaue Abbildung des Motivs ihre Schonheit. Fur chinesische Kunstler dagegen ist diese Art Malerei ein Handwerk, welches nicht mit Kunst verwechselt werden darf. Tsung Paihwa zitiert dazu Shen Kuo, welcher der Auffassung ist, dass der Maler eine komplette Szenerie durch sein Herz in ein ganzes Bild beziehungsweise eine ganze Totalitat integrieren sollte und nicht nur aus einem Blickwinkel, wie zum Beispiel unter einer Pagode hervor. Dennoch sollte das Gemalde keine Fotokopie der Landschaft werden, sondern die komplette, zu sehende Szenerie in einem lebendigen, rhythmischen und harmonischen Kunstwerk vereinen (Tsung 1995: 33).
Ni Zan selbst soll einst gesagt haben: ,,Was ich Malen nenne, ist nichts anderes als sorgloses Skizzieren mit dem Pinsel. Ich suche nicht die formale Ahnlichkeit, sondern begnuge mich mit der reinen Freude am Tun“ (Li 1992: 334).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wer war Ni Zan?
Ni Zan (1301–1374) war einer der „Vier Meister der Yuan-Dynastie“ und berühmt für seine minimalistischen chinesischen Landschaftsmalereien.
Was bedeutet das Prinzip „tian ren he yi“?
Es beschreibt die „Einheit von Mensch und Natur“, ein zentrales Konzept der chinesischen Philosophie, das sich stark in der Kunst widerspiegelt.
Welche Rolle spielt die „Leere“ in Ni Zans Bildern?
Die Leere (unbemalte Flächen) ist kein Mangel, sondern ein Ausdruck von Ruhe, Weisheit und dem Wirken des Dao, das alles durchdringt.
Warum fehlen in Ni Zans Landschaften oft Menschen?
Das Fehlen von Menschen betont die Erhabenheit der Natur und den Rückzug des Künstlers aus der korrupten Gesellschaft in die Einsamkeit.
Wie unterscheidet sich die Perspektive von westlicher Kunst?
Statt einer mathematischen Zentralperspektive nutzt Ni Zan eine „fließende“ Perspektive, die den rhythmischen Einklang des Herzens mit der Szenerie darstellt.
- Citar trabajo
- Linda Nestler (Autor), 2011, Die Ästhetik des Schönen in der Malerei des Ni Zans, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214202