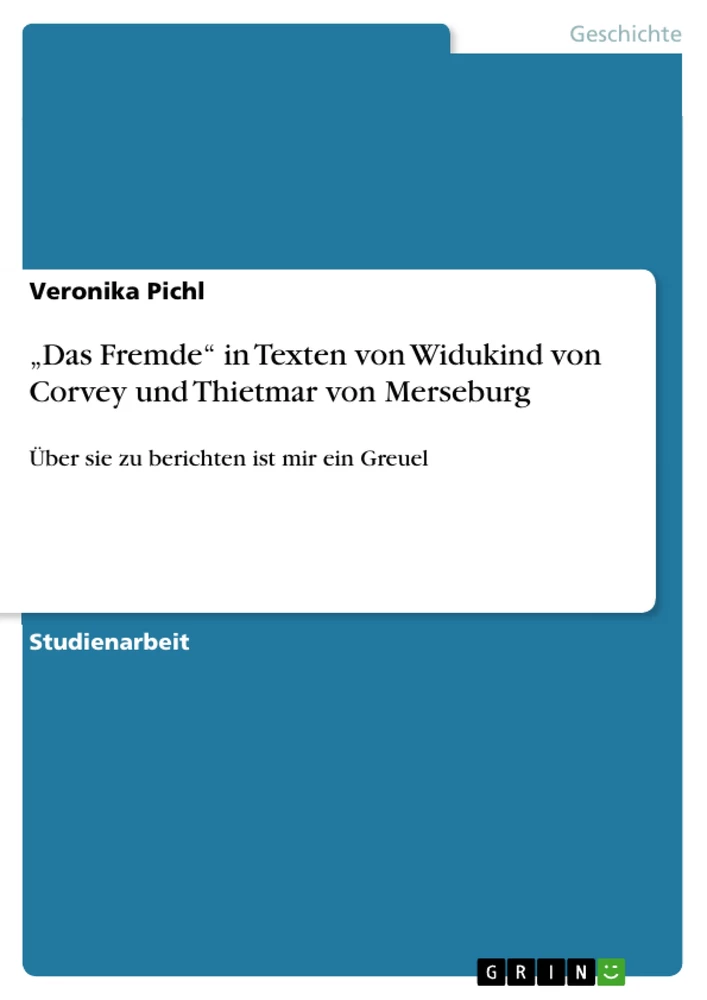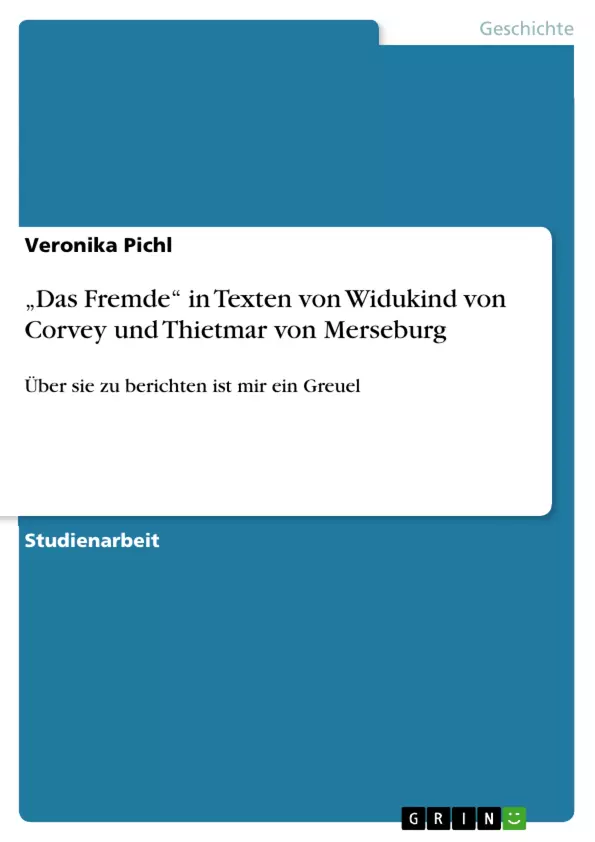1. Einleitung
Wirtschaftliche, kriegerische und persönliche Umstände des Mittelalters erforderten in Europa eine hohe Mobilität des Einzelnen und Angehöriger ganzer Stammesverbände. Archäologische Funde dokumentieren diese Entwicklungen und verdeutlichen den Grad der Akkulturation sowie das Zurückdrängen der eigenen Identität und der Bildung einer neuen gemeinsamen Kultur. Die Vermischung zweier Kulturkreise, nämlich die der christlich-vormals römischen Kultur und der heidnischen Welt östlich und nördlich der Reichsgrenzen, stellte die Basis für die gesellschaftlich-politischen Entwicklungen dar.
Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen stellt Fremdheit daher keine konstante Größe dar und kann immer nur relational gedacht werden. Die Analyse des Fremden steht folge dessen im Bezug zum Begriff des Eigenen. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Fremden und Eigenem.Gründungsmythen galten als unverzichtbarer Bestandteil, der zur Abgrenzung von „Anderen“ herangezogen wurde.
Inhalt:
1. Einleitung
2. Geschichtlicher Überblick: Die Auseinandersetzungen des sächsischen Herrscherhauses mit den Völkern in Osten und Norden
3. Widukind von Corvey
3.1. Res gestae Saxonicae
4. Thietmar von Merseburg
4.1. Die Chronik des Thietmar von Merseburg
5. Die Institutionalisierung des „Fremden“
Häufig gestellte Fragen
Wie wird "Fremdheit" im mittelalterlichen Kontext definiert?
Fremdheit wird als relationale Größe verstanden, die immer im Bezug zum Begriff des "Eigenen" steht und durch soziale, religiöse oder geografische Abgrenzung entsteht.
Welche Rolle spielten Widukind von Corvey und Thietmar von Merseburg?
Beide waren bedeutende Chronisten des Mittelalters, deren Texte wichtige Einblicke in die Wahrnehmung fremder Völker und die Identitätsbildung der Sachsen geben.
Was bedeutet Akkulturation im Mittelalter?
Es beschreibt den Prozess der Vermischung und gegenseitigen Beeinflussung verschiedener Kulturkreise, wie etwa der christlich-römischen und der heidnischen Welt.
Warum waren Gründungsmythen für mittelalterliche Stämme wichtig?
Gründungsmythen dienten als unverzichtbares Instrument zur Abgrenzung von anderen Gruppen und zur Stärkung der eigenen kollektiven Identität.
Welche Faktoren erforderten im Mittelalter eine hohe Mobilität?
Wirtschaftliche Notwendigkeiten, kriegerische Auseinandersetzungen und persönliche Umstände zwangen sowohl Einzelne als auch ganze Stammesverbände zur Migration.
- Quote paper
- Veronika Pichl (Author), 2010, „Das Fremde“ in Texten von Widukind von Corvey und Thietmar von Merseburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214358