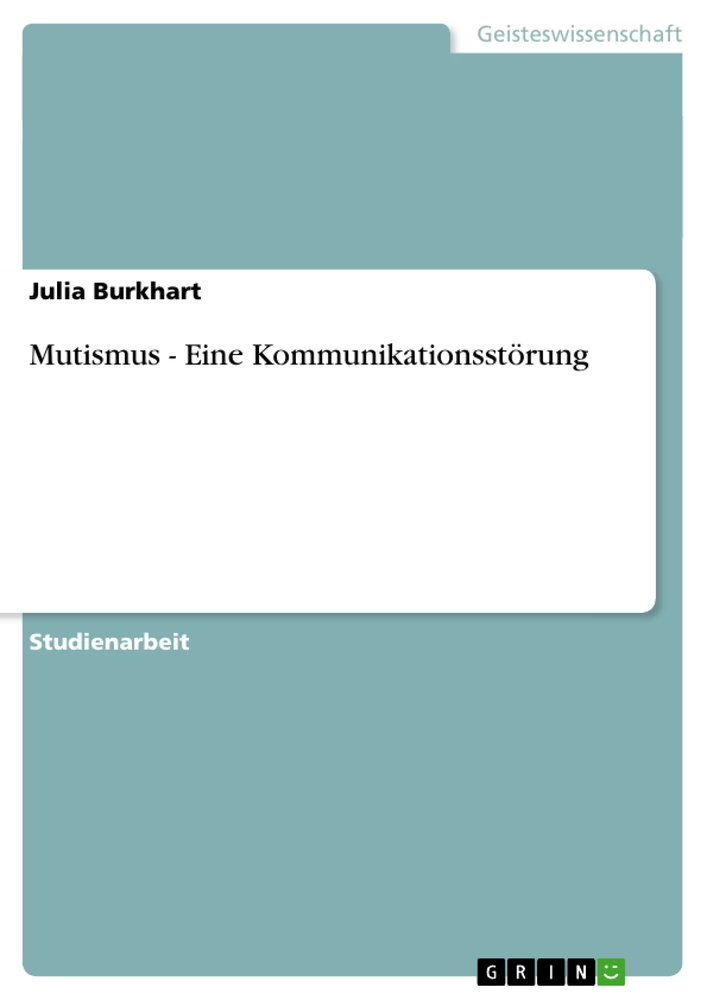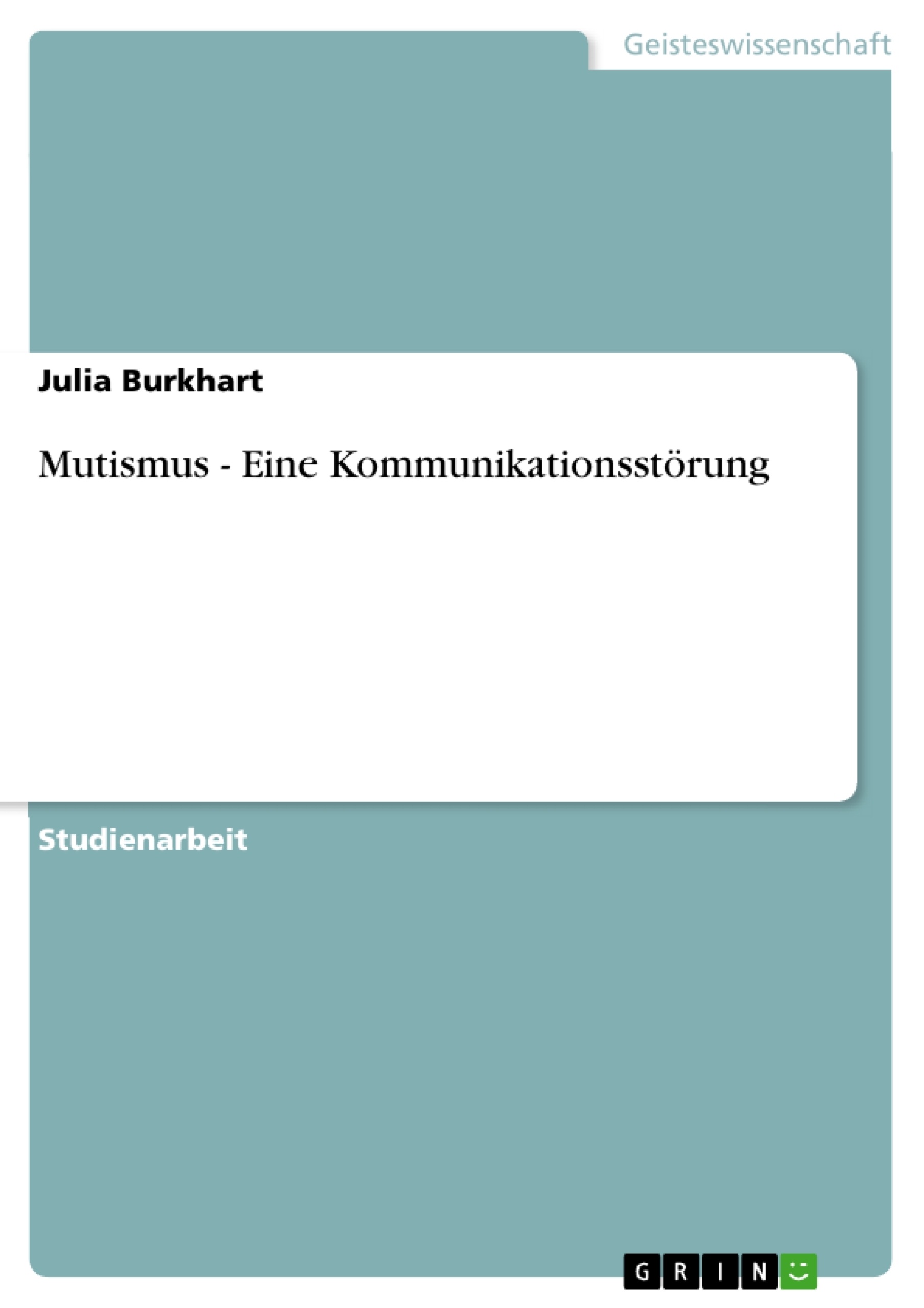"Man kann nicht nicht kommunizieren" (Watzlawick u. a. 1990, S.53). Dieses metakommunikative Axiom Watzlawicks gilt als grundlegend im Thema Kommunikation.
Laut Watzlawick u. a. hat alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situation Mitteilungscharakter und ist daher als Kommunikation zu verstehen. Da Verhalten kein Gegenteil hat, man sich also nicht nicht verhalten kann, folgt daraus, dass man auch nicht nicht kommunizieren kann (vgl. a.a.O., S.51).
Die menschliche Kommunikation ist das Medium der Manifestation menschlicher Beziehungen (vgl. a.a.O., S. 22). Eine gestörte Kommunikation kann also weitreichende Folgen für die Beziehung der Interaktionspartner haben.
Unter Mutismus wird das situative oder vollständige Nichtsprechen von Menschen verstanden, die über eine weitgehend abgeschlossene Sprachentwicklung sowie Funktion der Sprachwerkzeuge verfügen, also aus physiologischer Sicht sprechen könnten.
Versucht ein unter Mutismus leidender Mensch, nicht zu kommunizieren?
Bahr plädiert dafür, Mutismus als Kommunikationsstörung zu verstehen, da das dauerhafte Schweigen nicht allein das Kind betrifft, sondern nur durch seine Wechselwirkungen im interpersonellen Geschehen hinreichend verstanden werden kann (vgl. Bahr 1996, S. 2).
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern es sich bei Mutismus um eine Kommunikationsstörung handelt. Im 2. Kapitel werden die Grundzüge dieses Phänomens beschrieben. In Kapitel 3 wird aufgezeigt, warum Mutismus als Kommunikationsstörung verstanden werden kann, und welche Auswirkungen der Mutismus auf die Interaktion mit Anderen hat. Schließlich wird im 4. Kapitel dargestellt wie der Umgang mit mutistischen Kindern in der pädagogischen Praxis gestaltet werden kann.
Da das Phänomen Mutismus vor allem im Kindesalter auftritt und die pädagogische Fachkraft vor allem in Einrichtungen der Kindheitspädagogik damit in Kontakt kommen werden, legt die vorliegende Arbeit den Fokus größtenteils auf diesen Bereich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundzüge des Mutismus
- Entstehung des Begriffs
- Symptomatik
- Ursachen
- Mutismus als Kommunikationsstörung
- Grundlegende kommunikationstheoretische Aspekte
- Störung der Sprachentwicklung
- Störung der Entwicklung einer sprachlichen Identität
- Störungen auf der Beziehungsebene
- Umgang mit mutistischen Kindern in der pädagogischen Praxis
- Die pädagogische Grundhaltung
- Ansatzpunkte für den Aufbau einer Kommunikation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Mutismus als Kommunikationsstörung. Ziel ist es, die Grundzüge des Mutismus zu beschreiben, seine Interpretation als Kommunikationsstörung zu belegen und den Umgang mit mutistischen Kindern in der pädagogischen Praxis zu beleuchten.
- Definition und Entstehung des Begriffs Mutismus
- Symptome und Erscheinungsformen des selektiven und totalen Mutismus
- Mögliche Ursachen und Einflussfaktoren auf die Entstehung von Mutismus
- Mutismus als Beeinträchtigung der Kommunikation auf verschiedenen Ebenen
- Pädagogische Ansätze im Umgang mit mutistischen Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Mutismus ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Interpretation des Mutismus als Kommunikationsstörung. Sie verweist auf das Watzlawicksche Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren“ und betont die weitreichenden Folgen gestörter Kommunikation für zwischenmenschliche Beziehungen. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und fokussiert auf den Bereich der Kindheitspädagogik.
Die Grundzüge des Mutismus: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über den Mutismus. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs, von „aphrasia voluntaria“ bis zur Unterscheidung zwischen selektivem und totalem Mutismus. Die Symptomatik wird detailliert beschrieben, wobei zwischen dem wiederkehrenden Schweigen in spezifischen Situationen (selektiver Mutismus) und dem omnipräsenten Schweigen (totaler Mutismus) unterschieden wird. Es werden zudem mögliche Begleiterscheinungen und die Schwierigkeit, eindeutige Ursachen zu identifizieren, herausgestellt.
Mutismus als Kommunikationsstörung: Dieses Kapitel argumentiert für die Interpretation des Mutismus als Kommunikationsstörung. Es werden kommunikationstheoretische Aspekte beleuchtet und die Auswirkungen des Mutismus auf die sprachliche Entwicklung, die Entwicklung einer sprachlichen Identität und die Beziehungsebene diskutiert. Der Fokus liegt auf den komplexen Interaktionen und den Herausforderungen, die sich aus dem Schweigen für die betroffenen Kinder und ihr Umfeld ergeben.
Umgang mit mutistischen Kindern in der pädagogischen Praxis: Dieses Kapitel befasst sich mit dem praktischen Umgang mit mutistischen Kindern im pädagogischen Kontext. Es betont die Bedeutung einer positiven und unterstützenden Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte. Konkrete Ansatzpunkte für den Aufbau einer Kommunikation werden diskutiert, wobei die individuelle Situation des Kindes im Mittelpunkt steht. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der die Bedürfnisse des Kindes und seines Umfelds berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Mutismus, Kommunikationsstörung, Selektiver Mutismus, Totaler Mutismus, Sprachentwicklung, Kommunikationstheorie, Pädagogische Praxis, Kindheitspädagogik, Resilienz, Vulnerabilität, Stressfaktoren, Beziehungsebene.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mutismus als Kommunikationsstörung
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über Mutismus als Kommunikationsstörung. Er behandelt die Definition und Entstehung des Begriffs, die Symptomatik (selektiver und totaler Mutismus), mögliche Ursachen, die Auswirkungen auf die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen (sprachliche Entwicklung, Identität, Beziehungen) und pädagogische Ansätze im Umgang mit mutistischen Kindern.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Die Grundzüge des Mutismus, Mutismus als Kommunikationsstörung, Umgang mit mutistischen Kindern in der pädagogischen Praxis und Fazit (implizit durch Zusammenfassung). Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
Was sind die Hauptziele des Textes?
Der Text zielt darauf ab, Mutismus als Kommunikationsstörung zu beschreiben, seine Interpretation als solche zu belegen und den Umgang mit mutistischen Kindern in der pädagogischen Praxis zu beleuchten. Es werden die Grundzüge des Mutismus erläutert und verschiedene Aspekte der Störung aus kommunikationstheoretischer und pädagogischer Perspektive betrachtet.
Welche Arten von Mutismus werden unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen selektivem Mutismus (wiederkehrendes Schweigen in spezifischen Situationen) und totalem Mutismus (omnipräsentes Schweigen).
Welche Ursachen für Mutismus werden genannt?
Der Text erwähnt die Schwierigkeit, eindeutige Ursachen für Mutismus zu identifizieren. Es werden aber mögliche Begleiterscheinungen und Einflussfaktoren angedeutet, ohne konkrete Ursachen zu benennen.
Wie wird Mutismus in diesem Text als Kommunikationsstörung interpretiert?
Der Text argumentiert, dass Mutismus die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen beeinträchtigt: die sprachliche Entwicklung, die Entwicklung einer sprachlichen Identität und die Beziehungsebene. Das Watzlawicksche Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren“ wird als Grundlage der Argumentation verwendet.
Welche pädagogischen Ansätze werden im Umgang mit mutistischen Kindern vorgeschlagen?
Der Text betont die Bedeutung einer positiven und unterstützenden Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte. Es werden konkrete Ansatzpunkte für den Aufbau einer Kommunikation diskutiert, die sich auf die individuelle Situation des Kindes konzentrieren und einen ganzheitlichen Ansatz fordern, der die Bedürfnisse des Kindes und seines Umfelds berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Mutismus, Kommunikationsstörung, Selektiver Mutismus, Totaler Mutismus, Sprachentwicklung, Kommunikationstheorie, Pädagogische Praxis, Kindheitspädagogik, Resilienz, Vulnerabilität und Stressfaktoren.
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema Mutismus?
Der Text selbst verweist nicht auf weiterführende Literatur oder Ressourcen. Für zusätzliche Informationen sollte man wissenschaftliche Literatur zum Thema Mutismus und Kommunikationsstörungen konsultieren.
- Citar trabajo
- Julia Burkhart (Autor), 2010, Mutismus - Eine Kommunikationsstörung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214390