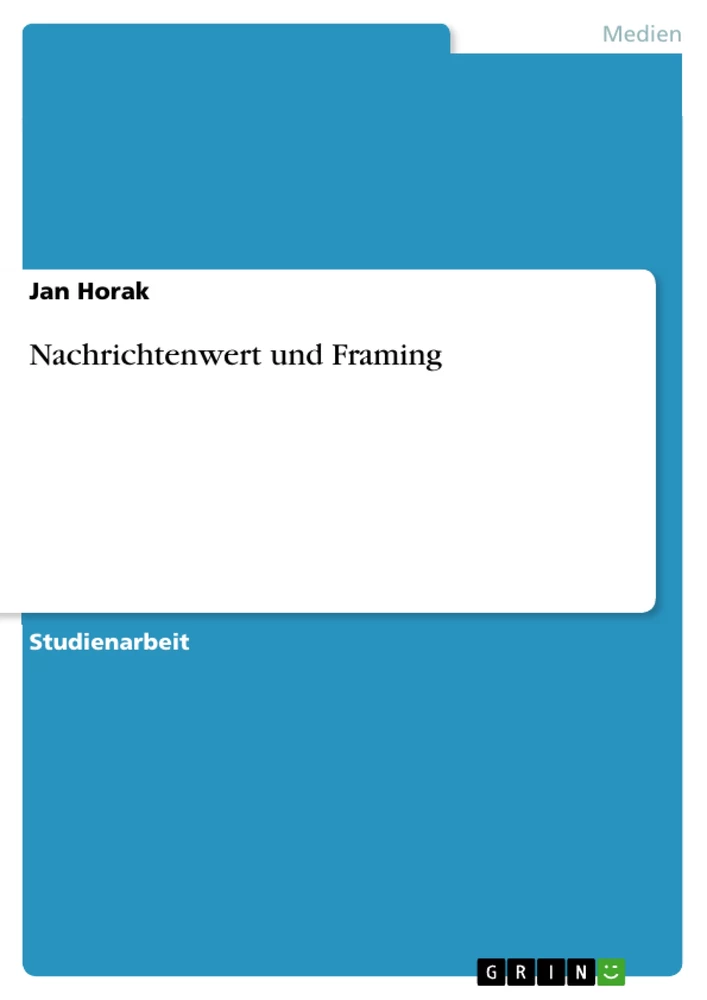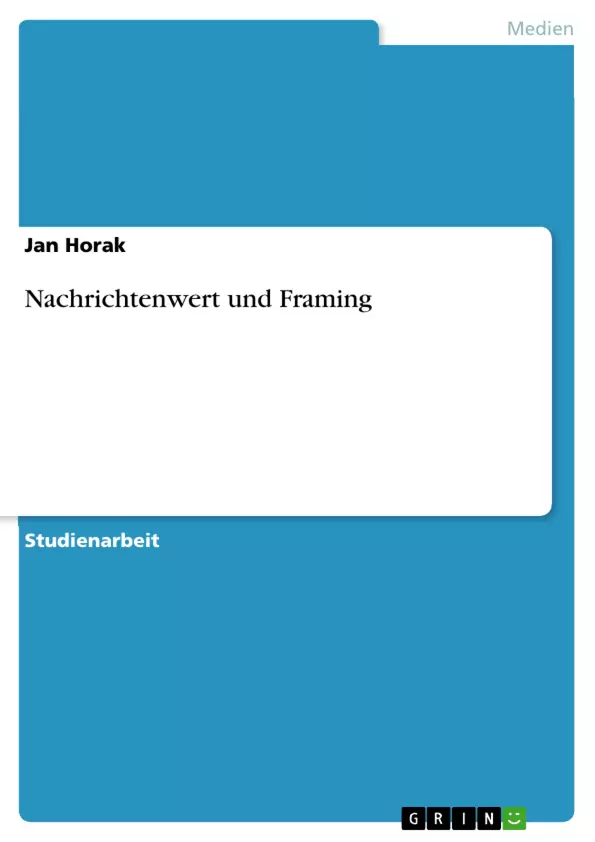Eines der meistzitierten, aber auch in hohem Maße kritisch hinterfragten Theoriegebäude der Journalismusforschung ist die Nachrichtenwerttheorie. Im Kern besagt diese, dass sich der Nachrichtenwert eines Ereignisses anhand bestimmter Nachrichtenfaktoren bemessen lässt. In der zeitgenössischen Framing-Forschung existiert mit dem ‚Generic Framing‘ ein Konzept, dessen empirische Ausprägungen stark an die aus der Nachrichtenwerttheorie bekannten Nachrichtenfaktoren erinnern. Bei ‚generischen Frames‘ handelt es sich um wiederkehrende Muster in der journalistischen Berichterstattung, welche nachweislich unabhängig von Ereignis- und Beitragstyp aufzufinden sind.
Zwar sind Nachrichtenwerttheorie und ‚Generic Framing‘-Konzept auf gänzlich verschiedenen Analyseebenen zu verorten – erstgenanntes bezieht sich auf die journalistische Nachrichtenselektion und zweites auf den Darstellungsmodus auf Textebene. Dennoch rekurrieren beide Konzepte auf zwei aufeinander aufbauende journalistische Auswahlprozesse, die schwerlich ohneeinander zu denken sind: Was wird warum ausgewählt? Und wie wird es anschließend aufbe-reitet? So stellt sich aufgrund dieser Folgelogik und der auffallenden Ähnlichkeit von Nachrichtenfaktoren und generischen Frames an dieser Stelle die Frage, ob es sich bei letztgenannten möglicherweise um die textuelle Umsetzung von Nachrichtenwert in journalistische Beiträge handelt. Und zudem, ob der Nachrichtenwert eines Ereignisses möglicherweise grundsätzlich dessen Framing in der Berichterstattung determiniert.
Im Rahmen dieser Arbeit soll auf der Basis der einschlägigen Theorieliteratur diskutiert werden, ob, warum (bzw. warum nicht) und inwiefern das Konzept des ‚Generic Framing‘ möglicherweise als Weiterführung der Nachrichtenwert-theorie auf der Ebene konkreter journalistischer Inhalte zu sehen ist. Es soll die Anschlussfähigkeit des ‚Generic Framing‘-Konzepts an die Erkenntnisse der Nachrichtenwertforschung geprüft sowie aufgezeigt werden, an welcher Stelle eine tiefergehende empirische Auseinandersetzung zur Verknüpfung beider Konzepte sinnvoll erscheint.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Theoretische Fundierung
2.1 Nachrichtenwert und Nachrichtenauswahl
2.2 Informationsverarbeitung und Nachrichtenproduktion
2.3 Generic Framing
2.4 Zwischenfazit
3. Vom Nachrichtenwert zum Frame
3.1 Nachrichtenfaktoren und Medienframes
3.2 Implikationen
4. Fazit und Ausblick
5. Quellenverzeichnis
- Citar trabajo
- Jan Horak (Autor), 2012, Nachrichtenwert und Framing, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214476