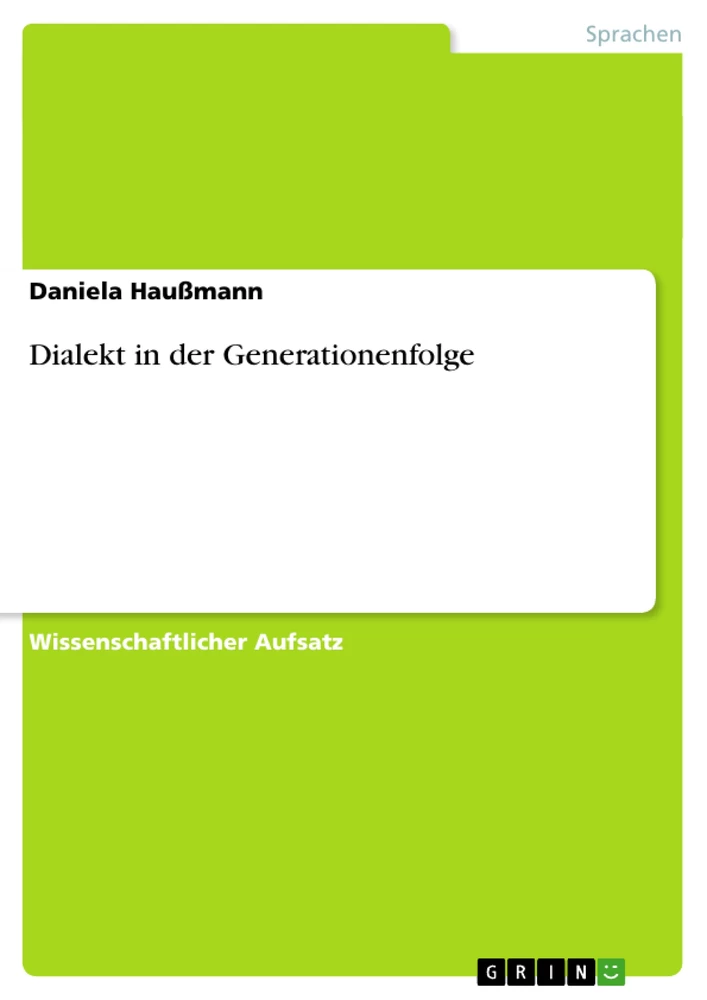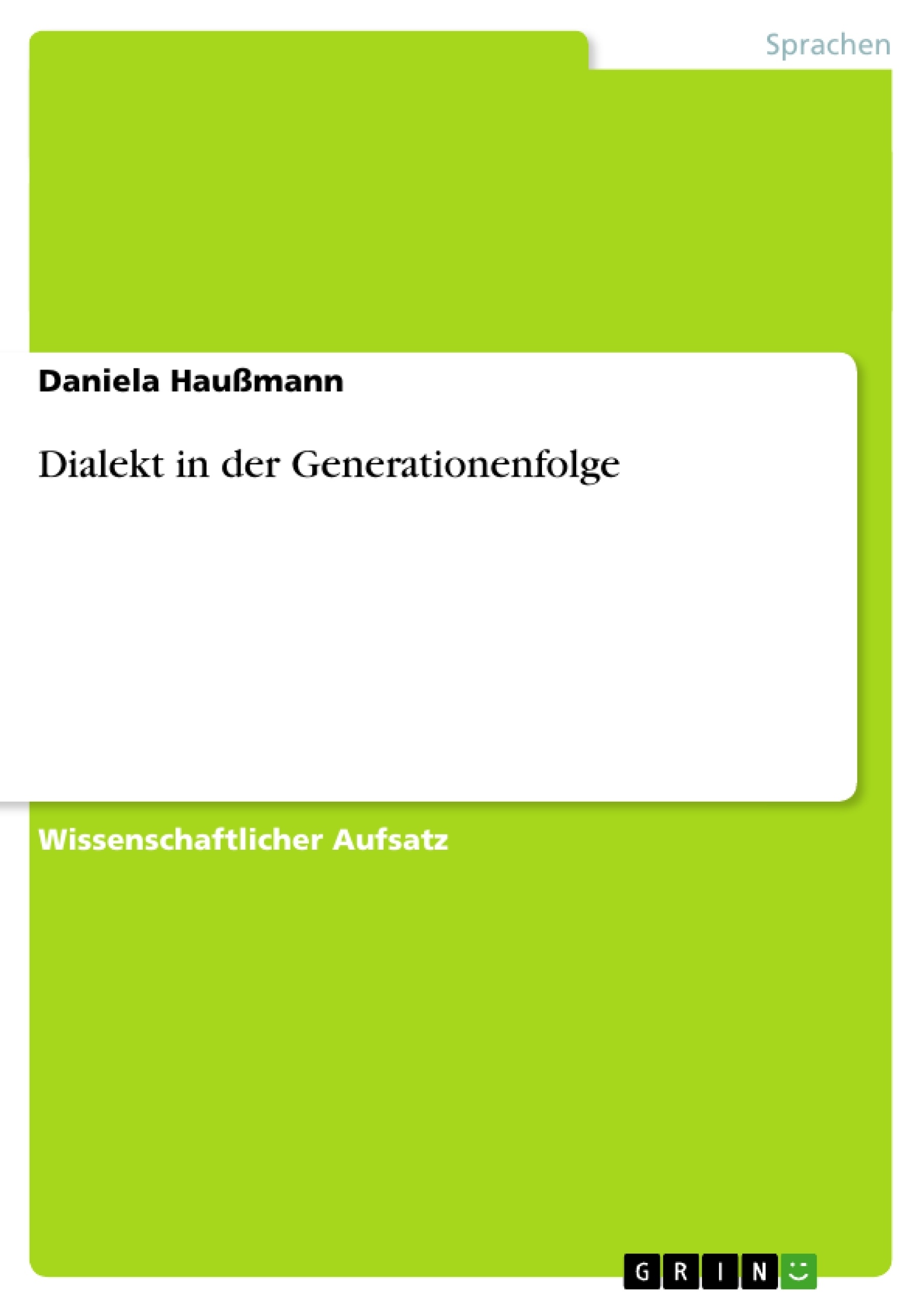Nur weil Menschen unterschiedlichen Alters im selben Bundesland oder in einer Region
leben bedeutet das noch lange nicht, dass sie einander verstehen. Worte und Begriffe, aber
auch Redewendungen sind über die Jahre hinweg in der lokalen Mundart in Vergessenheit
geraten, sie werden in den jüngeren Generationen nicht mehr benutzt. Das wurde im Gespräch
mit neun Personen deutlich, denen Fragen zu ihren Lebenszusammenhängen, der schulischen
wie beruflichen Ausbildung und des ausgeübten Berufs gestellt worden sind. Dadurch wurde
es möglich Gründe für den sprachlichen Wandel zu finden und sie plausibel darzustellen. 1
Vor allem für die Älteren in der Bevölkerung ist die umrissene Entwicklung Anlass genug um
zu behaupten, dass der Dialekt in Zukunft aussterben wird. Das ist jedoch eine seit 200 Jahren
gehegte Befürchtung, 2 deren Wahrscheinlichkeitsgehalt im Gespräch mit Befragten im Alter
von 25 bis 71 Jahren im Folgenden nachgegangen wird. Am Ende soll eine Antwort darauf
versucht werden, ob der Dialekt tatsächlich keine Zukunft hat. Sprechen wirklich immer
weniger Menschen im Dialekt und wenn ja, weshalb? Die wichtigsten Antworten sind in
diesem Beitrag zusammengestellt.
1 Probst-Effah, Gabriele: Anmerkungen zur Dialektrenaissance der siebziger Jahre; aus:
Noll/Schepping (Hg.): Musikalische Volkskultur. Tagungsbericht Köln 1988 der Kommission
für Lied-, Musik- und Tanzforschung in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e.V.,
Hannover: Metzler 1992, S. 135.
2Bausinger, Hermann: Mundart - Barriere oder Brücke? SWR 2. Programm, So., 26.01.2003,
8.30-9.00 Uhr.
Probst-Effah: Anmerkungen zur Dialektrenaissance, S. 135.
Inhaltsverzeichnis
- Verstehen und verstanden werden – Der Lebenswandel im gesprochenen Wort
- Dialekt ein Auslaufmodell
- Der Nahbereich verliert sich in der Ferne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag untersucht die Entwicklung des Dialekts in verschiedenen Generationen und analysiert die Gründe für seinen Wandel. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob der Dialekt in Zukunft aussterben wird.
- Der Einfluss der Industrialisierung und des Fernsehens auf die Lebensgestaltung und den Sprachgebrauch.
- Die Rolle von Einwanderung und Heimatvertriebenen beim Sprachwandel.
- Die Bedeutung von Bildung und Beruf für die Verwendung von Dialekt und Hochsprache.
- Die Bedeutung des Heimatortes und der lokalen Gemeinschaft für den Erhalt des Dialekts.
- Die Unterschiede im Sprachvermögen zwischen Generationen und die Ursachen dafür.
Zusammenfassung der Kapitel
Verstehen und verstanden werden – Der Lebenswandel im gesprochenen Wort
Dieses Kapitel beleuchtet die Veränderungen im Lebensalltag, die den Sprachwandel beeinflussen. Die Industrialisierung und das Fernsehen haben zu einer individualisierten Lebensgestaltung geführt, die den Nahbereich der Menschen verändert hat. Die Integration von Heimatvertriebenen und Gastarbeitern brachte neue Einflüsse in die lokale Mundart und führte zu einer stärkeren Verwendung von Hochdeutsch.
Dialekt ein Auslaufmodell
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Dialekts für verschiedene Generationen. Die jüngere Generation verwendet den Dialekt weniger und orientiert sich mehr an der Hochsprache. Die Gründe dafür liegen in der globalisierten Arbeitswelt, der Bedeutung von Bildung und dem Erlernen von Fremdsprachen.
Der Nahbereich verliert sich in der Ferne
Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen der räumlichen Distanz zum Heimatort und dem Sprachgebrauch. Die jüngeren Generationen leben weiter entfernt von ihrem Heimatort und haben weniger Kontakt zur lokalen Gemeinschaft. Dies führt zu einem Verlust an Dialekt-Wörtern und -Redewendungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Beitrags sind Dialekt, Sprachwandel, Generationen, Industrialisierung, Fernsehen, Einwanderung, Heimatvertriebene, Bildung, Beruf, Globalisierung, Heimatort, Gemeinschaft, Sprachvermögen.
Häufig gestellte Fragen
Stirbt der Dialekt in Deutschland aus?
Die Befürchtung besteht seit 200 Jahren. Die Arbeit zeigt, dass Dialekte zwar seltener werden, aber sich oft in neue Mischformen wandeln.
Welchen Einfluss hat das Fernsehen auf den Dialekt?
Medien fördern die Verbreitung des Hochdeutschen und führen dazu, dass regionale Begriffe und Redewendungen in Vergessenheit geraten.
Warum sprechen jüngere Generationen weniger Dialekt?
Gründe sind die globalisierte Arbeitswelt, höhere Mobilität (Wegzug vom Heimatort) und die Orientierung an der Hochsprache für berufliche Zwecke.
Welche Rolle spielen Heimatvertriebene beim Sprachwandel?
Die Integration von Menschen aus anderen Regionen nach dem Krieg führte zu einer stärkeren Vermischung von Dialekten und einer Zunahme des Hochdeutschen als gemeinsamer Basis.
Ist Bildung ein Hindernis für den Erhalt von Dialekten?
Oft wird Dialekt fälschlicherweise mit mangelnder Bildung assoziiert, was dazu führt, dass in Schulen und im Beruf fast ausschließlich Hochdeutsch gesprochen wird.
- Citar trabajo
- Daniela Haußmann (Autor), 2003, Dialekt in der Generationenfolge, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21448