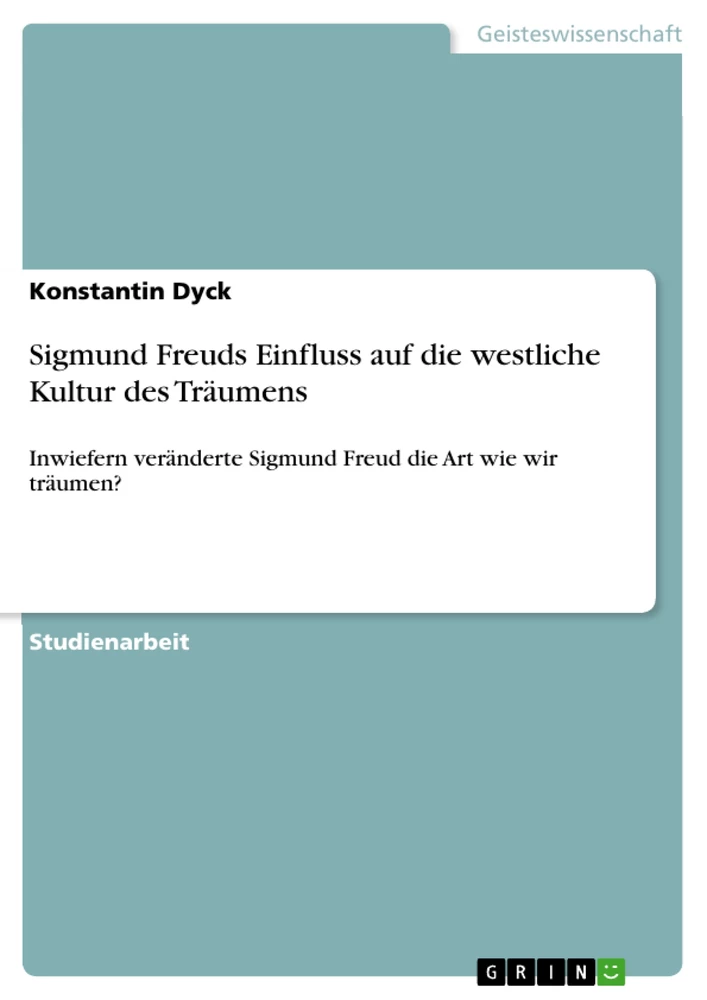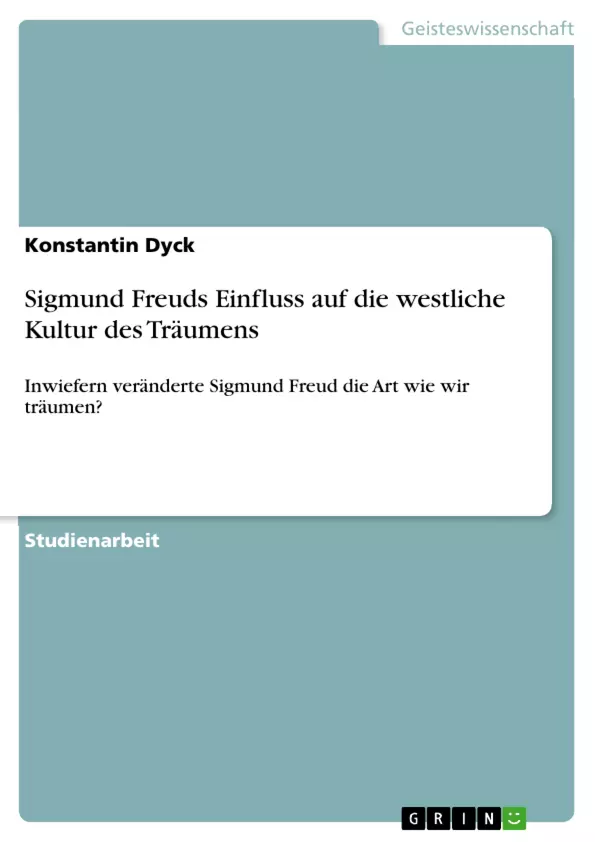Als Freud sein Erstlingswerk „Die Traumdeutung“ veröffentlichte und somit das barocke Denken Wiens, wie auch nur einen kurzen Moment später das der anderen Teile des Westens der damaligen Zeit in ihren Grundfesten erschütterte, wusste wohl nicht einmal er selbst, der mit einer unerbittlichen Sturheit an seinen Ideen festhielt, dass er mit dieser Schrift eine ganze Bewegung starten würde.
Auf Grundlage seiner Gedanken möchte im Weiteren seine bis heute andauernde streitbare Gegenwart sowohl in der Wissenschaft als auch der Gesellschaft im Allgemeinen untersuchen und daraus mithilfe von neueren Erkenntnissen aus der Neuropsychologie als auch bereits bekannten aus der Anthropologie auf eine neue Perspektive der Traumdeutung hinweisen.
Anfangs gebe ich dafür eine kurze Zusammenfassung Freuds Traumdeutung, die nicht in ihren Einzelheiten den Inhalt meiner Arbeit stellen sollte, sondern eher ein aus seiner Schrift weiterführender Gedanke, der sowohl für die gegenwärtige Ethnologie als auch die Psychologie durchaus hilfreich sein könnte. Eben deshalb gehe ich im weiterführenden Schritt auch primär auf sein Wirken ein. Denn wichtig war es mir einen Einfluss Freuds innerhalb unserer westlichen Traumkultur zu erforschen und mithilfe einer selbstreflexiven interkulturellen Ansicht von dem Ideal wegzuführen „unsere“ Träume in ihrem Inhalt als völlig unabhängig zu bezeichnen. Dazu beziehe ich mich unter anderem auf Roy D'Andrade, Stanley Messer, Zvi Lothane und einige andere.
Im letzten Teil bietet dann eine aktuelle Schrift von Maria L. Tricoli einen hochinteressanten neurophysiologischen Ansatz, der die Selbstreflexion als zentralen Standpunkt in der Debatte einführt und so wie ich finde einen neuen Weg für die Betrachtung soziokulturellen Einflusses auf unseren Traum bereitet.
Insgesamt war es mir wichtig einen interdisziplinären Einblick in die Erforschung des Traumes zu geben, ohne einerseits den Einfluss und die bis in die Gegenwart geltende Bedeutung Freuds auf diesem Gebiet zu leugnen und anderseits gleichbedeutend und mindestens genauso gewichtend aktuelle weiterentwickelte Konzepte des Traums hinzu zunehmen. So wollte ich eine weniger starre Konstruktion in den Fokus rücken, die eben nicht die rein neurologische Ansicht offenbarte.
Natürlich bleibt alles in allem die Traumforschung recht vage, doch eine fächerübergreifende Betrachtung, bringt, wie ich finde, neue Ideen zusammen und schafft neue Ansatzpunkte für zukünftige Forschung auf diesem Gebiet.
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Traumdeutung nach Sigmund Freud
3.) Sigmund Freuds Einfluss
3.1 Eine genauere Betrachtung
3.2 Freuds Ideen von uns internalisiert?
4.) Interkulturelle Sicht auf Träume und Träumende
4.1 Die frühe Ethnologie über den Traum
4.2 Transformationen des Traums und mögliche Beeinflussung des westlichen Traumkonzepts
5.) Maria L. Tricolis neurophysiologischer Ansatz der Selbstreflexion
6.) Schlussbemerkung
Bibliographie
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Sigmund Freud auf die Traumkultur?
Mit seinem Werk „Die Traumdeutung“ begründete Freud die Ansicht, dass Träume verschlüsselte Botschaften des Unbewussten und Ausdruck verdrängter Wünsche sind.
Wie hat sich die Traumdeutung seit Freud weiterentwickelt?
Moderne Ansätze verknüpfen Freuds Theorien mit Erkenntnissen aus der Neuropsychologie, der Anthropologie und der Ethnologie, um ein ganzheitlicheres Bild zu erhalten.
Was ist der neurophysiologische Ansatz der Selbstreflexion?
Dieser Ansatz von Maria L. Tricoli betrachtet Träume als Prozess der Selbstreflexion, bei dem soziokulturelle Einflüsse und neurologische Prozesse ineinandergreifen.
Sind unsere Träume kulturell beeinflusst?
Ja, die Arbeit zeigt, dass die Inhalte und die Deutung von Träumen stark von der jeweiligen Kultur und dem internalisierten Wissen einer Gesellschaft abhängen.
Welche Rolle spielt die Ethnologie in der Traumforschung?
Die frühe Ethnologie untersuchte, wie verschiedene Völker Träume als spirituelle oder soziale Wegweiser nutzen, was einen Kontrast zum rein individuellen Ansatz Freuds bildet.
- Citation du texte
- Konstantin Dyck (Auteur), 2012, Sigmund Freuds Einfluss auf die westliche Kultur des Träumens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214544