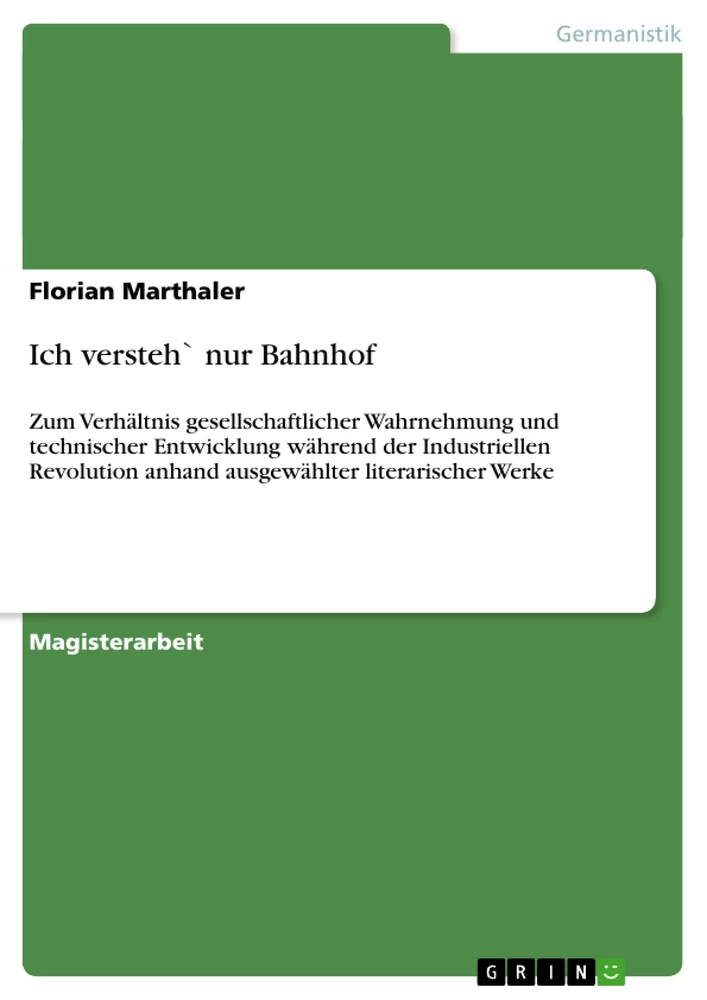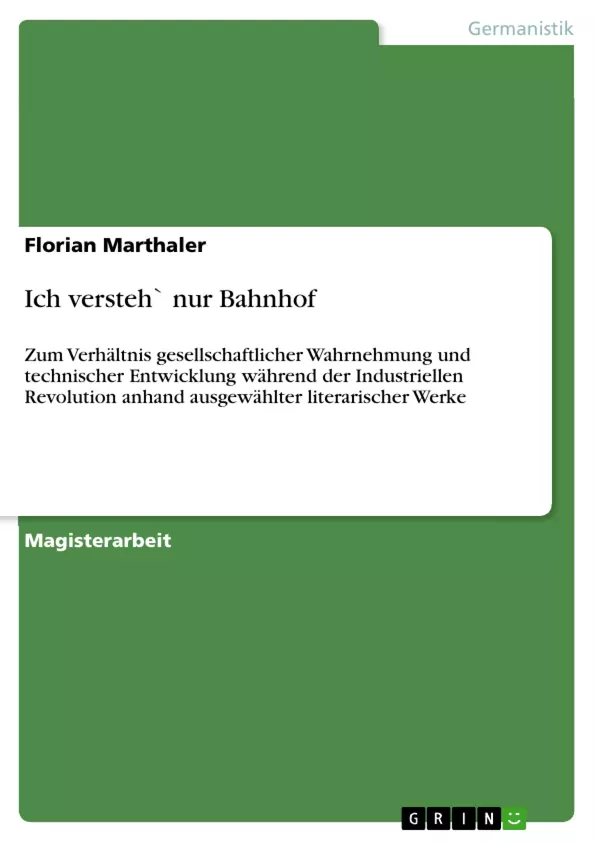Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Verhältnisses von technischer Entwicklung und gesellschaftlicher Wahrnehmung während der Epoche der industriellen Revolution. Dies geschieht anhand einiger ausgewählter literarischer Werke jener Zeit, da, zum einen die in der Wahrnehmung der zeitgenössischen Gesellschaft relevantesten Aspekte thematisiert werden, zum anderen sich anhand des literaturgeschichtlichen Verlaufs Prozesse gesellschaftlicher Entwicklung nachverfolgen lassen.
Die Behandlung der einzelnen Werke erfolgt antichronologisch, um auf diese Weise den Ursprung des durch die Industrialisierung ausgelösten psychischen und gesellschaftlichen Transformationsprozesses herauszuarbeiten. Diese Arbeit ist somit zwar im Kern eine literaturgeschichtliche Untersuchung, soll jedoch einen ausgeprägten literatursoziologischen Anteil enthalten. Daneben werden jedoch auch anthropologische, psychologische sowie religionswissenschaftliche Aspekte thematisiert, da diese für ein umfassendes Verständnis des hier behandelten Themenkomplexes unabdingbar sind. Die Bearbeitung der literarischen Werke erfolgt lose antichronologisch, beginnt also mit Spät- und Endphase der Industrialisierung. Diese Zeit wird anhand von Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“ behandelt werden.
Die Epoche der Hochindustrialisierung, also der Zeitraum zwischen den 1870er und 1890er Jahren, wird anhand dreier auf den ersten Blick sehr unterschiedlicher Werke behandelt werden. Daher werden zunächst die Novellen „Bahnwärter Thiel“ von Gerhard Hauptmann und „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm untersucht werden, bevor mit Theodor Fontanes „Effi Briest“ ein weiter Roman Gegenstand dieser Arbeit ist.
Den Abschluss dieser Untersuchung bildet schließlich das Dramenfragment „Woyzeck“ von Georg Büchner.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Technik als anthropologische Konstante
- Technik als gesellschaftsprägender Faktor
- Zeitliche Verortung der Epoche
- Räumliche Verortung der Epoche
- Einige grundlegende Neuerungen der Epoche
- Industrialisierung als „ultimative Kulturschwelle"
- Erich Maria Remarque: „Im Westen nichts Neues“
- Rezeption, Rezension und Wirkung
- Die Auswirkungen des ersten Weltkriegs
- Remarques Darstellung des Kriegsgeschehens
- Frontalltag und Kasernenhofdrill
- Beschreibung der Kriegsmaschinerie
- Entwicklung der Kriegsindustrie
- Kriegstechnik und Städtebau
- Ich versteh nur Bahnhof
- Die Ambivalenz der Technik
- Technik, Mystik, Infrastruktur und Beschleunigung
- Technik und Zeitwahrnehmung
- Gerhard Hauptmann: Bahnwärter Thiel
- Mensch und Mechanik
- Die Faszination des Automatismus
- Technik, Mystik und Magie
- Exkurs: Religion als vorwissenschaftliche Technik
- Thiels „mystische Neigung“
- Theodor Storm: „Der Schimmelreiter“
- Zeitgenössische Rezensionen
- Die Symbolik der Natur
- Die Funktion der Magie
- Die Notwendigkeit der Bändigung
- Die Figur des Hauke Haien
- Vorläufige Zusammenfassung der Ergebnisse
- Industrialisierung und Gesellschaft
- Elite, Masse und Macht
- Masse und Technik
- Die Kultur der Industriegesellschaft
- Theodor Fontane: „Effi Briest“
- Die Psychologie der Industrialisierung
- Industrialisierung und Strukturvergrößerung
- Industrialisierung und Macht
- Gesellschaftszwang: Internalisierung und Reflexion
- Alltagsmenschen und Führungspositionen
- Individualität und Atomisierung
- Wissenschaft und Spezialisierung
- Georg Büchner: Woyzeck
- Die Rolle der Gesellschaft
- Der Hauptmann als Vertreter des Feudalismus
- Der Doctor als Repräsentant des Bürgertums
- Doctor und Hauptmann
- Woyzeck als Vertreter der Massen
- Die soziale Isolierung Woyzecks
- Der Wahn Woyzecks
- Woyzeck als frühindustrielle Vorahnung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen technischer Entwicklung und gesellschaftlicher Wahrnehmung während der industriellen Revolution anhand ausgewählter literarischer Werke. Ziel ist es, die in der zeitgenössischen Gesellschaft relevanten Aspekte der technischen Entwicklung aufzuzeigen und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse anhand literaturgeschichtlicher Verläufe nachzuvollziehen. Die Analyse erfolgt antichronologisch, um den Ursprung der durch die Industrialisierung ausgelösten psychischen und gesellschaftlichen Transformationen zu beleuchten.
- Die Auswirkungen der Industrialisierung auf die gesellschaftliche Wahrnehmung.
- Die Darstellung von Technik in der Literatur der industriellen Revolution.
- Der Einfluss der Industrialisierung auf die menschliche Psyche.
- Die Rolle der Literatur als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen.
- Die Ambivalenz von Technik und deren Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche die Untersuchung des Verhältnisses von technischer Entwicklung und gesellschaftlicher Wahrnehmung während der industriellen Revolution anhand ausgewählter literarischer Werke zum Gegenstand hat. Es wird die antichronologische Vorgehensweise begründet und der interdisziplinäre Ansatz der Arbeit (literaturgeschichtlich, literatursoziologisch, anthropologisch, psychologisch, religionswissenschaftlich) erläutert. Die Auswahl der Werke und deren jeweilige Einordnung in den zeitlichen Kontext der Industrialisierung werden vorgestellt.
2. Technik als anthropologische Konstante: Dieses Kapitel beleuchtet das Wesen der Technik und das Verhältnis des Menschen zu ihr aus anthropologischer Perspektive. Es wird die besondere Stellung des Menschen im Tierreich aufgrund seiner physiologischen und ontogenetischen Beschaffenheit herausgestellt und die Bedeutung der Weltoffenheit und Selbstbestimmtheit für die menschliche Entwicklung betont. Die Fähigkeit zur Reflexion und Selbstgestaltung der Identität wird als entscheidender Faktor hervorgehoben.
3. Erich Maria Remarque: „Im Westen nichts Neues“: Dieses Kapitel analysiert Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“ im Kontext der Spät- und Endphase der Industrialisierung. Es untersucht die Rezeption und Wirkung des Romans und beleuchtet die Darstellung des Ersten Weltkriegs, den Frontalltag, die Kriegsmaschinerie und die Entwicklung der Kriegsindustrie. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz der Technik und deren Auswirkungen auf die Erfahrung des Krieges und die menschliche Psyche. Der Begriff "Ich versteh nur Bahnhof" wird im Kontext des erlebten Chaos und der Entfremdung analysiert.
4. Technik, Mystik, Infrastruktur und Beschleunigung: Dieses Kapitel untersucht die Werke von Gerhard Hauptmann ("Bahnwärter Thiel") und Theodor Storm ("Der Schimmelreiter") im Kontext der Hochindustrialisierung. Es analysiert die Darstellung von Technik und deren Einfluss auf die Zeitwahrnehmung, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine und die Faszination des Automatismus. Der mystische Aspekt der Technik wird beleuchtet, wobei ein Exkurs die Religion als vorwissenschaftliche Technik betrachtet.
5. Theodor Storm: „Der Schimmelreiter“: Diese Kapitel befasst sich mit Storms "Der Schimmelreiter". Die Analyse fokussiert sich auf zeitgenössische Rezensionen, die Symbolik der Natur, die Funktion der Magie, die Notwendigkeit der Bändigung, und die Rolle der Hauptfigur Hauke Haien. Die Kapitel untersucht die Interaktion zwischen Mensch, Natur und Technik im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen der Epoche.
6. Industrialisierung und Gesellschaft: Dieses Kapitel bietet eine vorläufige Zusammenfassung der Ergebnisse aus den vorherigen Kapiteln. Die Aspekte Elite, Masse, Macht und die Kultur der Industriegesellschaft werden in ihren Wechselwirkungen mit den technologischen Entwicklungen beleuchtet. Die Zusammenfassung integriert und synthetisiert die zuvor behandelten Themen und deutet auf die sich herausbildenden Muster hin.
7. Theodor Fontane: „Effi Briest“: Dieses Kapitel analysiert Fontanes Roman „Effi Briest“ in Bezug auf die Psychologie der Industrialisierung, Strukturvergrößerung, Machtverhältnisse, Gesellschaftszwang, die Unterscheidung zwischen Alltagsmenschen und Führungspositionen, und schließlich Individualität und Atomisierung. Es untersucht, wie diese Aspekte in Effis Leben und im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit reflektiert werden.
9. Georg Büchner: Woyzeck: Dieses Kapitel untersucht Büchners Dramafragment „Woyzeck“ im Kontext der Frühindustrialisierung. Es analysiert die Rolle der Gesellschaft, die Figuren des Hauptmanns und des Doctors als Vertreter des Feudalismus und des Bürgertums, die soziale Isolierung Woyzecks, seinen Wahn, und interpretiert das Stück als eine Vorahnung der Folgen der Industrialisierung.
Schlüsselwörter
Industrialisierung, Technik, Gesellschaft, Wahrnehmung, Literatur, Erich Maria Remarque, Gerhard Hauptmann, Theodor Storm, Theodor Fontane, Georg Büchner, Masse, Elite, Macht, Psychologie, Ambivalenz, Mystik, Zeitwahrnehmung, Soziale Isolierung.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Industrialisierung in ausgewählten literarischen Werken
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen technischer Entwicklung und gesellschaftlicher Wahrnehmung während der industriellen Revolution anhand ausgewählter literarischer Werke. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Industrialisierung auf die Gesellschaft, die menschliche Psyche und die Darstellung von Technik in der Literatur dieser Epoche.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die folgenden Werke: Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“, Gerhard Hauptmanns „Bahnwärter Thiel“, Theodor Storms „Der Schimmelreiter“, Theodor Fontanes „Effi Briest“ und Georg Büchners „Woyzeck“. Die Auswahl der Werke dient dazu, verschiedene Aspekte und Phasen der Industrialisierung zu beleuchten.
Welche Aspekte der Industrialisierung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Industrialisierung, darunter die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung, die Darstellung von Technik in der Literatur, den Einfluss auf die menschliche Psyche, die Rolle der Literatur als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen und die Ambivalenz von Technik und deren Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft. Weitere Themen sind die Veränderungen von Elite, Masse und Macht, sowie die Entwicklung der Industriegesellschaft und die zunehmende Spezialisierung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der literaturgeschichtliche, literatursoziologische, anthropologische, psychologische und religionswissenschaftliche Perspektiven integriert. Die Analyse erfolgt antichronologisch, um die Ursprünge der durch die Industrialisierung ausgelösten Transformationen zu verstehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die jeweils ein spezifisches Werk oder einen Aspekt der Industrialisierung behandeln. Sie beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den methodischen Ansatz erläutert, und endet mit einem Resümee. Zwischen Einleitung und Resümee werden die ausgewählten literarischen Werke analysiert und in den Kontext der Industrialisierung eingeordnet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Industrialisierung, Technik, Gesellschaft, Wahrnehmung, Literatur, Erich Maria Remarque, Gerhard Hauptmann, Theodor Storm, Theodor Fontane, Georg Büchner, Masse, Elite, Macht, Psychologie, Ambivalenz, Mystik, Zeitwahrnehmung, Soziale Isolierung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die in der zeitgenössischen Gesellschaft relevanten Aspekte der technischen Entwicklung aufzuzeigen und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse anhand literaturgeschichtlicher Verläufe nachzuvollziehen. Die Arbeit möchte das komplexe Verhältnis zwischen technischem Fortschritt und seinen gesellschaftlichen und psychischen Folgen aufzeigen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine Analyse der ausgewählten literarischen Werke im Kontext der Industrialisierung. Die Ergebnisse zeigen, wie die Autoren die technischen und gesellschaftlichen Veränderungen ihrer Zeit wahrnahmen und literarisch verarbeiteten. Die Arbeit beleuchtet die Ambivalenz der Technik und deren Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft. Eine vorläufige Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich in einem eigenen Kapitel.
- Citar trabajo
- Florian Marthaler (Autor), 2012, Ich versteh` nur Bahnhof, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214551