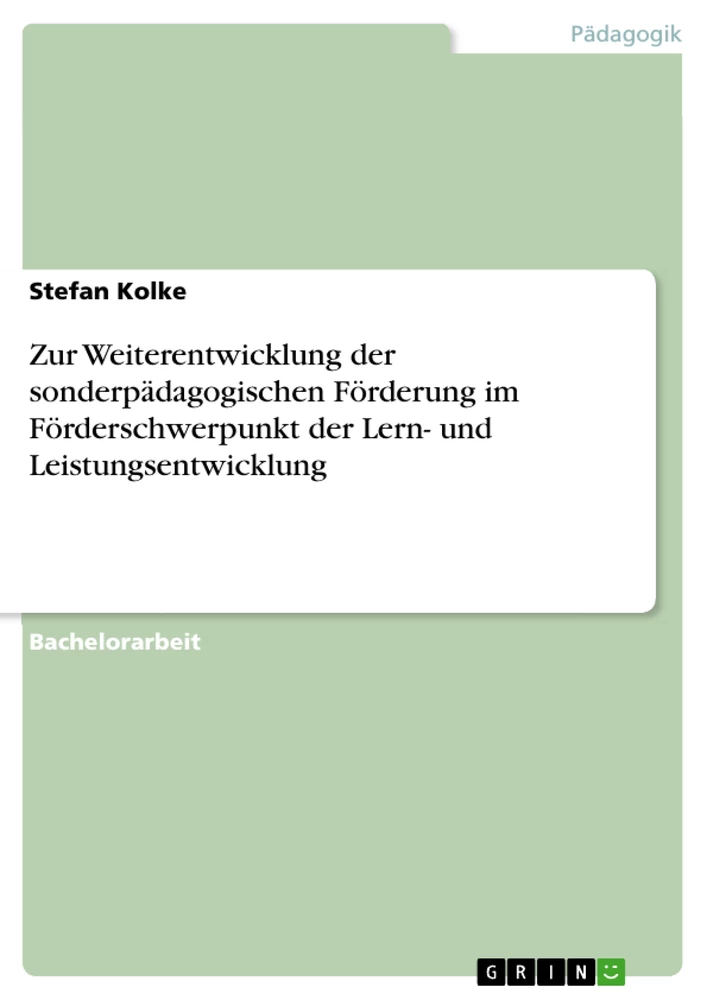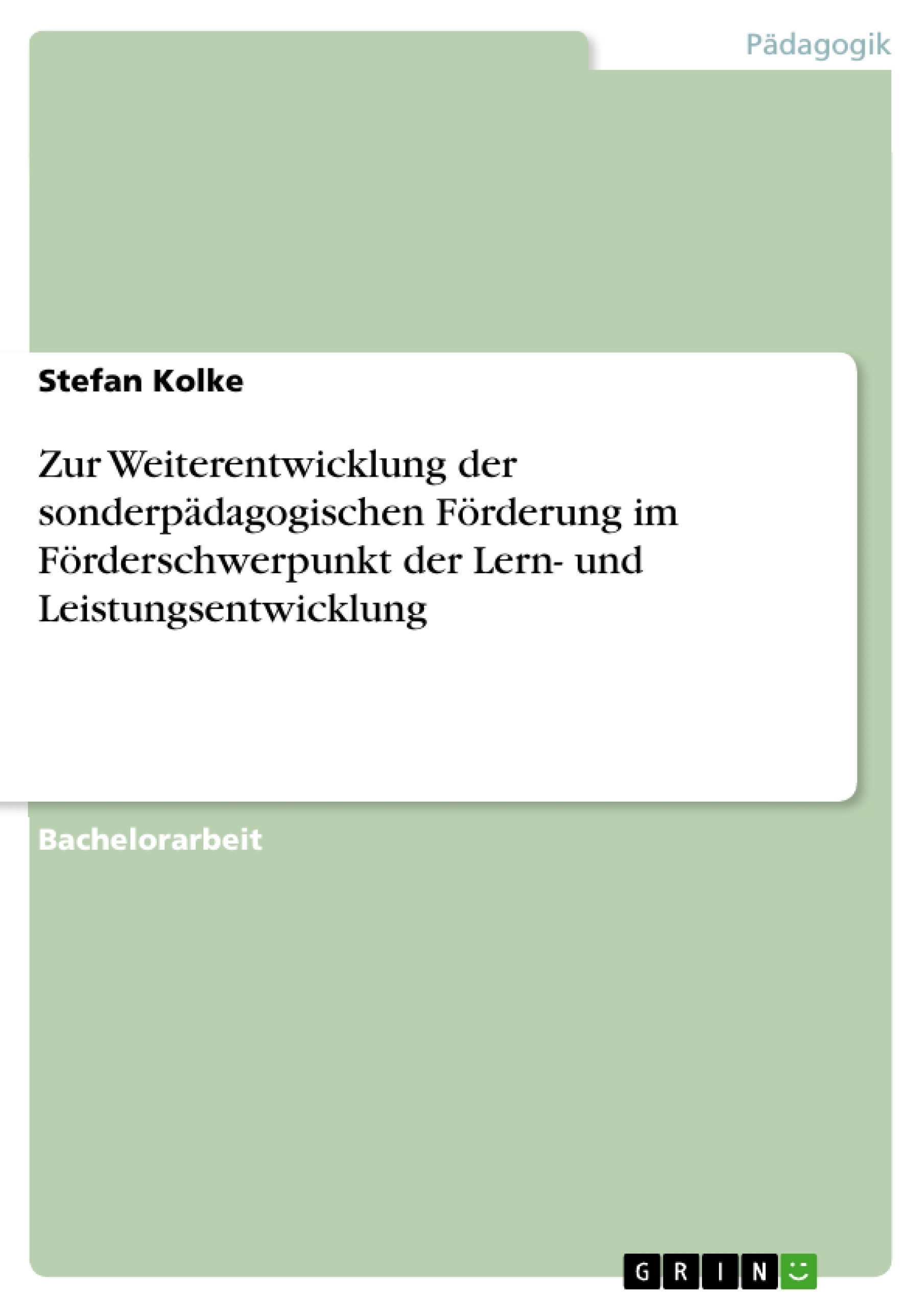Hans Eberwein wagt in seinem 1988 erschienen „Handbuch der Integrationspädagogik“ die Prognose, „[...]dass sich die einhundertjährige Geschichte des eigenständigen Sonderschulwesens ihrem Ende zuneigt.“ Die sonderpädagogische Theorie habe sich demnach an einer integrativen Beschulung zu orientieren, die neben der Vermeidung von Etikettierungsprozessen und der Förderung von Selbstbestimmung auch ein Stück Normalität für die sogenannten „Behinderten“ und „Nichtbehinderten“ herstellen könnte. Das gemeinsame Lernen, die Förde-rung der Entwicklung, der Identität und Autonomie aller Kinder sollte also künftig im Mittelpunkt aller pädagogischer Handlungen stehen.
In der vorliegenden Arbeit wird diese Problematik unter dem besonderen Blickwinkel der Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Förderschwerpunkt der Lern- und Leistungsentwicklung aufgegriffen und bearbeitet. Neben der Bestimmung und Abgrenzung zentraler Begriffe, wird vor allem auf die Entstehung einer besonderen Pädagogik bei Lernschwierigkeiten und auf die Entwicklungstendenzen seit den 1970er Jahren eingegangen. Die Integration von Kindern mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen in die Grundschule, einschließlich der dafür notwendigen organisationsstrukturellen Rahmenbedingungen, bildet den Kern der Arbeit. Um den aktuellen Stand integrationspädagogischer Bemühungen zu verdeutlichen, erfolgt im abschließenden Teil die Auseinandersetzung mit bundesdeutschen Bildungsstatistiken sowie die konkrete Projektion der Integration auf das Bundesland Brandenburg.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen einer Pädagogik bei Lernschwierigkeiten
2.1 Begriffliche Systematik der traditionellen Lernbehindertenpädagogik
2.2 Von der „Lernbehinderung“ zum Förderschwerpunkt Lernen
2.3 Gravierende Lernschwierigkeiten und ihre Bedingungsfaktoren
3. Entstehungsgrundlagen der Pädagogik bei Lernschwierigkeiten
3.1 Von der „Hilfsschule“ zur „Schule für Lernbehinderte“
3.2 Die Entwicklung der schulischen Integration seit den 1970er Jahren
4. Grundlagen der Integrationspädagogik
4.1 Integration – Eine Begriffsbestimmung
4.2 Organisationsformen schulischer Integration
4.3 Die veränderte Lehr- und Lernsituation
4.3.1 Grundsätze des gemeinsamen Unterrichts
4.3.2 Zur veränderten LehrerInnenrolle
4.4 Inklusion gleich optimierte und erweiterte Integration?
5. Zur Bedeutsamkeit der Institution Grundschule
5.1 Förderschule – Der effizientere Ort der Beschulung?
5.2 Schulische Integration im Sekundarbereich – Ein Ausblick
6. Aktuelle Standortbestimmung
6.1 Rechtliche Basis für den Gemeinsamen Unterricht
6.2 Zum Integrationsstand – Zahlen und Fakten
7. Das Land Brandenburg
7.1 Das Bildungssystem Brandenburgs
7.2 Der gemeinsame Unterricht
7.2.1 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
7.2.2 Integration – Unterricht und Schule verändern sich
7.2.3 Integration auf Kreisebene
7.2.4 Integration auf Landesebene
7.3 Zum Integrationsstand – Zahlen und Fakten
8. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Internetquellenverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Vor etwa 110 Jahren forderte man in allen deutschsprachigen Ländern die Schaffung von Hilfsklassen für Schwachbegabte. Man ging davon aus, dass damit ein notwendiger pädagogischer Fortschritt im Bereich des Schulwesens erzielt werden könne. Bis in die 1970er Jahre hinein wurde mit dem Ausbau der Hilfsschulen bzw. Sonderschulen für „Lernbehinderte“ auf die Problematik leistungsschwacher SchülerInnen reagiert. Dabei stand immer schon das Ziel der gesellschaftlichen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Benachteiligungen im Vordergrund. Befürworter des Sonderschulwesens konnten sich zu jener Zeit eine Schule ohne Aussonderung nicht vorstellen (vgl. Haeberlin u. a. 1999, S. 5).
Doch seit nun mehr als 40 Jahren werden in Deutschland Diskussionen um eine solche Schule geführt. Gegner der äußeren Differenzierung nach Schulformen sind der Ansicht, dass eine erfolgreiche Förderung von Kindern mit Behinderungen nicht mehr nur in Sonderschulen zu realisieren sei. Vielmehr kann der sozialen Integration durch die schulische Eingliederung der Betroffenen in Regelschulen Rechnung getragen werden (vgl. Eberwein 2001, S. 29). Spätestens die erschütternden PISA-Ergebnisse lösten Debatten über die Abkehr der verfrühten Auslese und die Reorganisation des hoch differenzierten deutschen Bildungs- und Erziehungssystems aus. Im Zusammenhang mit der PISA-Studie geriet vor allem das skandinavische Schulsystem in den Blickpunkt deutscher BildungspolitikerInnen. Der Gemeinschaftsschule, wie sie beispielsweise in Finnland existiert, wird gegenwärtig eine immer höhere Bedeutung beigemessen (vgl. Eberwein 2008, S. 56). Einen weiteren Anlass für die Revision der traditionellen Sonderschulkonzeption gibt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und ihre Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag im März 2009. Folgt man der Konvention und gewährt allen SchülerInnen mit Behinderung ein uneingeschränktes Recht auf einen diskriminierungsfreien Zugang zur Regelschule, so wäre dies der Beginn eines inklusiven Bildungssystems. „Noch ist in Deutschland die inklusive Schule eine Vision, aber jeder kleine Schritt in ihre Richtung bringt eine kleine Verbesserung des Schulwesens mit“ (Sander 2008, S. 35) Folglich bestimmt derzeit weitestgehend der Terminus Integration die schulische Praxis wenn es um den gemeinsamen Unterricht geht.
Mit dem Ausbau des integrativen Schulsystems soll nicht nur der negativen Selektion und Stigmatisierung von SonderschülerInnen entgegengewirkt werden, es geht auch um den Abbau sozialer Spannungen und um die Öffnung neuer Lernbereiche für „Behinderte“ und „Nichtbehinderte“ (vgl. Knauer 2009, S. 53). Aktuell stellen sich somit folgende Fragen: Sind Neueinrichtungen von Sonderschulen nicht mehr zu rechtfertigen? Sollte eher auf die Umstrukturierung bestehender Sonderschulen in integrative Schulen gedrängt werden, statt sie weiterhin auszubauen? Welchen Unterricht benötigen Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf?
Dieser Sachverhalt betrifft vor allem die SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen – die größte Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Laut Statistik der Kultusminister Konferenz (KMK) wird im Jahr 2008 von 210.900 SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen ausgegangen. Das entspricht 43,7% der Schülerschaft mit sonderpädagogischem Förderbedarf (vgl. KMK 2010, Online im Internet). In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass mehr als 90% der Überweisungen in Sonderschulen während der Grundschulzeit erfolgen (vgl. Eberwein 1994, S. 64).
Die vorliegende Arbeit thematisiert, unter Berücksichtigung der oben formulierten Fragestellungen, die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Förderschwerpunkt der Lern- und Leistungsentwicklung und dient dem Autor zur vertiefenden Konfrontation mit der Thematik. Neben der Bestimmung und Abgrenzung zentraler Begriffe, wird vor allem auf die Entstehung einer besonderen Pädagogik bei Lernschwierigkeiten und auf die Entwicklungstendenzen seit den 1970er Jahren eingegangen. Aufgrund der obigen Ausführungen bildet die Integration von Kindern mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen in die Grundschule, einschließlich der dafür notwendigen organisationsstrukturellen Rahmenbedingungen, den Kern der Arbeit. Um den aktuellen Stand integrationspädagogischer Bemühungen zu verdeutlichen, erfolgt im abschließenden Teil die Auseinandersetzung mit bundesdeutschen Bildungsstatistiken sowie die konkrete Projektion der Integration auf das Bundesland Brandenburg. Die Motivation dafür resultiert nicht zuletzt aus einer vom Autor im Jahr 2010 angelegten empirischen Untersuchung zur schulischen Integration in einer Grundschule Südbrandenburgs.
2. Grundlagen einer Pädagogik bei Lernschwierigkeiten
Im Bereich schulischer Bildung und Erziehung sind Lernprobleme kein außergewöhnliches Phänomen, sondern ein weit verbreiteter Begleiter vieler SchülerInnen. In Deutschland stellen „lernbehinderte“ Kinder die größte Gruppe der SonderschülerInnen dar. Auch in integrativen Zusammenhängen häufen sich die Zahlen der Kinder und Jugendlichen mit diagnostizierter „Lernbehinderung“ (vgl. Mand 2009, S. 360).
Die Suche nach einem Begriff, der SchülerInnen mit Lern- und Leistungsproblemen und die damit verbundenen notwendigen schulorganisatorischen Maßnahmen beschreibt, erweist sich im deutschsprachigen Raum als äußerst schwierig. Da Kinder und Jugendliche mit Lernproblemen in der Literatur aus unterschiedlichen Perspektiven definiert werden, hat sich bis heute noch keine allgemein akzeptierte Definition behaupten können. Dies hat wiederum zur Folge, dass uns die Begriffe weder eine einheitliche Beschreibung der SchülerInnengruppe liefern noch Auskunft über ein klar umrissenes Syndrom oder Symptom geben (vgl. Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 17).
Im Folgenden werden begriffliche Grundlagen näher erläutert, um die Position des Autors zu dem in der Arbeit verwendeten Terminus „Lernschwierigkeiten“ zu verdeutlichen. Darüber hinaus wird auf die Bedingungsfaktoren eingegangen, die zu deren Entstehung beitragen können.
2.1 Begriffliche Systematik der traditionellen Lernbehindertenpädagogik
SchülerInnen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Leistungsanforderungen der Volksschule nicht entsprachen, wurden als „Schwachsinnige“ bezeichnet und in Hilfsschulen überwiesen. Zur Überwindung der kausalanalytisch determinierenden Begriffe „Schwachsinn“ und „Schwachbefähigung“, wurde dann zu Beginn der 1960er Jahre der Terminus „Lernbehinderung“ eingeführt, von dem man sich eine Abkehr der vorherrschenden medizinisch-pathologischen Erklärung von Lernbeeinträchtigungen versprach. Das Etikett der „Lernbehinderung“ bekamen SchülerInnen, die sich den Anforderungen der allgemeinen Schule nicht angemessen gewachsen zeigten und aus diesem Grund in eine „Schule für Lernbehinderte“ überwiesen wurden (vgl. Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 17f.). Demgegenüber stand die Gruppe der Kinder mit sogenannten Lernstörungen, deren Beeinträchtigungen des Lernens in der Regelschule behoben werden sollten. Je nach Ausprägungsgrad der Lernbeeinträchtigung wurde folglich zwischen „Lernstörung“ und „Lernbehinderung“ unterschieden (vgl. Heimlich 2009, S. 19). Diese begriffliche Systematik der traditionellen Lernbehindertenpädagogik geht auf einen Entwurf von Bach aus den 1960er Jahren zurück und wurde von Kanter über die Kriterien Umfang, Schweregrad und Dauer weiter ausdifferenziert (vgl. Eberwein 2011, S. 15, Online im Internet). Das folgende Schaubild dient der Übersicht über die kategoriale Systematik der 1970er Jahre.
Abb. 1: Begriffliche Systematik der traditionellen Lernbehindertenpädagogik (Heimlich 2009, S. 20)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus der begrifflichen Systematik geht hervor, dass „Lernstörungen“ weniger umfangreiche, schwerwiegende und langandauernde Formen von Beeinträchtigungen im Lernen darstellten als „Lernbehinderungen“. Demnach konnten „Lernstörungen“ bei durchschnittlich intelligenten SchülerInnen auftreten, die nur in einem Schulfach und weniger als ein Schuljahr Probleme zeigten. Erstreckten sich hingegen bei unterdurchschnittlich intelligenten Kindern die Lernprobleme über mehrere Schuljahre in mehr als einem Schulfach, so wurde eine „Lernbehinderung“ diagnostiziert.
Klassifizierungssysteme dieser Art stehen in einem engen Zusammenhang zu institutionellen Organisationsformen. Folglich veränderten sich auch durch die Systematik der traditionellen Lernbehindertenpädagogik die schulischen Förderperspektiven. Der Vorteil dieser kategorialen Einteilung bestand darin, dass auf vorübergehende Lernschwierigkeiten in einem Schulfach nicht sofort mit Sonderschulüberweisungen reagiert wurde. Die Diagnose „Lernbehinderung“ hatte allerdings negative institutionelle Folgen, die sich nicht nur auf den weiteren Bildungsweg der Betroffenen auswirkten (vgl. Heimlich 2009, S. 20f.; Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 21). In Folge der Sonderschulzuweisung erleiden die als behindert definierten Kinder und Jugendliche häufig personalen und sozialen Identitätsverlust und sind nicht selten Etikettierungs-, Stigmatisierungs- sowie Diskriminierungsprozessen ausgesetzt (vgl. Eberwein 2008, S. 46).
Ein weiterer Kritikpunkt der Klassifizierung von Lernbeeinträchtigungen stellt die Defizitorientierung der Begrifflichkeiten dar. Sowohl „Lernstörungen“ als auch „Lernbehinderungen“ schreiben Lern- und Leistungsdefizite ausschließlich als individuelle Probleme der SchülerInnen fest. Lernprobleme sind aber als Ausdruck eines sehr komplexen Prozesses zu verstehen, an denen LehrerInnen, MitschülerInnen, Eltern aber auch das soziale Umfeld beteiligt sind. Weiterhin gibt die Diagnose „Lernbehinderung“ wenig Aufschluss über die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung bezüglich der Lernziele, -inhalte und der Methodenwahl. Der Begriff „Lernbehinderung“, mit seiner Legitimation zur separierten Förderung von Kindern, ist schon allein durch die Problematik der zweifelsfreien Bestimmung und Abgrenzung des Phänomens gegenwärtig nicht mehr tragbar und kann als belastender, defizitorientierter Terminus bezeichnet werden. Auch die Unterscheidung in Umfang, Schweregrad und Dauer hat sich in der sonderpädagogischen Praxis nicht bewährt, da sie den Blick auf die tatsächlichen Probleme der Betroffenen verschließt. Die Kritik kann auch gegen die in der DDR verwendeten Termini „Intelligenzgeschädigte“ und „schulbildungsfähig Schwachsinnige“ angeführt werden, die ebenso Hilfsschulzuweisungen und Defizitsichtweisen auf die individuellen Problemlagen der Kinder implizierten (vgl. Heimlich 2009, S. 21f.; Mand 1994, S. 360-364; Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 18-21).
2.2 Von der „Lernbehinderung“ zum Förderschwerpunkt Lernen
Vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen und der heftigen Kritik an der Bezeichnung „Lernbehinderung“, kam es schließlich auch Anfang der 1990er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland zu einem Begriffswandel. Die Intention des in Deutschland eingeführten Begriffs „sonderpädagogischer Förderbedarf“ korreliert dabei mit dem in Großbritannien seit dem Warnock-Report bevorzugten Terminus „special educational needs“. Beide Bezeichnungen sollen negative Effekte und individuelle Problemzentrierungen beim Gebrauch von Behinderungsbegriffen vermeiden. Zudem dienten die von der KMK 1994 verabschiedeten „Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland“ der Abkehr einer einseitigen Ausrichtung auf die Sonderbedürftigkeit. Im Vordergrund stehen nun vielmehr die individuellen Förderbedürfnisse, denen an unterschiedlichen Orten des Bildungs- und Erziehungssystems Rechnung getragen werden soll, was folgender Auszug aus den KMK-Empfehlungen belegt (vgl. Heimlich 2009, S. 23f.; Heimlich 2003, S. 135): „Die Erfüllung Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulen gebunden; ihm kann auch in allgemeinen Schulen [...] entsprochen werden.“ (KMK 1994, S. 2, Online im Internet).
In den „Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen,“, die von der Kultusministerkonferenz 1999, in Ergänzung zu den 1994 entlassenen Empfehlungen vorgelegt wurde, wird unter anderem die pädagogische Ausgangslage von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen des Lern- und Leistungsverhaltens thematisiert. Dort heißt es, dass die Auffälligkeiten im schulischen Lernen oftmals mit Problemen der motorischen, sensorischen, kognitiven, sprachlichen sowie emotionalen und sozialen Fähigkeiten einhergehen und sich auf grundlegende Entwicklungsbereiche der Kinder auswirken können (KMK 1999, S. 3, Online im Internet). Die Empfehlungen verdeutlichen die Vielfalt der Verknüpfungen mit anderen Förderschwerpunkten und verweisen so auf die Mannigfaltigkeit der Merkmale von SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Um mit der neuen Umschreibung individuelle Defizite zu überwinden, wurden nun vielmehr die erforderlichen Fördermaßnahmen in den Fokus gerückt, was folgender Ausschnitt aus den „Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen“ verdeutlicht:
„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen gegeben, die in ihrer Lern- und Leistungsentwicklung so erheblichen Beeinträchtigungen unterliegen, dass sie auch mit zusätzlichen Lernhilfen der allgemeinen Schulen nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können. Sie benötigen sonderpädagogische Unterstützung [...].“ (KMK 1999, S. 4, Online im Internet)
Die Bereitstellung sonderpädagogischer Unterstützung in allgemeinen Schulen sollte demnach eine Überweisung der SchülerInnen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen in eine Förderschule überflüssig machen. Der Paradigmenwechsel von der Defizitorientierung hin zum besonderen Bedarf an Förderung und Erziehung hat also einen nachhaltigen Wandel auf schulischer Ebene bewirkt (vgl. Heimlich 2003, S. 135).
Die KMK-Empfehlungen haben jedoch weder Gesetzes- noch Verordnungscharakter und beruhen auf einem Minimalkonsens der Kultusminister. Somit ist die begriffliche Umschreibung der alten Behinderungsbegriffe aus erziehungswissenschaftlicher Sicht eher unbefriedigend geblieben. Heimlich kritisiert vor allem die klassische Tautologie der KMK-Empfehlungen, da der sonderpädagogische Förderbedarf durch die sonderpädagogische Förderung selbst erklärt wird und folglich den Kriterien einer wissenschaftlichen Definition nicht standhält. Im Zuge der Integrationsentwicklung liefert Heimlich einen neuen Klassifikationsansatz, der eine enge schulorganisatorische Sichtweise vermeidet und durch Berücksichtigung der Bereiche Prävention, Frühförderung und Erwachsenenbildung lebenslaufbegleitend zur Verfügung steht (vgl. Heimlich 2009, S. 25f.). Dieser Klassifikationsansatz wird im folgenden Abschnitt thematisiert.
2.3 Gravierende Lernschwierigkeiten und ihre Bedingungsfaktoren
In Folge der Abkehr von statischen und defizitorientierten Begriffsbestimmungen, haben sich im internationalen Kontext Bezeichnungen wie „special educational needs“ oder „learning difficulties“, zu deutsch Lernschwierigkeiten, durchgesetzt. Aus entwicklungstheoretischer Perspektive kann lernen als aktiver, vom Individuum gesteuerter Prozess betrachtet werden, der durch die Interaktion mit einer Umgebung entsteht. Im Sinne der Entwicklungstheorien haftet den Lernschwierigkeiten also keine defizitäre Konnotation an, da sie in allen Lernprozessen für alle Lernenden entstehen. Folglich können also auch KlassenwiederholerInnnen und SchülerInnen ohne Hauptschulabschluss zur Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Schwierigkeiten im Lernen gezählt werden. Selbst in internationalen Debatten erweist sich die Bezeichnung „Lernschwierigkeiten“ als vorteilhaft. In anderen europäischen Ländern wie auch in den USA ist der Terminus „Lernbehinderung“ praktisch nicht bekannt. Vielmehr wird mit den in den USA verwendeten Begriffen „learning disabilities“ oder „educable mentally handicapped“ eine jeweils andere Schulpopulation gekennzeichnet (vgl. Heimlich 2009 S. 26-29; Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 20).
Heimlich klassifiziert den Begriff „Lernschwierigkeiten“ in generelle und partielle Formen bezogen auf die Merkmale Umfang, Dauer und Schweregrad. Neu an seiner Systematik ist die Definition des Schweregrades der Lernschwierigkeiten über den Förderbedarf. Viele Kinder und Jugendliche sind in der Lage, spezifische Lernrückstände durch individuelle Förderung in der allgemeinen Schule inklusive integrativer Angebote zu bewältigen. Demgegenüber stehen SchülerInnen, die zur Behebung sogenannter gravierender Lernschwierigkeiten auf zusätzliche sonderpädagogische Hilfe angewiesen sind. Diese Maßnahmen der sonderpädagogischen Förderung können sowohl an den zahlreichen Orten des sonderpädagogischen Fördersystems stattfinden als auch durch die mobile sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht sichergestellt werden. Schwierigkeiten im Lernen können vorübergehend oder dauerhaft sein, ein oder mehrere Lern- bzw. Entwicklungsbereiche betreffen. Folgende Abbildung veranschaulicht die Klassifikation der Lernschwierigkeiten nach Heimlich (vgl. Heimlich 2009 S. 26-30):
Abb. 2: Klassifikation der Lernschwierigkeiten (Heimlich 2009, S. 30)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zu beachten ist, dass sich der sonderpädagogische Förderbedarf bei vorübergehenden sowie andauernden Schwierigkeiten im Lernen ergeben kann und der Zeitfaktor „Dauer“ deshalb weitestgehend zu vernachlässigen ist (vgl. Heimlich 2009, S. 30).
Die Bezeichnung „Lernschwierigkeiten“ wird in den weiteren Ausführungen dieser Arbeit vom Autor bevorzugt, sofern dadurch der inhaltliche Aspekt nicht verfälscht wird. Dies soll die Überwindung der individualisierenden, auf das Kind reduzierten Betrachtungsweise ermöglichen und auf die Konstruktion von Lernschwierigkeiten in sozialen Kontexten hinweisen.
Wie schon in vorher getroffenen Aussagen deutlich wurde, ist die Entstehung von Schwierigkeiten im Lernen ein komplexer Prozess, in dem interne wie externe Bedingungen in Erscheinung treten. Um die Verständlichkeit und den Umgang mit dem verwendeten Begriff „Lernschwierigkeiten“ ganzheitlich zu gewährleisten, wird im folgenden Abschnitt kurz auf die Erklärungsmodelle von Lernschwierigkeiten nach Heimlich eingegangen. In der sonderpädagogischen Praxis dienen sie außerdem der Ableitung angemessener Diagnose- und Interventionsansätze.
Bedingungsfaktoren und Erklärungsmodelle für Lernschwierigkeiten
Die sonderpädagogische Theorie liefert eine Vielzahl von Erklärungsmodellen und Bedingungsfaktoren, die zum Verständnis der Entstehung gravierender Lernschwierigkeiten beitragen. Inzwischen konnte man sich von medizinisch-pathologischen Erklärungen des Phänomens lösen und kam zu der Erkenntnis, dass der Entstehung gravierender Lernschwierigkeiten nicht nur individuumzentrierten Faktoren zugrunde liegen. Vielmehr kann von einer Kumulation verschiedener Bedingungsfaktoren ausgegangen werden. Das von Heimlich über vier Ebenen beschriebene Erklärungsmodell (siehe Abb. 3, S. 11) berücksichtigt die multifaktoriell bedingte Entstehung von Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsverhalten. Dabei beeinflussen sich die endogenen und exogenen Bedingungsfaktoren der vier Ebenen gegenseitig und unterliegen folglich keinem isolierten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Aus diesem Grund kommt Heimlich zu dem Schluss, dass Lernschwierigkeiten das Ergebnis beeinträchtigter Lern- und Lebenssituationen sind. (vgl. Heimlich 2009, S. 19).
Die erste Ebene ist stark an die Vorgehensweise der sonderpädagogischen Förderpraxis angelehnt, da sie die beobachtbaren und subjektiv wahrnehmbaren Lernschwierigkeiten im Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernen thematisiert. Aber auch Probleme in der Steuerung des Lernprozesses sowie in der Strukturierung einer Lernsituation können Erschwernisse im Lernen hervorrufen. Ungünstige endogene Bedingungsfaktoren im somatischen, sensomotorischen, emotionalen, kognitiven und/oder sozialen Bereich, können der Entstehung von gravierenden Lernschwierigkeiten zuträglich sein und finden auf der zweiten Ebene Berücksichtigung. Auf der Ebene der exogenen Bedingungsfaktoren werden die außerhalb der Kinder und Jugendlichen liegenden Komponenten - Schule, Familie, Umfeld - beschrieben. Diesen Elementen kommt bei der Informationsaneignung durch Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt eine besondere Bedeutung zu. So können Beeinträchtigungen im schulischen, familiären oder sozialen Umfeld die Entstehung von Lernschwierigkeiten begünstigen. Dies wird schon durch die 1970 von Begemann getroffene Aussage deutlich, dass ein Großteil der „HilfsschülerInnen“ als soziokulturell Benachteiligte Unterschichtkinder anerkannt werden sollte (vgl. Begemann 1970, S. 16, Online im Internet). Auf der letzten Ebene werden Erklärungsmodelle vereint, die ihren Ursprung aus erziehungswissenschaftlichen Erkenntnissen haben. Besonders die von der Psychologie und Soziologie entwickelten Modelle sollen die Komplexität von Lernschwierigkeiten und deren Bedingungsfaktoren verdeutlichen. Eine Auseinandersetzung mit diesen Erklärungsmodellen würde an dieser Stelle den Rahmen der Arbeit sprengen.
Folgendes Schaubild fasst noch einmal die vier Ebenen und ihre gegenseitige Beeinflussung untereinander zusammen:
Abb. 3: Erklärungsmodelle von Lernschwierigkeiten – Ein systematischer Überblick (Heimlich 2009, S. 35)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Bedingungsfaktoren bei Schwierigkeiten im Lernen macht eines unmissverständlich deutlich: Lernschwierigkeiten können nicht mehr als allgemeines individuumzentriertes Merkmal angesehen werden. Sie sind das Ergebnis erschwerter Lehr-/ Lernsituationen sowie beeinträchtigter Interaktionsprozesse. Deshalb sollte der Blick von der bisher gelehrten und praktizierten Pädagogik auf eine andere gelenkt werden. Um das dafür notwendige Verständnis zu gewährleisten, erfolgt im nächsten Abschnitt die Skizzierung der Historie einer Pädagogik bei Lernschwierigkeiten, einschließlich ihrer Entwicklungstendenzen ab den 1970er Jahren.
3. Entstehungsgrundlagen der Pädagogik bei Lernschwierigkeiten
Da die Geschichte der Pädagogik bei Lernschwierigkeiten bisher überwiegend als Institutionengeschichte angesehen werden kann, ist sie im Wesentlichen an die Entstehung der Hilfs- bzw. Sonderschule gekoppelt. Das Verständnis für die Hilfsschulentwicklung kann nur dann gewährleistet werden, wenn die bildungspolitischen sowie ökonomischen und sozialen Verhältnisse der jeweiligen Zeit Berücksichtigung finden (vgl. Eberwein 2008, S. 41; Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 23).
Durch die Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland einsetzende industrielle Revolution kam es zur Umstrukturierung im wirtschaftlichen Bereich, die wiederum eine veränderte Wahrnehmung schulischer Grundfunktionen nach sich zog. Infolge der zunehmenden Maschinisierung von Produktionsprozessen forderte der Staat eine bessere Volksschulbildung. Die damit verbundenen gestiegenen Leistungsanforderungen wirkten sich auf die Qualifikations-, Legitimations- und Selektionsfunktion der Volksschulen aus. Im Zuge dieser Veränderungen im Bereich des Bildungswesens, kam es zur Entstehung der „Hilfsschulen“. Dabei bleibt jedoch zu erwähnen, dass bereits in den Armenschulen des Mittelalters sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche Berücksichtigung fanden und demnach die Anfänge einer besonderen Erziehung weitaus früher zu datieren sind (vgl. Eberwein 2008a, S. 17; Heimlich 2009, S. 12; Reichmann-Rohr/ Weiser 1996, S. 21).
3.1 Von der „Hilfsschule“ zur „Schule für Lernbehinderte“
Als Vorläufer der „Hilfsschulen“ wurden während des 19. Jahrhunderts „Nachhilfeklassen“ eingeführt. Das Ziel bestand darin, SchülerInnen mit Schulleistungsproblemen durch intensive Förderung in die Volksschulklassen zurückzuführen. Die mit der Industrialisierung einhergegangenen Qualifikationserfordernisse setzten bei allen SchülerInnen ein Mindestmaß an Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus und resultierten folglich in einem Anstieg der Leistungsanforderungen in den Volksschulen. Unter diesen Bedingungen musste der Gedanke der Nachhilfeklassen wieder in Frage gestellt werden, da die angestrebten Erfolge der Rückführung in die Volksschulklassen weitestgehend ausblieben. Vielmehr machten sich auch dort vermehrt Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten bemerkbar. In den personell wie materiell sehr schlecht ausgestatteten Klassen mit Schülerstärken von bis zu 200 Kindern, war eine individuelle Förderung einzelner SchülerInnen kaum möglich. Um die gleichmäßige Leistungssteigerung aller SchülerInnen einer Jahrgangsklasse zu gewährleisten und sie zur Teilnahme am Produktionsprozess zu befähigen, mussten sowohl schulorganisatorische als auch methodische Alternativen für all diejenigen Kinder gefunden werden, die den allgemeinen Anforderungen der Volksschule nicht gerecht wurden. Das es zwangsläufig zu Problemen bei der individuellen Förderung kommen musste, war bei den damals im überwiegenden Maße frontalen Unterrichtspraktiken nicht verwunderlich (vgl. Eberwein 2008a, S. 17; Heimlich 2009, S. 98-100; Reichmann-Rohr/ Weiser 1996, S. 21)
Das Volksschuldilemma mündete in Überlegungen zur Errichtung eigenständiger Institutionen für die sogenannten Schulversager, die erstmals von dem Leipziger Taubstummenlehrer Heinrich Ernst Stötzner vorgestellt wurden. Seine 1864 publizierte Schrift „Schulen für schwachbefähigte Kinder – Erster Versuch zur Begründung derselben“ thematisierte sowohl die Notwendigkeit von Nachhilfeschulen[1]als auch allgemeine Grundsätze der Unterrichtung und Erziehung dieser Schulform. Weiterhin legte er neben einem Lehrplanentwurf methodische Richtlinien für die Unterrichtsfächer vor. Die noch heute vor allem in der Sonderpädagogik geltenden Prinzipien formulierte Stötzner wie folgt (vgl. Heimlich 2009, S. 100; , Reichmann-Rohr/ Weiser 1996, S. 22):
„So anschaulich – ich möchte fast sagen – so handgreiflich wie möglich! Man gehe nicht nur Schritt für Schritt, sondern Schrittchen für Schrittchen vorwärts! Und zuletzt: Man langweile die Kinder nie, sondern wechsle fleißig mit den Unterrichtsgegenständen ab; im Anfang alle Viertelstunden!“ (Stötzner 1864, zit. n. Reichmann-Rohr/ Weiser 1996, S. 23)
Vor dem gesellschaftlichen Hintergrund kam der Integration der SchülerInnen in die bestehenden politischen Verhältnisse sowie der schulischen Selektion nach Leistungen eine immer größere Bedeutung zu. Aufgrund des veränderten Funktionsverständnisses der Volksschule sollten nach Stötzner schulleistungsschwache Kinder von ihr befreit werden, um unter anderen Bedingungen mehr lernen zu können. Es wurde angenommen, dass leistungsschwächere SchülerInnen die Entwicklung ihrer MitschülerInnen gefährden und umgekehrt die Kinder mit Lernschwierigkeiten unter den gegebenen Umständen nicht hinreichend gefördert werden können. Darin sahen „HilfsschulbefürworterInnen“ die Gefährdung der Selektions- und Integrationsfunktion der Volksschule. Aus diesem Verständnis heraus können drei Aspekte für die Entwicklung der „Hilfsschulen“ formuliert werden: Die Forderung nach einer eigenständigen Schulform resultierte aus der ausweglosen Situation der Kinder, die den Anforderungen der allgemeinen Schule nicht entsprachen, sowie aus der Entlastungsfunktion gegenüber den Volksschulen. Letztlich sollte aber auch der als biologisch-medizinisch definierte Schwachsinn die Notwendigkeit einer separierten Beschulung[2]dieser SchülerInnengruppe legitimieren (vgl. Eberwein 2008a, S. 17, Reichmann-Rohr/ Weiser 1996, S. 23; Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 24-28). Durch die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen mit Schulleistungsproblemen in „Hilfsschulen“ kam es erstmals zur äußeren Differenzierung, statt die schulischen Rahmenbedingungen der Volksschule so zu verändern, dass alle SchülerInnen gemeinsam lernen können (vgl. Eberwein 2008a, S. 18). Aufgrund des zu jener Zeit überwiegend frontal geführten Unterrichts in den stark überfüllten Klassen der allgemeinen Schule, war ein individuelles Eingehen auf die Kinder mit Lernproblemen jedoch kaum denkbar, sodass der Hilfsschulunterricht zunächst die Möglichkeit der Aneignung einer grundlegenden Bildung für diese SchülerInnengruppe darstellte. Darüber hinaus bestand die Chance der separierten Beschulung in der individuellen Förderung vorhandener Kompetenzen. Davon versprach man sich die Entwicklung einer grundlegenden Motivationshaltung gegenüber den schulischen Leistungsanforderungen sowie die Stärkung des Selbstkonzeptes der „HilfsschülerInnen“. Eine kleinere Lerngruppe, ein reduzierter Lehrplan, innere Differenzierung sowie speziell ausgebildete Lehrkräfte bildeten dabei die Basis des Unterrichts im Schonraum „Hilfsschule“ (vgl. Heimlich 2003, S. 139; Heimlich 2009, S. 102; Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 27).
Knapp 20 Jahre nach Stötzners Aufruf kam es zur Gründung von „Hilfsklassen“, die zunächst als Bestandteil der Volksschulen über einen jahrgangsmäßgen Aufbau zu eigenständigen Institutionen ausgebaut werden sollten – den „Hilfschulen“. Die ersten „Hilfsklassen“ entstanden in Elberfeld (1879), Leipzig (1881) und Braunschweig (1881) (vgl. Heimlich 2009, S. 102). In der am 1. Mai 1881 in Braunschweig eingerichteten „Hilfsklasse“ ist vor allem die Arbeit von Heinrich Kielhorn hervorzuheben. Er griff mit seinem anschauungs- und handlungsorientierten Unterrichtskonzept bereits Elemente der erst noch bevorstehenden Reformpädagogik auf. Der deutsche Hilfsschulpädagoge Arno Fuchs arbeitete schließlich das Konzept der „Hilfsschule“ didaktisch und organisatorisch weiter auf. Neben einem Organisationsplan entwirft er ein Konzept der „Hilfsschulerziehung“, welches unter anderem durch Prinzipien der Anschauung, der vielfältigen Sinnesübungen und der Reduzierung der Lehrpläne sowie der Klassenfrequenz geprägt ist. Vor allem letzteres ermöglicht ein höheres Maß an Differenzierung und Individualisierung. Auch Arno Fuchs vertrat zu seiner Zeit die defizitäre Sichtweise, indem er das „Hilfsschulkind“ als krank bezeichnete und den vorliegenden „Schwachsinn“ auf eine nicht heilbare, angeborene hirnorganische Schädigung zurückführte. Aufgrund der sich manifestierten „Schwachsinnshypothese“ in den Köpfen der „Hilfsschulbefür-worterInnen“, kam es in den Folgejahren zur Verbreitung der „Hilfsschulen“ in allen deutschen Städten (vgl. Heimlich 2009, S. 103-105). Das gesellschaftliche Interesse an der Entwicklung der „Hilfsschule“ bestand vor allem in der sozialen Brauchbarmachung der Kinder und Jugendlichen. Deshalb war es vorrangiges Ziel der „HilfsschulpädagogInnen“, alle SchülerInnen zur Ausübung eines Berufs zu befähigen. Ein weiteres Anliegen der separierten Beschulung war die gesellschaftliche Integration, da ein Großteil der damaligen „HilfsschülerInnen“ - wie heute auch – aus sozial schwachen Milieus stammte (vgl. Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 28-29).
Es bleibt festzuhalten, dass bereits Stötzners Entwurf den Zwangscharakter einer Aussonderung aufweist (Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 24). Die Problematik der Separierung von SchülerInnen mit gravierenden Lernschwierigkeiten erkannten einige PädagogInnen und vor allem Eltern bereits zu Beginn der Hilfsschulentwicklung. So vertrat beispielsweise Johann Heinrich Witte die Auffassung, dass die Förderung der sogenannten „Schwachbegabten“ zu den Aufgaben der Volksschule zählt und der weitere Ausbau des „Hilfsschulwesens“ nicht zu rechtfertigen sei. In Form eines Gesamtunterrichts, in dem die Schüler fächerübergreifend tätig sein sollen, sah er die Chance für einen gemeinsamen Unterricht. Die Voraussetzung sei jedoch die Reduzierung der zu jener Zeit noch erhöhten Klassenfrequenzen. Vertreter der frühen Integrationsbewegung, wie Dalldorf, Pieper und Hinz, forderten deshalb eine grundlegende Volksschulreform sowie die sozialpädagogische Orientierung auf Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Der Berliner Widerstand gegen die Besonderung führte sogar im Jahre 1898 zur Ablehnung der Gründung neuer „Hilfsschulen“ durch den Magistrat. Zu lange Schulwege und die Stigmatisierung der Kinder gaben den Anlass, auf „Hilfsschulen“ zu verzichten und stattdessen in den Gemeindeschulen sogenannte Nebenklassen einzurichten. Diese dienten dem gleichen Ziel wie die „Nachhilfeklassen“. Obwohl die „Nebenklassen“ zahlenmäßig rasch anstiegen, entschied sich die preußische Regierung aufgrund öffentlicher Diskussionen letztlich aber für die Errichtung weiterer „Hilfsschulen“. Etwa ab 1910 wurde die „Hilfsschule“ bildungspolitisch durchgesetzt und in den Folgejahren in ganz Deutschland weiter ausgebaut (vgl. Eberwein 2008a, S 18; Ellgar-Rüttgardt 1994, S. 49; Heimlich 2009, S. 105-108 ; Reichmann-Rohr/ Weiser 1996, S. 26; Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 32f.).
Die oft als „Hochblüte der Heilpädagogik“ beschriebene Entwicklungsphase erstreckte sich über den Zeitraum von 1929 bis 1932. Durch die zunehmende Homogenisierung der Lerngruppen in „Hilfsschulen“ etablierte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Differenzierung des „Hilfsschulsystems“. So wurden beispielsweise SchülerInnen, die auch den Leistungen in der „Hilfsschule“ nicht gerecht wurden, in sogenannten Sammelklassen zusammengefasst. Trotz der durch den Weimarer Schulkompromiss eingeführtengemeinsamenvierjährigen Grundschule, wurde das „Hilfsschulwesen“ weiter ausgebaut und differenziert. Dieser Umstand verdeutlicht den fehlenden Aspekt der Förderung schulleistungsschwacher SchülerInnen in der Grundschulkonzeption der Weimarer Republik (vgl. Heimlich 2009, S. 108).
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 führte zum Abbau einiger „Hilfsschulen“, indem Einrichtungen geschlossen und Klassen zusammengefasst wurden. Die Funktion und der strukturelle Aufbau des „Hilfsschulwesens“ wurde aber grundsätzlich beibehalten. Jedoch setzte man sowohl den mit der Weimarer Republik einhergegangenen reformpädagogischen Ansätzen als auch den hilfsschulpädagogischen Bemühungen ein Ende. Das medizinisch-biologisch begründete „Schwachsinnskonzept“ schulleistungsschwacher SchülerInnen ließ sich problemlos in die nationalsozialistische Bildungs- und Gesundheitspolitik einreihen. Auf der Grundlage des „Gesetztes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ von 1933 kam es zu Zwangssterilisationen der „HilfsschülerInnen“, was eine Missachtung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit bedeutete. Die „Hilfschule“ wurde durch das Führen von Personalbögen und das Erstellen von Gutachten in die Arbeit der Erbgesundheitsgerichte mit einbezogen. Im Zusammenhang mit der Hochrüstung der Kriegswirtschaft wurden „HilfschülerInnen“ dann zunehmend unter dem Aspekt der „Brauchbarmachung“ definiert. Folglich kam der „Hilfsschule“ vermehrt die Aufgabe der Selektion zu, indem sie als Ausleseinstanz die sogenannten bildungsunfähigen Kinder ausschulte und damit teilweise der Euthanasie zuführte. Den „rassenhygienischen Maßnahmen“ und den Euthanasieprogrammen standen „HilfschulleherInnen“ teils hilflos, teils unterstützend gegenüber (Eberwein 2008a, S 19; Heimlich 2009, S. 108f.; Reichmann-Rohr/ Weiser 1996, S. 28f.; Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 36f.).
Die Nachkriegszeit war von dem Versuch gekennzeichnet, das Sonderschulwesen sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR zu restaurieren und auszubauen, um so an die vor 1933 bestandenen Verhältnisse anzuknüpfen. Vor allem in der DDR kam es zum raschen Anstieg des Bestandes an Sonderschulen, wobei „bildungsunfähige“ SchülerInnen den Anstalten zur Pflege überlassen und demnach aus dem Bildungswesen ausgeschlossen wurden (vgl. Werning/ Lütje-Klose 2006, S. 37). In den westlichen Besatzungszonen wurde 1949 der „Verband für Hilfsschulen Deutschland“ (VdHD) neu gegründet. Im Jahre 1954 wendete sich dieser mit einer „Denkschrift zu dem Ausbau des heilpädagogischen Sonderschulwesens“ an den Deutschen Städtetag und gab Impulse zum weiteren Ausbau der Sonderschulen. Dabei wurde der gemeinsame Unterricht jedoch ausdrücklich abgelehnt (vgl. Heimlich 2009, S. 110). Die in diesem Zusammenhang neu eingeführten Begriffe und Definitionen hatten die Aufgabe, das „Schwachsinnkonzept“ abzulösen, um nicht zuletzt die misanthropische Sichtweise auf die „HilfsschülerInnen“ im Nationalsozialismus zu überwinden. Jedoch wurde die zu jener Zeit praktizierte Hilfsschulmethodik und –didaktik noch immer mit den intellektuellen Defiziten der Kinder und Jugendlichen begründet (vgl. Reichmann-Rohr/ Weiser 1996, S. 29f.).
Die Grundlage für die weitere Differenzierung und den Ausbau des Sonderschulwesens bildete das in den Bundesländern durchweg akzeptierte „Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens“ der KMK von 1960. Die KMK sah die Sonderschule als Institution für Kinder und Jugendliche, die den Anforderung der allgemeinen Schule nicht genügen oder aufgrund ihrer erheblichen Leistungs- oder Verhaltensprobleme die Entwicklung ihrer MitschülerInnen gefährden (vgl. Eberwein 2008a, S. 19f.). Vor dem Hintergrund der Entlastungsfunktion der Sonderschule gegenüber der allgemeinen Schule, kann auch hier nicht von einer Orientierung auf die pädagogischen Bedürfnisse von SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten gesprochen werden. In den „Empfehlungen zur Ordnung des Sonderschulwesens“ von 1972, nahm die KMK dann ein zweites Mal Stellung zum Sonderschulwesen. In den Verlautbarungen wurden vor allem die Konzeptionen der insgesamt 10 Sonderschulformen vorgestellt. Ab diesem Zeitpunkt sprach man in der BRD von „Schulen für Lernbehinderte“, hingegen dominierte in der DDR bis zur Wende der Terminus „Hilfsschule“ (vgl. Heimlich 2009, S. 112f.). Nach Heimlich sind „Schulen für Lernbehinderte“
„[...] eigenständige Sonderschulen (neben 9 weiteren), in denen in Fortsetzung der Arbeit der ‚Hilfsschulen‘ auf der Basis eines eigenen Lehrplans Schüler/-innen mit Schulleistungsproblemen möglichst differenziert und individualisiert unterrichtet werden sollen, um sie so zu einem Schulabschluss zu führen, der ihnen den Einstieg in eine berufliche Tätigkeit und damit gesellschaftliche Integration ermöglicht.“ (Heimlich 2009, S. 112)
Der im Jahre 1970 von der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates veröffentlichte „Strukturplan für das Bildungswesen“ nahm keine Stellung zum Sonderschulwesen, sondern schlug vielmehr die Gliederung des bundesdeutschen Bildungssystems in Elementar-, Primar- und Sekundarbereich vor (vgl. Heimlich 2009, S 115). Anfang der 1970er Jahre rückte dann die Kritik an der schulischen Separation und die damit einhergehende Diskriminierungen leistungsschwacher Kinder ein weiteres Mal in den Fokus der Öffentlichkeit. In Folge der Schaffung von Gesamtschulen sowie entstandenen Elterninitiativen wie der „Lebenshilfe“, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzte, kam es erneut zu Diskussionen um die Nichtaussonderung „behinderter“ Kinder (vgl. Schnell 2003; S. 29)
[...]
[1]Dieser Begriff wurde von Stötzner geprägt. Er klinge weniger hart und abstoßend als der Name „Schule für Schwachsinnige“ (vgl. Werning/Lütje-Klose 2006, S. 24).
[2]Separation meint die Trennung einer SchülerInnengruppe, um möglichst homogene Lerngruppen zu bilden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Förderschwerpunkt Lernen?
Es handelt sich um den sonderpädagogischen Förderbedarf für Kinder und Jugendliche mit gravierenden, umfangreichen und langandauernden Lernschwierigkeiten, die die Anforderungen der Regelschule nicht erfüllen können.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration bedeutet die Eingliederung von Kindern mit Förderbedarf in bestehende Strukturen, während Inklusion eine Schule für alle anstrebt, die sich von vornherein an die Vielfalt aller Schüler anpasst.
Wie hat sich die Pädagogik bei Lernschwierigkeiten entwickelt?
Die Entwicklung verlief von der Aussonderung in „Hilfsschulen“ über die „Sonderschulen für Lernbehinderte“ bis hin zum heutigen Fokus auf gemeinsamen Unterricht in Regelschulen seit den 1970er Jahren.
Wie sieht die Situation der Inklusion in Brandenburg aus?
Brandenburg setzt auf den „Gemeinsamen Unterricht“ und hat rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, um die Integration auf Kreis- und Landesebene statistisch zu erfassen und qualitativ auszubauen.
Warum wird die Sonderschule heute oft kritisch gesehen?
Kritiker bemängeln die Stigmatisierung der Schüler durch Etikettierungsprozesse sowie die mangelnde soziale Teilhabe und fordern stattdessen ein inklusives System, das Normalität für alle herstellt.
- Citar trabajo
- Stefan Kolke (Autor), 2011, Zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Förderschwerpunkt der Lern- und Leistungsentwicklung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214570