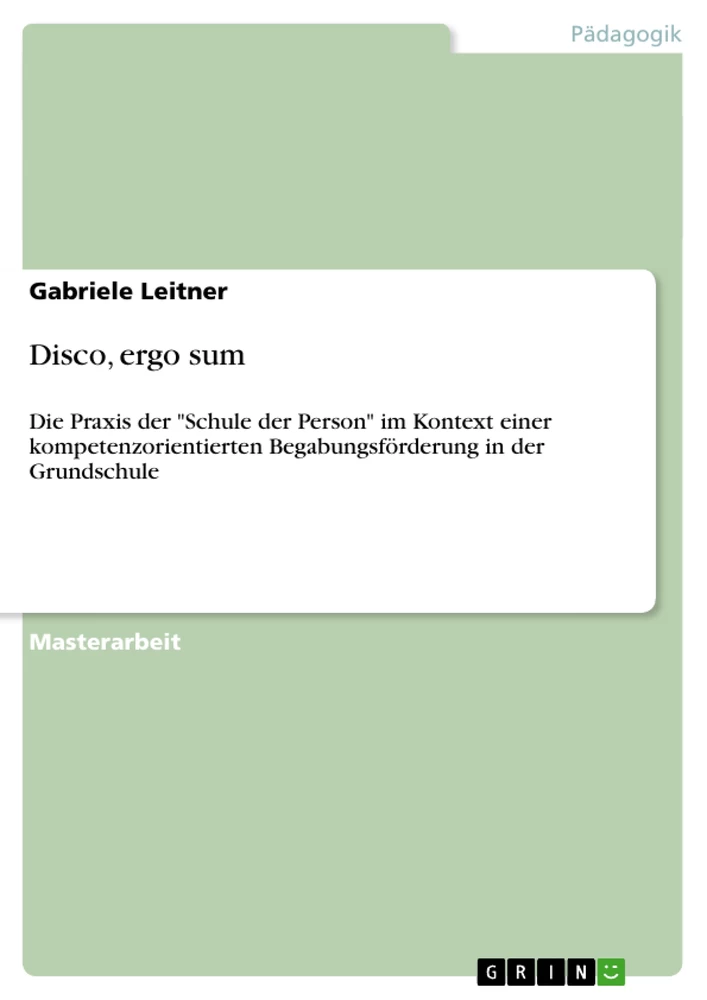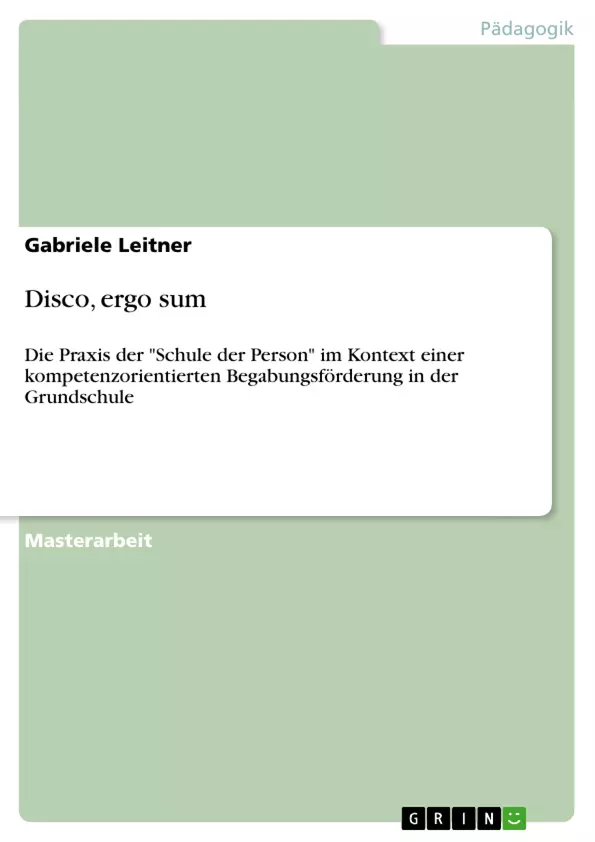Der seit einigen Jahrzehnten von verschiedenen Standpunkten aus diskutierte Bildungsbegriff unterliegt gegenwärtig im Rahmen kompetenzorientierter schulischer Konzepte mehr denn je der Frage, ob seine Verwendung noch oder wieder als zentrale Ziel- und Orientierungskategorie pädagogischer Bemühungen gelten kann.
Die Personalisierung des Unterrichts in einer „Schule der Person“ setzt zu einer eindeutigen Bejahung dieser Frage an, indem die Person des Menschen zum prinzipiellen Maß ihrer Bildung erhoben wird. Im Verständnis dieser personzentrierten Pädagogik erweist sich der Bildungsbegriff als Aufforderung, den Lernenden Gelegenheit und Raum zu geben, ihre individuellen Begabungen und Berufungen zu entdecken und ihr Handeln an diesen Zielen zu orientieren.
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen die Theorie einer „Schule der Person“ sowie die Möglichkeit ihrer Realisierung unter dem Aspekt der Kompetenzorientierung. Die Erkenntnisse aus dem Vergleich und der Analyse der Fachliteratur lassen den Schluss zu, dass eine schulische Begabungs- und Begabtenförderung, die neben Fachkompetenzen vor allem die sogenannten „soft skills“ fokussiert, eine Entwicklung der Person zu einer leistenden Persönlichkeit ermöglicht.
Die pädagogische Haltung der Lehrperson scheint in diesem Kontext als Mediator für eine Lernkompetenz zu fungieren, die den Schüler/die Schülerin zu einer aktiven, engagierten und verantwortungsvollen Lebensgestaltung anregt.
Inhalt
1. PROBLEMAUFRISS UND ZIELSTELLUNGEN
1.1 Problembeschreibung
1.2 Frage- und Zielstellungen
1.3 Ziele
1.4 Methode
2. HERMENEUTIK ALS PERSONALER BILDUNGSANSATZ
2.1 Begriffsdefinition
2.2 Hermeneutisches Verstehen
2.3 Hermeneutik in der Pädagogik
2.3.1. Handlungshermeneutik als Element einer verstehenden Bildungslehre nach Buck
2.3.2. Pädagogische Hermeneutik
2.4 Zusammenfassung
3. PERSONALES BILDUNGSVERSTÄNDNIS
3.1 Person: Begriff, Prinzip und Prozess
3.2 Pädagogik der Person
3.3 Begabung und Begabungsförderung im Licht einer personalen Pädagogik
3.4 Der Kompetenzbegriff im Licht einer personalen Pädagogik
3.5 Begabungs- und Begabtenförderung mit dem Fokus auf die Person
3.6 Zusammenfassung
4. „SCHULE DER PERSON“
4.1 Anthropologische Grundlegung der Theorie einer „Schule der Person“
4.2 Schule und Pädagogik
4.3 Geschichtliche Deduktion einer „Schule der Person“
4.4 Die funktionalen Leistungen des Personprinzips
4.4.1 Die konstitutive Funktion des Personprinzips
4.4.2 Die kritische Funktion des Personprinzips
4.4.3 Die konstruktive Funktion des Personprinzips
4.4.4 Die regulative Funktion des Personprinzips
4.5 Begabungsbegriff
4.6 Mehrdimensionale Begabungsmodelle aus der Sicht der Person
4.6.1 Das differenzierte Begabungs- und Talentmodell von Gagné
4.6.2 Das Münchner (Hoch-) Begabungsmodell von Heller, Perleth und Hany
4.6.3 Systemisches Begabungsmodell nach Wagner
4.6.4 Zusammenschau
4.7 Sprachlich - relationale Grundsätze eines begabungsfördernden Unterrichts in der „Schule der Person“
4.7.1 Umgang mit Heterogenität
4.7.2 Vertrauen und Respekt
4.8 Rational - liberale Grundsätze eines begabungsfördernden Unterrichts in einer „Schule der Person“
4.8.1 Selbstbestimmung
4.8.2 Aufforderung zur Selbsttätigkeit
4.8.3 Intrinsische Motivation
4.9 Zusammenfassung
5. KOMPETENZORIENTIERUNG
5.1 Empirische Unterrichtsforschung im Kontext der Kompetenzorientierung
5.2 Pädagogisches Handeln und Reflektieren im Kontext eines kompetenzorientierten Unterrichts
5.3 Bildungsstandards und Begabungsförderung
5.4 „Kompetente“ Begabungs- und Begabtenförderung im Verständnis einer „Schule der Person“
5.5 Fazit
6. PRAXISMODELL EINER „SCHULE DER PERSON“
6.1 Modellbeschreibung
6.2 Implizierte Schulkultur
6.3 Gelebte Schulkultur am Beispiel der wertschätzenden Kommunikation
7. RESÜMEE UND AUSBLICK
8. LITERATURVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Das Modell von Gagné
Abbildung 2: Das Modell nach Heller, Perleth und Hany
Abbildung 3: Das Modell von Wagner (2012, S. 33)
Abbildung 4: Angebots-Nutzungs- Modell der Unterrichtswirksamkeit nach Helmke
Abbildung 5: Modell „Schule der Person“
1. PROBLEMAUFRISS UND ZIELSTELLUNGEN
1.1 Problembeschreibung
Das Thema einer „Schule der Person“ befasst sich weder mit der Vorstellung eines neuen reformatorischen Schultyps noch mit dem Postulat einer privaten Unterweisung des Schulkindes, sondern mit dem pädagogischen Prinzip einer Theorie der Schule. Dieses Prinzip kann und soll im Verständnis dieser Konzeption auf einem einzigen und genuin maßgeblichen Kriterium begründet werden, nämlich dem der Person des Menschen. (vgl. Weigand 2004)
Aus dieser anthropologischen Sicht sind alle Menschen zunächst und zuerst Personen. Jeder Mensch ist aber für sich eine einmalige Person mit Begabungen. Es steht ihr frei, sich zu diesen Begabungen zu bekennen und sie verantwortungsvoll entwickeln zu wollen. Weigand (2004, S.72) erweitert den Personbegriff um eine aus pädagogischer Sicht unerlässliche Komponente, indem sie die Person sowohl als Grundlage, als auch als Entwicklung betrachtet. Sein und Werden der Person bedingen einander und erheben sich zum übergeordneten Grundsatz der Person: „… der Mensch ist immer schon ein freies, vernünftiges, sprachliches und relationales Wesen, wird es aber zugleich erst im Laufe seines Lebens“ (Weigand, 2004, S.16). Implizit enthält dieser Prozess den Bedarf der Erziehung und Bildung, da die Entwicklung der Person zu einer pädagogischen Gestaltung einladen kann. Der Personbegriff ist in diesem Verständnis dialogisch verfasst. Die jeweils einmalige Person wird am Du zum Ich. Personsein bedeutet somit Achtung vor dem anderen und seiner Würde, Autonomie, Mündigkeit, Selbstbestimmung und Verantwortung.
Erziehung und Bildung ist hier aber nicht im Sinne einer Fremdgestaltung oder Sozialisation gedacht, sondern im Verständnis einer „Selbstgestaltung der Person durch Einsicht, Wahl und Entscheidung“ (Weigand 2004, zitiert nach Augustinus). Die Person hat demnach den lebenslangen Auftrag zur Entwicklung, den sie selbst annehmen, und für den sie sich in der Beziehung mit den Mitmenschen verantworten soll. Darüber hinaus ist die Person selbst aber unverfügbar und „eigentümlich“, d.h., sie macht das Eigene zum Anspruch und Endzweck ihres Personseins.
Vor allem dieses Prinzip der „Eigentümlichkeit“ erfordert eine Betrachtungsweise von Schule und Unterricht aus der Sicht des Kindes. Schule vom Kind aus zu denken, bedeutet, die Person des Kindes als Maß und Prinzip einer pädagogischen Theorie zu statuieren, dessen Möglichkeiten und Begabungen in der pädagogischen Praxis aufzugreifen, sowie dessen Selbstachtung und Würde in den Mittelpunkt zu stellen.
Die Praxis einer „Schule der Person“ konzentriert sich aus diesem Grund abseits von Methodik und Didaktik auf den pädagogischen Aspekt der Thematik, der den Blick auf Aufgaben der Erziehung und Bildung lenkt, die nicht von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und/oder politischen Interessen bestimmt sind.
Die Umsetzung des Konzeptes einer „Schule der Person“ beginnt bei einer personalen Wahrnehmung der Akteure vor Ort. Lehr- und „Lernpersonen“ können einander nur im Feld personalisierter Lernumgebungen wahrhaft begegnen. Die Rückbesinnung auf die Personalität der Lernenden ist ein keineswegs neuer Gedanke in der Geschichte der Pädagogik. Dennoch hebt sich eine „Schule der Person“ insofern von so mancher reformpädagogischen Strömung ab, als sie mit dem Prozess der Personwerdung nicht einen „Wildwuchs“, sondern eine selbstbewusste, verantwortliche, selbstständige und persönliche Entscheidung für Bildung und Erziehung meint.
Diese Entscheidung wird im Bewusstsein der eigenen Besonderheit, die durch die Wahrnehmung, Wertschätzung und Akzentuierung der persönlichen Begabungen in den Mittelpunkt gerückt wird, ergriffen. In der Praxis des personalisierten Unterrichts stehen daher Differenzierung, Kommunikation, Interaktion, Förderung und Teilhabe im Vordergrund.
Wiederholung und Übung finden in Form von Interpretation und Reflexion statt. Daraus folgt für die einzelne Person: Bildung ist das, was mich angeht und was dazu beitragen kann, meinen sinnstiftenden Platz in der Gemeinschaft zu finden. Eine „Schule der Person“ geht somit im pädagogischen Sinn auch über das Prinzip der Individualisierung hinaus, da sie das Moment der Reliabilität der Person im gemeinsamen Miteinander und in der verantwortungsvollen Eingliederung in die Gemeinschaft berücksichtigt. Sie befindet sich daher im Zusammenhang mit der aktuellen Bildungsdiskussion im deutschsprachigen Raum in einem Spannungsfeld, das sich aus den Postulaten der Kompetenzorientierung und den damit einhergehenden Bildungsstandards sowie der Begabungs- und Begabtenförderung, die im Jahr 2009 vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in Österreich als Grundsatzerlass dargelegt wurde, zusammensetzt.
Während der Anspruch des Grundsatzerlasses der Begabungs- und Begabtenförderung die Wahrnehmung der individuellen Bedürfnisse des einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin in den Mittelpunkt stellt, lässt sich aus den Prinzipien der Bildungsstandards eine Tendenz zur Normierung und Reglementierung eben dieser Wahrnehmung erkennen.
Es wird somit ein Spagat zwischen dem inhaltlichen Rahmen des Unterrichts und der persönlichen Situation der Schüler und Schülerinnen angestrebt. Dies bedeutet, dass die Unterrichtspraxis und das Schulleben einer Polarisation unterworfen sind, da sich Lehrpersonen sowohl der Sache, d.h. den Lehr- und Lerninhalten, als auch dem Kind in seiner ganzheitlichen Wahrnehmung verpflichtet fühlen. Die Problematik der vordergründigen Unvereinbarkeit führt im Schulalltag zu einer Verunsicherung aller beteiligten Personen.
1.2 Frage- und Zielstellungen
Die vorliegende Arbeit thematisiert aktuelle Anliegen der Bildungsarbeit in der österreichischen Grundschule in Hinblick auf die Personalisierung des Unterrichts in einer „Schule der Person“.
Das übergeordnete Ziel ist die Überprüfung der Annahme, dass eine kompetenzorientierte Begabungs- und Begabtenförderung aus personalpädagogischer Sicht essentielle Bildungsmöglichkeiten für ein lebensgestaltendes Lernen eröffnet.
Zur Annäherung an die beiden Themenkomplexe „Kompetenzorientierung“ und „Begabungs- und Begabtenförderung“, sowie für die Auseinandersetzung mit ihrer Verschränkung in der Praxis einer „Schule der Person“ bedarf es einer Darlegung der Forschungsfragen, die durch die vorliegende Abhandlung führen und in deren Verlauf beantwortet werden sollen.
Die zentrale Forschungsfrage geht dem Sachverhalt nach, inwiefern das Prinzip der „ Schule der Person “ und seine praktische Umsetzung in Form eines personalisierten Unterrichts den Ansprüchen der Kompetenzorientierung und der Begabungs- und Begabtenförderung gleichermaßen entsprechen können.
In Bezug auf dieses Kernproblem ergeben sich weitere Fragen: Unter welchen pädagogischen Gesichtspunkten kann ein kompetenzorientierter Unterricht als personale Begabungsförderung gewertet werden? Des Weiteren interessiert, ob Lehrpersonen einen begabungsförderlichen Nutzen aus Bildungsstandards ziehen können.
Der gegenwärtige Stand der Grundschulforschung zeigt, dass es nicht an zahlreichen theoretischen Arbeiten mangelt, und lässt zugleich durchblicken, dass es an einer Theorie der Schule fehlt, die organisatorische aber auch inhaltliche Belange grundsätzlich regelt. Zwei große Forschungsfelder dominieren in der Bildungslandschaft der Grundschule. Da ist zunächst das breite Feld der historischen Forschung und auf der anderen Seite das relativ „unterentwickelte“ Gebiet der empirischen Forschung.
Es herrscht ein Mangel an Arbeiten zu offenen Unterrichtsformen und an allgemeinen Studien der Unterrichtswirksamkeit, die dem Grundschulbereich angemessen sind. Bislang veröffentlichte Studien bedienen sich eines eingeschränkten Qualitätsbegriffes und verfehlen teilweise die Aufgaben der Grundschule (z.B.: Sozial- und Methodenkompetenz). Eine andere Gruppe von Publikationen behandelt „theorielastige“ Empfehlungen für die Praxis. Dabei ist ein fehlender Bezug zum Fächerkanon und zur Grundschuldidaktik ersichtlich. Letztlich sind noch Veröffentlichungen zu finden, die ohne theoretische und empirische Rückversicherung Unterstützung zur Unterrichtsgestaltung anbieten. Insofern scheint besonders die Grundschule mit einer Fülle von Aufgaben bedacht zu sein, die aus dem Anspruch als Lebens-, Lern- und Aufenthaltsort resultieren, den nicht zuletzt die Gesellschaft an sie stellt. (vgl. Von Saldern, 2004, S. 923)
1.3 Ziele
„ Die Schule ist geschichtlich als eine gesellschaftliche Institution entstanden, und sie wird bis heute vorwiegend von ihren gesellschaftlichen Funktionen (Qualifikation, Sozialisation, Selektion usw.) bestimmt“ (Weigand, 2004, Vorwort). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Institution Schule im Zuge der aktuellen Standardisierungsbestrebungen auch weiterhin im Wesentlichen an einer Struktur der Ergebnismessung festhält und Begabungen hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Nutzens einschätzt.
Ausgehend von der Wahrnehmung einer weitgehend gesellschaftlichen Determiniertheit der Schule, ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, einen analytischen und kritischen Blick auf eine Institution zu werfen, deren ursprünglicher Bildungs- und Erziehungsauftrag in einem Spannungsfeld aus sozialen, bildungspolitischen und wirtschaftlichen Interessen in Vergessenheit zu geraten scheint.
Die Institution Schule war und ist seit ihrem Bestehen einem öffentlichem Interesse ausgesetzt, das einerseits auf ihre Verstaatlichung und andererseits auf die allgemeine Schulpflicht zurückzuführen ist. In jüngster Zeit sind zwei Bildungsaspekte in den Mittelpunkt der öffentlichen und fachlichen Diskussion gerückt, die den Begriff der schulischen Leistung aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten.
Der Aspekt eines kompetenzorientierten Unterrichts setzt sich mit den Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten der Lernenden auseinander, während die Begabungsforschung sowie die Begabungs- und Begabtenförderung die Entstehungsbedingungen und Fördermöglichkeiten von Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten fokussiert. Beide Strömungen implizieren die Möglichkeit und Gelegenheit einer Abkoppelung der Bildungs- und Erziehungsaufgabe aus dem unterrichtlichen Kontext, wenn der Lernende/die Lernende als „Zielobjekt“ ihrer Bestrebungen betrachtet wird.
Trotzdem oder gerade deshalb ist es die Intention dieser Arbeit, Wege aufzuzeigen, die es ermöglichen, auf der Mikroebene den Aspekt einer genuinen Bildung und Erziehung der „Lernperson“ in den Mittelpunkt des pädagogischen Interesses zu stellen. Es handelt sich hierbei um das Auffinden einer Schnittmenge aus den Anforderungen, die sowohl die Begabungs- und Begabtenförderung als auch der kompetenzorientierte Unterricht an die Schule stellen, sowie um die Möglichkeiten der Umsetzung dieser Anforderungen in der Praxis des Schulalltages. Eine personzentrierte Umsetzung äußert sich in einer Umgestaltung des Lernens. Einerseits soll eine Konzentration auf wichtige Grundlagen des Wissens stattfinden, diese soll aber mit dem Blick auf jede einzelne Person erfolgen.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist der Versuch, zu einer Verringerung der Verunsicherung zahlreicher Lehrpersonen beizutragen, die befürchten, dass die Qualität oder der Ertrag des Unterrichts leidet, wenn sie ihrem professionellen Handeln pädagogische Prinzipien zugrunde legen und im Dienst der Person handeln.
Intendiert wird ebenso, eine pädagogische Haltung darzustellen, die es Lehrpersonen ermöglicht, gelassen und professionell zu reagieren, wenn es um Standardisierungen des Wissens geht. Die Normierung eines fundamentalen Wissens, dessen Erreichung für alle Schüler und Schülerinnen vorgeschrieben ist, rüttelt nicht an den Grundfesten einer pädagogischen Ausrichtung des Unterrichts, sondern kann diese untermauern.
1.4 Methode
Als Methode wird in Form einer vergleichenden Literaturarbeit der geisteswissenschaftliche Ansatz gewählt. Eine einführende Beschreibung der hermeneutischen Methode soll den für das Thema der Arbeit relevanten Vorgang des Verstehens und Interpretierens erläutern. Insbesondere soll dabei auf den Zusammenhang zwischen Handlungshermeneutik und Bildung eingegangen werden. (vgl. Buck, 1981)
In einem ersten Schritt wird die Theorie der „Schule der Person“ nach Gabriele Weigand unter dem Aspekt des anthropologischen Prinzips einer pädagogisch begründeten Begabungs- und Begabtenförderung dargelegt. Anschließend werden Begrifflichkeiten wie „Person“, „Begabung“, „Kompetenzen“ oder „Bildungsstandards“ aus pädagogischer Sicht basierend auf einer Literaturanalyse untersucht und definiert.
In der Folge soll anhand mehrdimensionaler Begabungsmodelle und der Ergebnisse aus der empirischen Unterrichtsforschung ein pädagogisch bedingter Zusammenhang zwischen den Postulaten der Kompetenzorientierung und einer personalen Begabungs- und Begabtenförderung herausgearbeitet werden.
Ein zweiter Schritt soll eine Umsetzung der theoretischen Konzeption einer „Schule der Person“ in die Praxis der Personalisierung des Unterrichts darlegen, wobei insbesondere Möglichkeiten einer gleichwertigen Berücksichtigung von Basiswissen, Kompetenzwahrnehmung bzw. -aufbau sowie Interessensschwerpunkten und deren Behandlung und Vertiefung in Eigenregie aufgezeigt werden sollen.
2. HERMENEUTIK ALS PERSONALER BILDUNGSANSATZ
Dieser Abschnitt ist einer einführenden Beschreibung der hermeneutischen Methode gewidmet. Die Bestimmung und Explikation dieses geisteswissenschaftlichen Ansatzes im Zuge der anschließenden vergleichenden Literaturstudien stellt per se schon einen hermeneutischen Prozess dar, in dessen Verlauf ein Erkenntniszuwachs und an dessen Ende ein persönliches Verständnis angestrebt wird.
Indem die hermeneutische Methode angewandt wird, vollzieht sich dieser Auslegungshergang sowohl auf Seiten der Verfasserin als auch auf Seiten des Lesepublikums der vorliegenden Arbeit. Hierbei tritt das Grundprinzip jeglicher Auslegung, nämlich die Erklärung von mit gemeintem, aber nicht ausdrücklich gesagtem Sinn in Kraft: „ Denn der Grundzug aller Auslegung,…, ist ausdrückliche Wiederholung und Aneignung von solchem, was in der zu interpretierenden Praxis - auch der Praxis sprachlicher Art - unausdrücklich mitgeleistet ist“ (Buck, 1981, S. 27).
2.1 Begriffsdefinition
Der Begriff der Hermeneutik unterliegt vielfältigen Definitionen und leitet seinen Ursprung aus dem griechischen Wort „hermeneuo“ ab, welchem prinzipiell drei Bedeutungen zugewiesen werden können: etwas aussagen oder reden, etwas Gesagtes auslegen, erklären und interpretieren und etwas Gesagtes in eine andere Sprache übersetzen. (vgl. Seiffert, 1992, S.9)
Als „Urform“ der Hermeneutik im Verständnis einer „Kunst der Auslegung“ kann die Textinterpretation bezeichnet werden, aber Hermeneutik geht über eine bisweilen regelhafte Textinterpretation hinaus. Unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten Zielstellungen dieser Arbeit ist es durchaus relevant, zu bemerken, dass vor allem Gadamer als Vertreter einer Hermeneutik des „Verstehensgeschehens“ (Grondin) die „Tugend des Hörenkönnens, des Gesprächs und der gemeinsamen Wahrheitssuche“ (Grondin, 1997, Vorwort IX) betont.
Hermeneutik beschäftigt sich mit menschlichen Werken, die sowohl als Handlungen, als auch als sprachliche sowie nichtsprachliche Schöpfungen vorliegen können. Ihr Forschungsobjekt ist somit alles Menschliche, das als beständiges und ausdrücklich gezeigtes oder gestaltetes „Lebenszeichen“ wahrgenommen werden kann. Der Begriff des Verstehens stellt den Dreh- und Angelpunkt der Hermeneutik dar: „ Als terminus technicus meint es das Erfassen (1.) von etwas (2.) als etwas Menschliches und (3.) von dessen Bedeutung“ (Danner, 2006, S. 72). Letztendlich geht es um das Verstehen eines Sinns auf der Grundlage eines Rückgriffes auf Zusammenhänge innerhalb eines Ganzen. Verstehen wird in einfaches, weil direktes, und in komplexes, weil indirektes, Verstehen gegliedert.
Das Erfassen einzelner Systeme führt zur Herstellung von Zusammenhängen, die sowohl den einzelnen Menschen mit ihren Bedürfnissen und Verhältnissen als auch allgemein humanen Bedingungen entsprechen.
So ist auch der „objektive Geist“ zu verstehen, der „ein Gemeinsames darstellt, an dem die einzelnen Subjekte teilhaben“ (ebd.). Damit ist aber nicht gemeint, dass Tätigkeiten für andere bestimmt sind, sondern sie für uns dadurch Sinn ergeben, dass sie im sozialen Kontext als sinnvoll aufbereitet und erachtet werden. Die Sinnhaftigkeit einer Handlung hängt aber nicht primär von der sozialen Zustimmung der Umwelt, sondern von der Übereinstimmung aller Beteiligten ab. Sie betrachten eine Tätigkeit als (an)erkannte Option innerhalb eines gemeinsamen „Spielraumes“. Das Verbindende und Verbindliche des „objektiven Geistes“ ist letztlich eingebettet in seinen kulturellen und geschichtlichen Rahmen.
2.2 Hermeneutisches Verstehen
Die Anwendung der hermeneutischen Methode war und ist stets begleitet von der Sorge, sie könnte einem wissenschaftlichen Wahrheitsanspruch nicht genügen. Tatsächlich kann hermeneutisches Verstehen nicht als allgemein gültig betrachtet werden, wenn man es dabei mit dem Siegel einer Überprüfbarkeit ausstatten möchte, die allen allzeit zugänglich ist.
Hermeneutisches Verstehen erschöpft sich aber auch nicht in einer eigenmächtigen subjektiven Haltung, sondern erreicht seine strenge Sachlichkeit dadurch, dass die Erkenntnis ihrem Objekt angemessen ist. Eine dem Wesen der Hermeneutik entsprechende Subjektivität ist dabei aber als Voraussetzung des Verstehens sogar notwendig. Regeln und Normen der Hermeneutik sollen dem oder der Auslegenden als Hilfsmittel dienen und sollen nicht zu einer starren Methodik führen. (vgl. Danner, 2006, S. 72/73).
Es ist davon auszugehen, dass die hermeneutische Methode bereits implizit im Prozess der Auslegung und des Verstehens angelegt ist und somit nicht nur die Geisteswissenschaften, sondern vor allem auch die menschliche Existenz durchdringt: „Interpretation erscheint damit immer stärker als Wesensmerkmal unserer Welterfahrung“ (Grondin, 2009, S.11).
Hermeneutisches höheres Verstehen vollzieht sich spiralförmig im sogenannten hermeneutischen Zirkel. Partielles Verstehen kann zu umfassendem, vorgefasstes zu weiterführendem und theoretisches zu praktischem Verstehen führen. Der hermeneutische Zirkel ist kein „Teufelskreis“ und ebenso wenig die Ansammlung verschiedener Bestandteile. Es geht darum, den Unterschied, der zwischen dem, der verstehen will und dem, was es zu verstehen gibt, zu verringern oder gar zu überbrücken. Hierbei richtet sich das Bestreben des Interpreten oder der Interpretin aber darauf, einen Gegenstand anders, also unter veränderter Perspektive, zu verstehen anstatt ihn „besser“ verstehen zu wollen. (vgl. Danner, 2006, S. 72/73)
Es ist im Verständnis des hermeneutischen Zirkels ersichtlich, dass der Prozess des Verstehens nicht mit einem „unbeschriebenen Blatt“ beginnen kann und darf, da die Vorurteile bzw. das Vorwissen des Interpreten/der Interpretin sowie sein/ihr geschichtlicher und biographischer Hintergrund nicht ausgelöscht werden können. Folglich scheint der Vorgang des Verstehens von einem Gefüge der Erwartung durchdrungen zu sein, die nicht verleugnet werden soll. Die hermeneutische Auslegung ist insofern dazu aufgerufen, sich selbst fortwährend und prüfend zu „beäugen“ (Grondin, 2009, S.42). Somit scheint eine reflexive Auseinandersetzung mit dem eigenen Erkenntnis- oder Lernprozess „vorprogrammiert“.
Seiffert (1992) bekräftigt Grondins Darstellung des hermeneutischen Zirkels, indem er in Bezug auf das Vorwissen den Aspekt der Volition ins Spiel bringt. Das Vorwissen über einen Gegenstand bedingt den Willen zu dessen Untersuchung: „Wir müssen schon etwas wissen - andererseits aber auch wissen, daß wir noch nicht alles wissen“ (S. 211). Der Autor bezieht sich somit allem Anschein nach auf den Begriff des Problembewusstseins, welches dem Prozess des Lernens vorgelagert ist.
2.3 Hermeneutik in der Pädagogik
Der Zusammenhang zwischen Hermeneutik und personaler Bildung wird in den Werken der Autoren Buck (1981) und Danner (2006) ausführlich behandelt. Buck (1981) nimmt bereits im Prozess der hermeneutischen Erfahrung ein Bildungsgeschehen der Person wahr. Dieses Bildungsgeschehen ist insofern „einfach“ zu verstehen, da es ursprünglich in lebenspraktischen Handlungen verankert, und letztlich auf das praktische Leben ausgerichtet ist. Buck setzt Pädagogik mit einer besonderen Form der Hermeneutik gleich, die pädagogische Handlungsbereiche und Aufgabengebiete beleuchten und somit den Weg für die Empirie ebnen kann (S.149). Der hermeneutische Einfluss auf die pädagogische Praxis ist folglich beachtenswert. Eine hermeneutische Pädagogik, deren zentrale Elemente handlungs- und reflexionsorientiert sind, bedingt die Ausbildung der Identität der lernenden Person.
Geglückte Bildung hat aber nichts mit der Hervorbringung eines - wenn auch hochqualifizierten - Typus zu tun, dessen Identität ein allgemeiner Konsens zugrunde liegt. Die im Menschen angelegte persönliche Identität wird von Buck zwar als Faktum bezeichnet, bedarf aber dennoch der weiteren Bildung. Buck fügt deshalb dem Begriff der individuellen Identität jenen der lebensgeschichtlichen hinzu.
Weigand (2004) spricht sich ebenfalls für den Menschen als Subjekt der Pädagogik aus. Das Prinzip der Bildung liegt im Menschen selbst und bedarf einer Weiterentwicklung, die ihn aber nicht zum Objekt pädagogischer und schulischer Überlegungen und Handlungen „degradiert“(S. 343). Insofern ist es denkbar, dass auch die Institution Schule an der Ausbildung einer personalen sowie praktischen Identität mitarbeiten kann, ohne ihre gesellschaftliche Rolle allzu sehr in den Vordergrund zu stellen. Allerdings weist Buck (1981) darauf hin, dass Bildung im Verständnis eines „individuellen Selbstseins“ (S. 149) nicht durch Unterricht herstellbar ist (ebd.).
Die aus den Ansätzen einer hermeneutischen Pädagogik entwickelte „verstehende Bildungslehre“ Bucks enthält als zentrales Element jenes der Handlungshermeneutik im Hinblick auf die Ausprägung einer praktisch-personalen Identität.
2.3.1. Handlungshermeneutik als Element einer verstehenden Bildungslehre nach Buck
In jedem menschlichen Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn vollzieht sich ein hermeneutischer Prozess, indem relativ Neues aufgenommen und verstanden wird. Mit dieser Darlegung verweist Buck auf den engen Zusammenhang zwischen hermeneutischer Methode und Lernen im engeren Sinne bzw. zwischen Hermeneutik und Bildung im universellen Sinn.
Persönlich relevantes Erkennen und Lernen vollzieht sich über das Tun. Handlung stellt eine unbewusste Leistung dar. Aus und in der Handlung ergibt sich für die handelnde Person Sinn, der für sie zunächst nicht offensichtlich ist.
Für den Autor bedeutet die Methode der Handlungshermeneutik den Ausdruck dieses Sinns durch fortwährende Wiederholungen und Reflexionen. Nur so kann man seines Erachtens diesen unbewussten Sinn in das Bewusstsein rücken. Durch die Beobachtung und Beschreibung einer Handlung wiederholt man die Perspektive des Handelnden und führt durch Reflexion der Tätigkeit den Handelnden sowie den Beobachter zur Erkenntnis. Absicht, Zwecke und Motive der handelnden Person schwingen in der Ausführung von Maßnahmen und Tätigkeiten mit. (vgl. Buck, 1982, S. 24 - 35)
Aus diesen Überlegungen wird ersichtlich, dass Bildung in ihrer personalen Bedeutung ein dynamischer und höchst „privater“ Prozess ist, der sich lebenslang weiterentwickelt und dem heutigen Begriff „life long learning“ nahe kommt: „Die Vollendung der Bildung, die Gebildetheit des Gebildeten, besteht in Wahrheit darin, daß einer nicht fertig und angekommen ist, sondern offen bleibt für neue Erfahrung und Selbsterfahrung“ (ebd., S. 35). Allem Anschein nach setzt der Autor Hermeneutik mit Bildung gleich, wenn Handlung und Praxis im Vordergrund stehen, und Wiederholung und Übung dieser Praxis in Form von Interpretation und Reflexion stattfinden. Daraus folgt für die einzelne Person: Bildung ist das, was sie betrifft und bewegt.
2.3.2. Pädagogische Hermeneutik
Danner (2006) bekräftigt Bucks Argumentation im Rahmen einer pädagogischen Hermeneutik. Schule und Unterricht bezeichnet er als „institutionalisierte Erziehungswirklichkeit“. Generell ist eine Erziehungswirklichkeit nicht losgelöst von sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Umständen zu betrachten und bedarf im Rahmen ihrer Abhängigkeit von diesen Gegebenheiten einer hermeneutischen Abklärung.
Das Verstehen dieser Erziehungswirklichkeit führt auf der theoretischen Ebene zur Entwicklung neuer lösungsorientierter Theorien und auf der praktischen Ebene zu einer offenen Haltung des Pädagogen oder der Pädagogin. Dabei unterscheidet der Autor einzelne die Pädagogik kennzeichnende Elemente, die ein Verstehen nahezu herausfordern. Dazu gehören unter anderem die Einzigartigkeit aller an der Erziehung Partizipierender und der Sinn und die Bedeutung aller pädagogischen Situationen, Umstände, Überlegungen und Handlungen bis hin zum allgemeinen Sinn der Pädagogik, der eine Selbst- und Welterkenntnis nach sich zieht.
Darin inbegriffen sind insbesondere der Begriff der pädagogischen Verantwortung als „Motor“ des hermeneutischen Verstehens sowie pädagogische Ziele mit ihren maßgeblichen Normen und Werten. Somit ist es notwendig, sowohl die Einzigartigkeit als auch die jeweils altersbedingte Eigenwelt der Heranwachsenden zu interpretieren und zu verstehen (ebd., S. 119/120). Der Autor verweist in diesem Zusammenhang auf Gadamer, der in Hinblick auf verschiedene Fach-Hermeneutiken den Begriff der Applikation verwendet. Pädagogische Hermeneutik wird daher unter dem Gesichtspunkt ihrer Anwendung gesehen und sowohl im theoretischen als auch praktischen Sinn ihrer Bestimmung zugeführt. Das Verstehen des Pädagogen/der Pädagogin wird als relativ- intentional betrachtet und bedingt seine/ihre Haltung: „Alles, was ihm an Schriftlichem, konkreten Situationen oder gesellschaftlich-politischen Gegebenheiten begegnet, legt er aus im Hinblick auf Erziehung und Bildung. Diese machen den Kern seines Verstehens aus“ (Danner, 2006, S. 98).
Dabei kommt dem erzieherischen Verhältnis eine große Bedeutung zu. Entscheidet es doch über die Qualität menschlicher Beziehungen, deren Ausmaß und Güte nur verstehend entschlüsselt werden können (ebd., S. 120).
2.4 Zusammenfassung
Ursprünglich geht die Hermeneutik als „Kunst der Auslegung“ von der Textinterpretation aus. Darüber hinaus stehen menschliche Produkte, die sich in Handlungen oder schöpferischen Akten erkennen lassen, im Mittelpunkt des hermeneutischen Interesses. Dabei ist der Begriff des Verstehens als zentral anzusehen. In erster Linie handelt es sich um das Verstehen zusammenhängender Prinzipien, um ein sogenanntes „höheres Verstehen“. Ein gemeinsamer Konsens im Rahmen eines höheren Verstehens kann im Wirkungsbereich eines kulturellen und historischen Milieus gelingen, welches die Rahmenbedingungen für ein „kollektives Verstehen“ darstellt.
Der Ausgangspunkt der hermeneutischen Methode ist in einer - als gegeben angenommenen - Subjektivität begründet. Indem sich das Versehen der einzelnen Person an dem zu verstehenden Gegenstand orientiert und misst, führt dieser Vorgang letztendlich zu wissenschaftlicher Relevanz und Objektivität. Die gegenwärtige hermeneutische Methode stellt den Anspruch, menschliches Verstehen wissenschaftlich zu erhellen.
Hermeneutisches Verstehen findet in Form einer Spirale, im sogenannten „hermeneutischen Zirkel“, statt: Das Verstehen eines Teilbereiches kann zu generellem Verstehen führen. Primäres Verstehen kann in fortgeschrittenes Verstehen münden. Das Verständnis der Theorie kann ein Verständnis in der Praxis nach sich ziehen.
Im Sinne einer hermeneutischen Pädagogik der Person darf der Vergleich der gebildeten Person mit der Allgemeinheit im Verständnis eines „objektiven Geistes“ (Danner) nicht zu einer generalisierten Bildung führen.
Die Ausbildung der lebensgeschichtlichen Identität einer Person vollzieht sich über sprachliche und nichtsprachliche Handlungen. Die Person kann im Rückblick auf ihre Handlungen einen Sinn erkennen.
Insofern wird der praktische Aspekt einer Handlungshermeneutik im Rahmen einer „Erziehungswirklichkeit“ (Danner) unterstrichen. Unter anderem führt er eine offene pädagogische Haltung auf das Verstehen dieser „Erziehungswirklichkeit“ zurück. Insbesondere pädagogische Ziele und pädagogische Verantwortung fungieren als Antrieb eines hermeneutischen Verstehens in der Erziehungswirklichkeit. Das Ziel ist die verstehende Entschlüsselung situativer Sachverhalte.
Prinzipiell ist somit der Aspekt der Anwendung als ausschlaggebend für eine pädagogische Hermeneutik anzusehen. Das erzieherische Verhältnis entscheidet dabei über die Güte menschlicher Relationen, die nur auf hermeneutischem Weg erschlossen werden kann.
3. PERSONALES BILDUNGSVERSTÄNDNIS
3.1 Person: Begriff, Prinzip und Prozess
Im vorangegangenen Kapitel wurde im Zuge der hermeneutischen Betrachtung des Bildungsbegriffes ein enger Zusammenhang mit einem Menschenbild aufgezeigt, welches den Homo sapiens nicht nur im wörtlichen Sinn als „wissend“ und „vernunftbegabt“ bezeichnet, sondern darüber hinaus den Prozess der Bildung als existenziellen Motor der persönlichen Lebensgestaltung betrachtet. Das hierbei dargelegte Bildungsverständnis impliziert, dass sich Bildung in und mit der Person vollzieht und diese sich in der Entwicklung ihrer eigenen Bildung selbst erlebt.
Um besagtes personales Bildungsverständnis eingehender zu erschließen, bedarf es einer näheren Erläuterung des Begriffes der Person. Der lateinische Begriff „persona“ bedeutete zunächst die Maske des Schauspielers im griechischen Theater. Das Gesicht des Schauspielers hinter der Maske war nicht zu sehen. Ebenso ist das, was gegenwärtig als Person bezeichnet wird, nicht direkt sichtbar, sondern erschließt sich erst im Handeln des Menschen. Im psychologisch-pädagogischen Sinn wird unter dem Begriff der Person das „Unbedingte im Menschen“ (Waibel, 2008) verstanden, das nicht auf äußere Umstände zurückzuführen ist: „Man könnte auch sagen, Person kennzeichnet das Wesen, das Geistige des Menschen, das je Eigene“ (ebd., S. 18).
Person ist demnach der einzelne Mensch in seiner Unverwechselbarkeit. In der Person ist all ihre Potentialität festgemacht. Sie entscheidet darüber, was realisiert wird und was nicht: „Person ist daher das, was sich gegenüberstehen, distanzieren, auseinandersetzen und entscheiden kann“ (ebd.). Die Person des Menschen besitzt somit die Freiheit, sich zu verändern und zu entwickeln und ist dafür sich selbst gegenüber verantwortlich. Sie findet ihren Ausdruck über den Körper, die Psyche und den Verstand. Es kommt dadurch zu einer Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt. Indem die Person aussucht, was für sie als passend und relevant in Erscheinung tritt, setzt sie sich in Richtung eines sinnvollen Lebens in Bewegung. (vgl. Waibel, 2008, S. 17/18)
Diesbezüglich ist aber - speziell im pädagogischen Verständnis - festzuhalten, dass sich der Begriff der Person von jenem des Individuums unterscheidet. Der Mensch als Individuum wird zwar als Einzelwesen in seiner jeweiligen Besonderheit wahrgenommen, entbehrt aber einer Sichtweise, die ihn als ein in Beziehung stehendes Wesen erkennt.
Ausgehend von einer Bildungsauffassung, die die „Lernperson“ in das Zentrum rückt, scheint personale Bildung in Anlehnung an obige Definition des Personbegriffs etwas „Eigenes“ als Ausdruck eines persönlichen Eigentums zu explizieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich in dieser Äußerung das elementare Charakteristikum der Person an sich offenbart. Dabei handelt es sich um die Eigentümlichkeit der Person. Diese zeichnet den Menschen als Person aus: „Der Mensch ist (…) immer schon Person, er kann sein Personsein nicht erst ‚lernen‘ oder gar in seinem Leben erst irgendwann erwerben, noch kann es ihm beigebracht oder eingesetzt werden“ (Böhm, 1995, S.120). Aus diesem anthropologischen Verständnis heraus sind alle Menschen zunächst und zuerst Personen.
Laut Weigand (2004) vollzieht sich der Hergang des Werdens der Person nach einer aus dem Sein begründeten Vorgabe, d.h., dass die Richtlinien des Werdeganges des Menschen als Person nicht von ihm selbst festgelegt, sondern in seinem Wesen als solches bereits verankert sind. (vgl. S. 72 - 73) Daraus ergibt sich für den Prozess der Personwerdung ein paradoxer Auftrag an den Menschen: „Werde der du bist!“ (Buck, 1981, S. 153).
Die Person des Menschen kann aber nicht als unfrei oder fatalistisch bezeichnet werden, da sie sich für diesen Auftrag bewusst entscheiden kann. Weigand (2004) sagt in ihrer Definition der Person in Anlehnung an Böhm „…, dass der Mensch als Person ein freies, vernünftiges und sprachliches Subjekt und - (…) -ein wesentlich relationales Wesen ist“ (S. 16).
In Bezug auf den relationalen Aspekt der Person verweist Benner (2011) auf Humboldt und stellt dar, dass personale Bildung letztlich auf dieses sinnstiftende Spannungsfeld zwischen Innen- und Außenwelt zurückzuführen ist: „Bildung…ist, …, auf mannigfaltige, freie und rege Wechselwirkungen zwischen selbst- und weltbildenden Tätigkeiten angewiesen“ (S. 17). Auch in diesem Bild der reziproken Beziehungen zu Innen- und Außenwelt zeigt sich eine Dimension der Statik und Dynamik des Personbegriffes nach Weigand. Insofern beinhaltet die lebenslange Möglichkeit des Personseins, eine Wahlfreiheit des Menschen, dem es freigestellt ist, als „ Autor seiner selbst“ (Weigand, 2004) und in der Relation zur Welt, sein Leben verantwortungsvoll zu führen (S. 17). Folglich kann sich die Person zu einem persönlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag entscheiden, den sie aber in sozialer Beziehung stehend erfüllen muss. Hier entpuppt sich das Werden der Person als tätiger und kreativer Akt, der die „ Aktuierung der Person“ (Weigand, 2004, S. 75) zum Ziel hat. Prinzip und Prozess der Person überschneiden sich zum jeweils aktuellen Zeitpunkt, wobei der Prozess der Personwerdung weiterhin besteht (ebd.).
Böhm (2000) weist im Sinne des Weigandschen Bildungsverständnisses darauf hin „…, dass Bildung prinzipiell gerade das meint, was nicht verlorengehen darf, wenn Menschsein seinen humanen Charakter bewahren soll: die aller Planung und Machbarkeit entzogene Selbstbestimmung der Person“ (S. 91).
[...]
- Citation du texte
- Gabriele Leitner (Auteur), 2012, Disco, ergo sum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214661