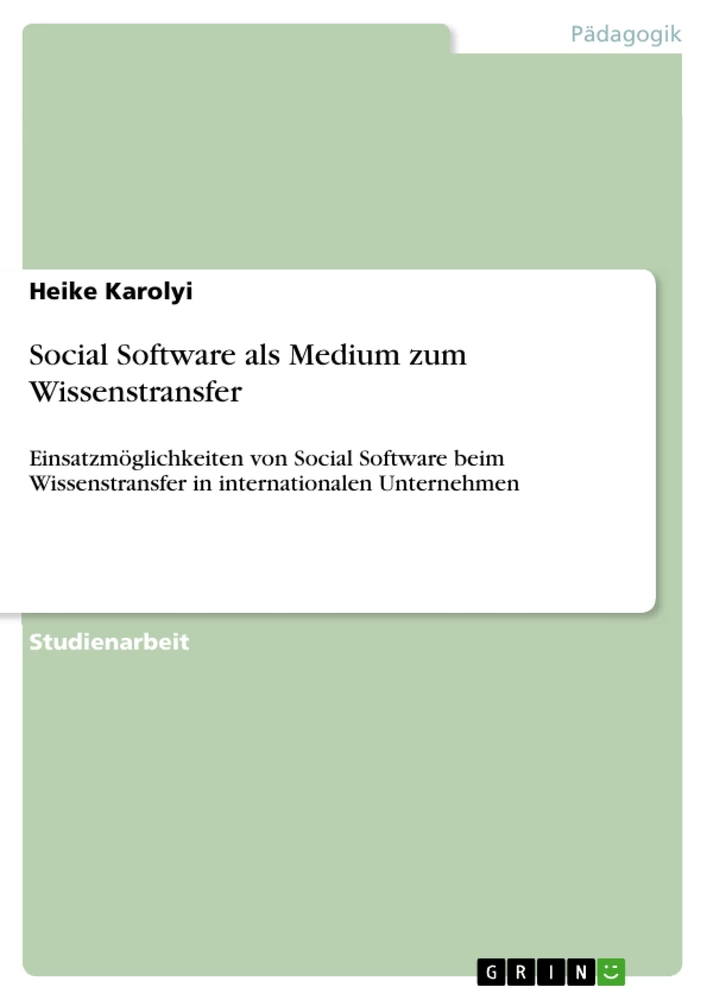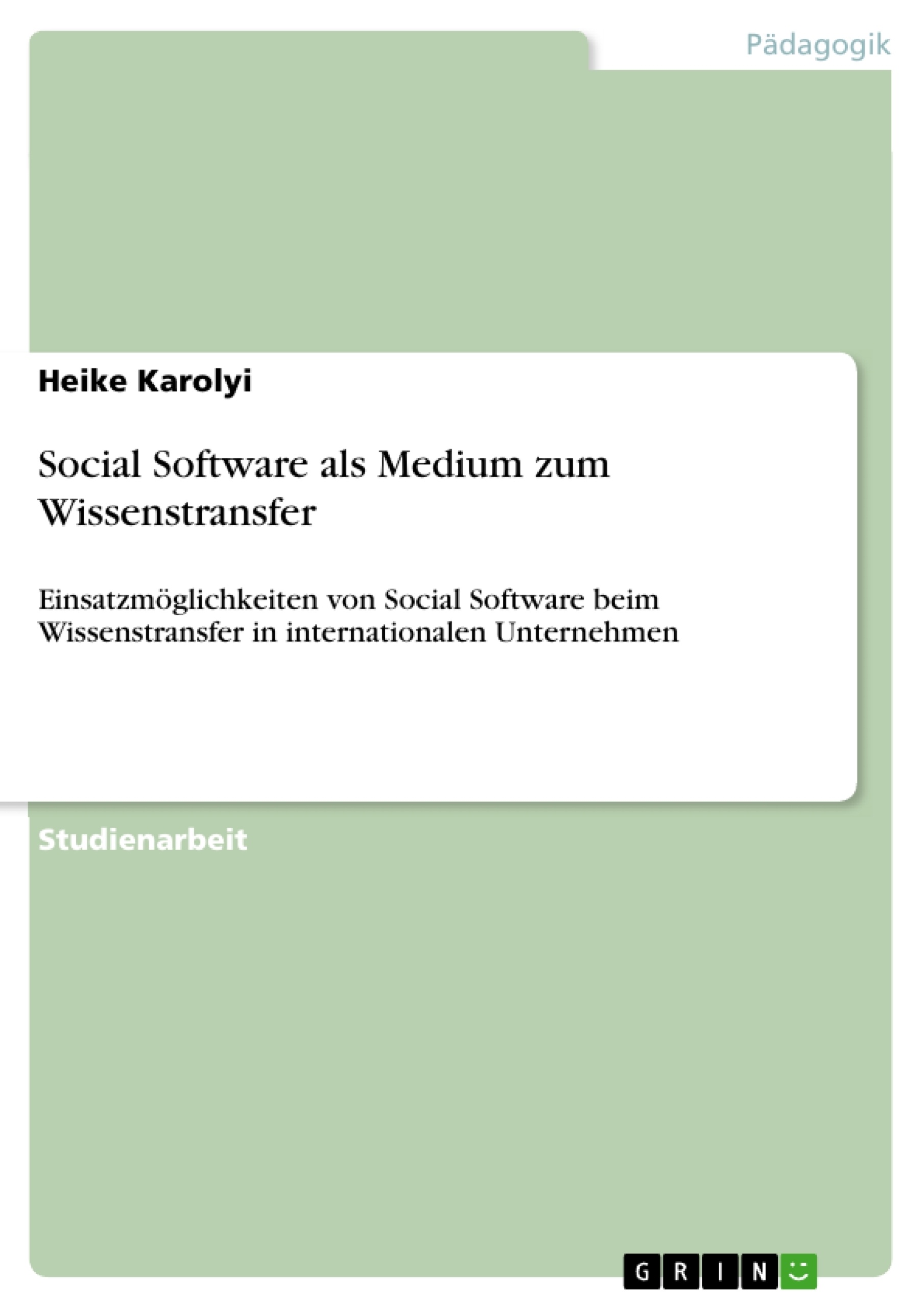Die vorliegende Arbeit beschreibt anhand der aktuellen Literatur den Begriff und Prozess des Wissenstransfers. Im folgenden Abschnitt werden zu Zwecken der Anschaulichkeit die Rahmenbedingungen eines internationalen Unternehmens erläutert. Als Medium für den Wissenstransfer stehen in dieser Arbeit die Anwendungen des Web 2.0 im Fokus.
Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung
2 Wissenstransfer und Wissensaustausch
3 Handlungsort internationales Unternehmen
4 Social Software
4.1 Weblogs
4.2 Wikis
4.3 Podcasts
4.4 Feedreader
4.5 Social Networking Sites
4.6 e-Portfolio
5 Motivation und Barrieren beim Wissenstransfer mit Social Software in internationalen Unternehmen
5.1 Literaturstudie Motivation und Barrieren
5.2 Motivation der Akteure in Anlehnung an Maslow
5.3 Barrieren, Nachteile, Grenzen, Probleme, Herausforderungen
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist Social Software im Kontext des Wissensmanagements?
Social Software umfasst Web 2.0 Anwendungen wie Wikis, Blogs und soziale Netzwerke, die den Austausch und Transfer von Wissen zwischen Individuen in Organisationen unterstützen.
Wie unterstützen Wikis den Wissenstransfer in Unternehmen?
Wikis ermöglichen das kollaborative Erstellen und Bearbeiten von Inhalten, wodurch implizites Wissen explizit gemacht und für alle Mitarbeiter zugänglich gespeichert werden kann.
Welche Barrieren gibt es beim Einsatz von Social Software?
Häufige Barrieren sind mangelndes Vertrauen, Angst vor Wissensverlust (Wissen als Macht), technische Hürden oder eine Unternehmenskultur, die Fehlertoleranz nicht fördert.
Welche Rolle spielen Weblogs für den Wissensaustausch?
Weblogs dienen oft als persönliche Wissensjournale, in denen Experten Erfahrungen teilen und durch Kommentare in einen direkten Dialog mit Kollegen treten können.
Wie lässt sich die Motivation zur Wissenspreisgabe erklären?
In Anlehnung an Maslow können soziale Bedürfnisse, Anerkennung und Selbstverwirklichung starke Motivatoren sein, Wissen über Social Software Plattformen zu teilen.
- Quote paper
- Heike Karolyi (Author), 2012, Social Software als Medium zum Wissenstransfer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214870