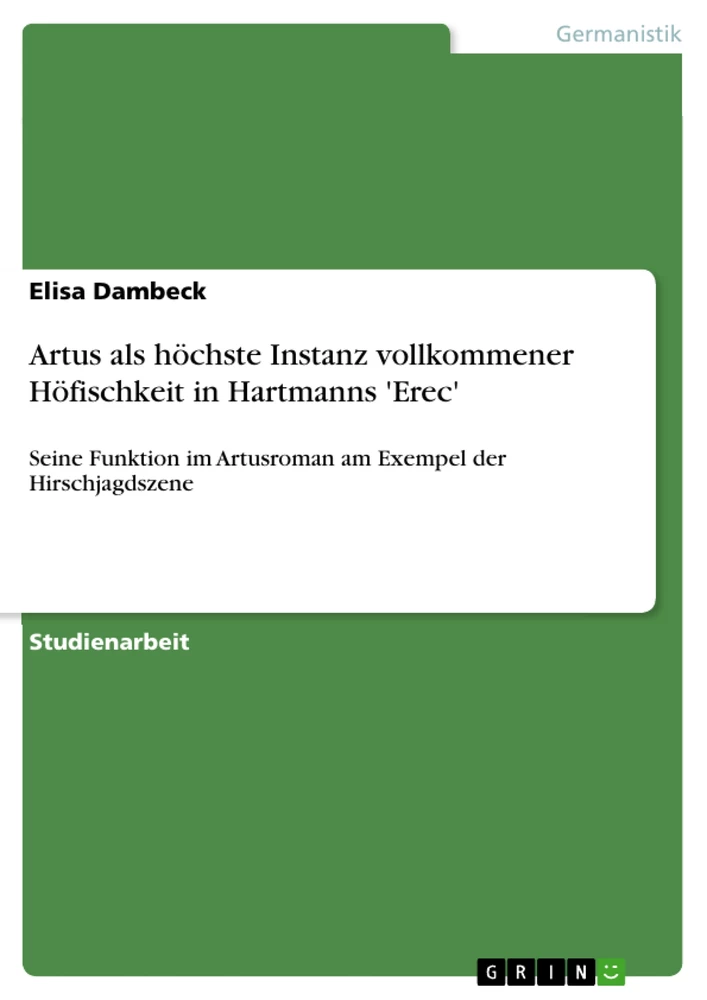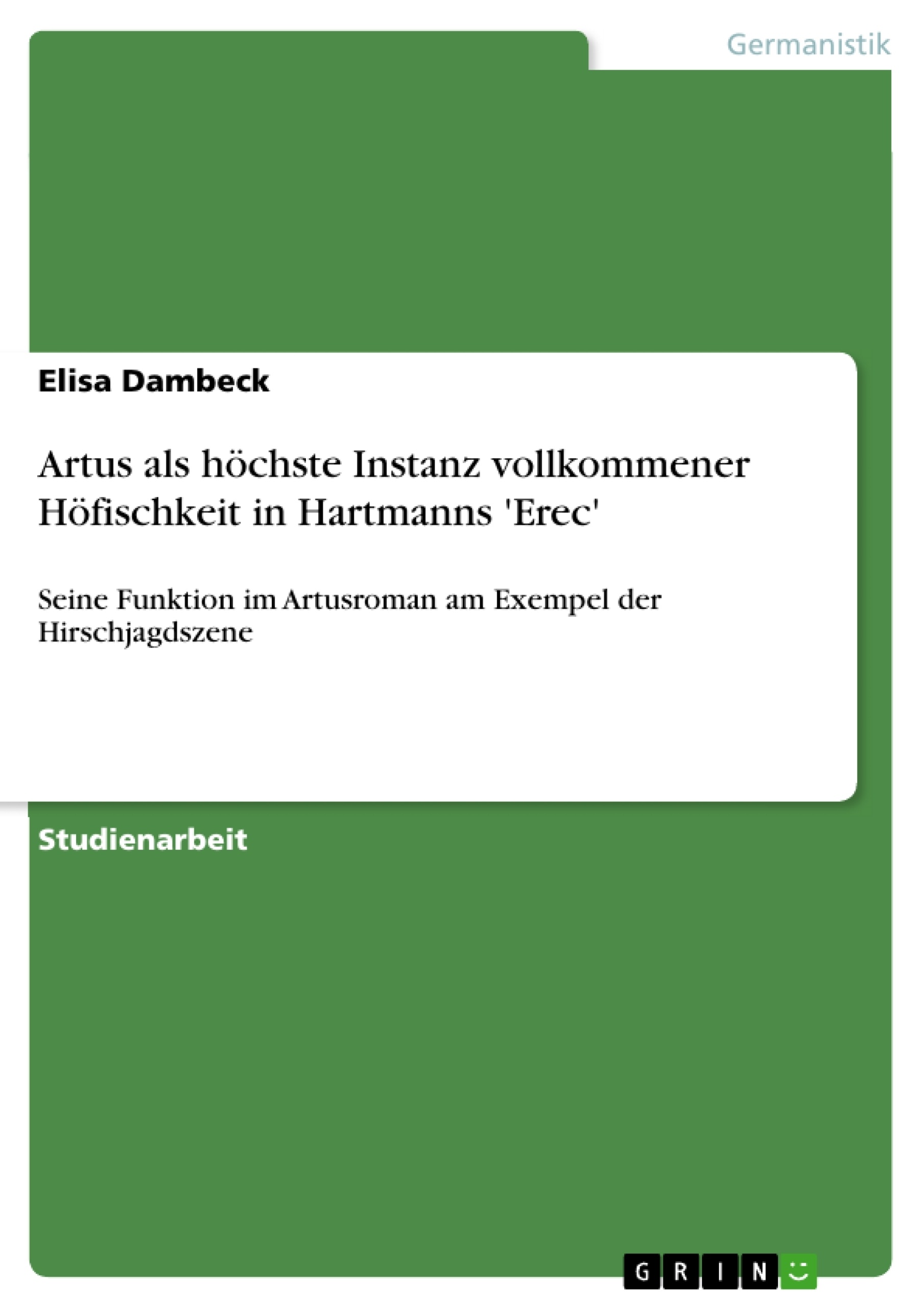Der Artusroman – in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts erreicht Chrétien de Troyes mit seinem Roman Erec et Enide eine neue Dimension der mittelhochdeutschen höfischen Dichtung, bei der volkssprachliche Werke Einzug in die Literatur halten und gleichberechtigt neben der lateinischen Klerikerliteratur bestehen. Chrétien eröffnet ein neues stoffliches von Traditionen unbelastet Themengebiet, welches um den mustergültigen König Artus und seine Ritter der Tafelrunde kreist und dabei zentrale Themen des Hofes als neuen kulturellen Träger und literarisches Zentrum anspricht – Minne und Aventiure. Über den Artusroman sagt Wace, „daß die Geschichten über Arthur weder alle Lügen sind, noch alle wahr.“ Die stoffliche Grundlage bietet der bretonische Kriegsheld und Heerführer König Artus, der sich als dux bellorum in zwölf siegreichen Schlachten gegen die Sachsen durchgesetzt hat. Die Historie wird im Artusroman vom Märchenhaften, Sagenhaften und Mythischen überformt und im Sinne höfischer Gesellschaftsideale in Rittertum und Liebe ausgestaltet. „Im Kern ist die Figur also wohl eine historische Gestalt, die in der mündlichen Tradition fortlebt und als heroische Figur kollektiven Geschichtsbewußtseins (…) vermittelt wird.“ Der höfische Ritter und höfische Dame fungieren als Leitbilder einer Gesellschaft, weshalb der Adel großes Interesse an höfischer weltlicher Literatur zeigt. Obwohl die Realität des höfischen Gesellschaftsleben verzerrt und überhöht dargestellt und als unwirklich, utopisch erkannt wurde, entstand eine Konzeption, die man als „schmeichelhaft empfand und zu (der) man sich gerne bekannte, weil (sie) als Rechtfertigung und Verherrlichung der eigenen gesellschaftlichen Ansprüche und Bestrebungen empfunden wurde.“
Interessant ist zu beobachten, dass die zentrale Person Artus in den nach ihm benannten Romanen eher eine passive Rolle spielt und selbst kaum als Held in Erscheinung tritt, der gefährliche Abenteuer besteht. In meiner Hausarbeit möchte ich dieses Phänomen näher untersuchen und gleichzeitig seine Funktion im Artusroman anhand der Hirschjagdszene in Erec von Hartmann von Aue herausstellen.
Gliederung
1 Einleitung
2 Erec - von der Entstehung bis zur Uberlieferungssituation
3 Einordnung der Hirschjagdszene
4 Konig Artus - seine Bedeutung im Artusroman am Exempel der Hirschjagdszene in Erec
4.1 Artus und die Ritter der Tafelrunde als gesellschaftliches Ideal
4.2 Die Hirschjagdszene im Erec als costume
4.3 Die Hirschjagdszene - und wozu?
4.4 Von der Hirschjagd zu Erecs Abenteuer
4.5 Artus Konigskuss - die Bedeutung fur Enite
5 Minne und Aventiure - ein Nebeneinander und Miteinander
6 Die Hirschjagdszene bei Chretien und Hartmann im Vergleich
7 AbschlieRende Worte
8 Literaturverzeichnis
8.1 Quellen
8.2 Forschungsliteratur
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt König Artus in Hartmanns 'Erec'?
König Artus fungiert als höchste Instanz vollkommener Höfischkeit und als gesellschaftliches Ideal, obwohl er im Roman oft eher passiv bleibt.
Was ist die Bedeutung der Hirschjagdszene?
Die Hirschjagd dient als ritueller Rahmen ("costume"), der die höfische Ordnung darstellt und den Ausgangspunkt für Erecs Abenteuer bildet.
Was sind die zentralen Themen des Artusromans?
Die Hauptthemen sind Minne (Liebe) und Aventiure (ritterliches Abenteuer), die den Kern des höfischen Lebensideals bilden.
Wie unterscheidet sich Hartmanns 'Erec' von Chrétiens Vorlage?
Hartmann adaptiert den Stoff für das deutsche Publikum und vertieft dabei die moralischen und höfischen Ideale der Zeit.
Was symbolisiert der Königskuss für Enite?
Der Kuss des Königs ist eine öffentliche Anerkennung ihrer Schönheit und Tugend und besiegelt ihren Platz in der höfischen Gesellschaft.
Ist König Artus eine historische Gestalt?
Im Kern basiert die Figur wohl auf einem bretonischen Heerführer, wurde aber im Roman durch Märchenhaftes und Mythisches überformt.
- Quote paper
- Elisa Dambeck (Author), 2013, Artus als höchste Instanz vollkommener Höfischkeit in Hartmanns 'Erec', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215006