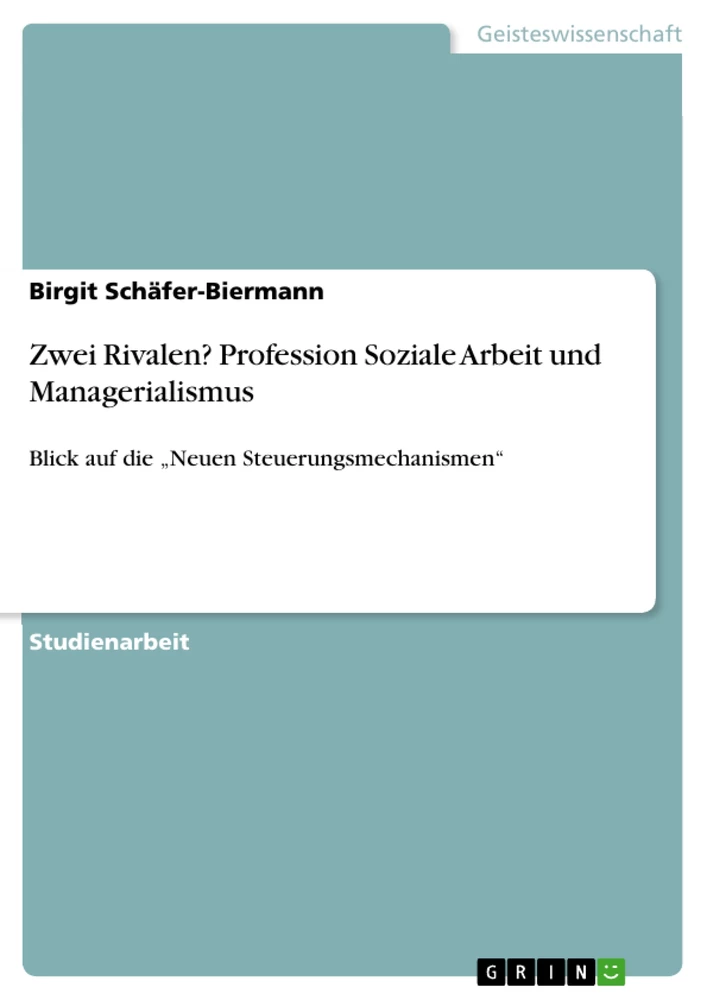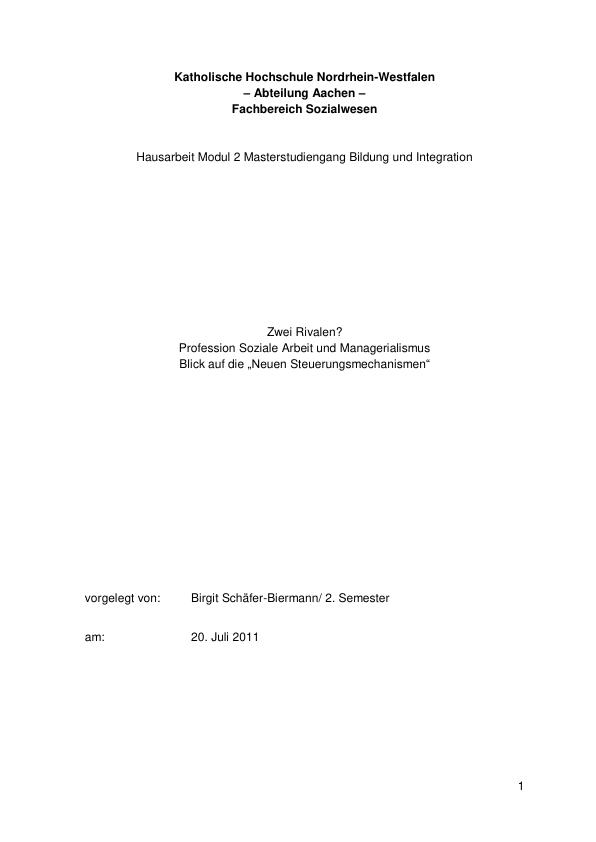Zwei Rivalen?
Profession Soziale Arbeit und Managerialismus
Blick auf die „Neuen Steuerungsmechanismen“
Einleitung:
Bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den „Neuen Steuerungsmo-dellen“ in der Sozialen Arbeit stößt man auf zahlreiche Begriffe, die sich nach sorgfältiger und kritischer Betrachtung wie „Rivalen“ begegnen. „Kosten- und Nutzendenken“ des Managerialismus treten gegen das vermeidlich „esoterische Wissen“ (O´Malley zitiert nach Otto, 2011, S. 901) der sozialen Arbeit an.
Hinter den beiden Rivalen verbergen sich zahlreiche Schlagwörter wie beispiels-weise „sozialstaatlicher Paradigmenwechsel“, „Ökonomisierung“, „Aktivierung“, „New Public Management“, „Evidenzbasierung“ und „Professionalisierung der Sozialen Arbeit“, um nur einige zentrale Begriffe zu nennen. Die Intension und der Erfolg der Sozialen Arbeit und die damit verbundene Debatte über die Qualität sozialer Dienstleistungen befindet sich auf dem gesellschaftlichen Prüfstand. Die herausfordernde Frage „Was wirkt wie und warum“ (Otto, 2009; S.20) gilt es sozialwissenschaftlich zu beantworten. Der Diskurs über den Erfolg der Sozialen Arbeit kann als Bedrohung und zugleich als Chance gesehen werden. Das Wissen um die Vielschichtigkeit und die zunehmende Ökonomisierung der Sozialen Arbeit, regt zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den gegensätzlichen Sichtweisen der „Rivalen“ an und lädt zum „Ritt auf dem Tiger“ ein wie es der Soziologe Peter Sommerfeld ausdrückt (Sommerfeld, 2003, S.63).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Profession Soziale Arbeit
- Arbeitsformen und Definition der Sozialen Arbeit
- Umdeutung der wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien
- Zur Neusteuerung der Sozialen Arbeit: Wie kam es dazu?
- Ökonomisierung
- New Public Management
- Gesellschaftliche Entwicklungen
- Der Einzug des Managerialismus und deren Auswirkungen
- Zentrale Merkmale des Managerialismus
- Managerialismus als neue Governanceform
- Managerialismus als Glaubenssystem
- Soziale Arbeit und Managerialismus
- Wettbewerbsorientierung
- Kritischer Blick auf den Managerialismus
- Herausforderung für die Sozialwissenschaft
- Wissenschaft und Verantwortung
- Forschungsergebnisse und Bemühungen
- Kritische Bewertung: Chancen und Risiken
- Sozialwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft
- Politisches Handeln
- Theorie und Praxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Spannungsfelder zwischen der Profession Soziale Arbeit und dem Managerialismus im Kontext der "Neuen Steuerungsmechanismen". Ziel ist es, die Auswirkungen der Ökonomisierung und des New Public Management auf die Soziale Arbeit zu analysieren und kritisch zu bewerten.
- Der Paradigmenwechsel im Sozialstaat vom fürsorgenden zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat
- Die Auswirkungen des Managerialismus auf die Profession Soziale Arbeit
- Die kritische Auseinandersetzung mit den Konzepten von Ökonomisierung, Aktivierung und Eigenverantwortung
- Die Spannungen zwischen den Zielen der Sozialen Arbeit und den Anforderungen des Managerialismus
- Chancen und Risiken der neuen Steuerungsmechanismen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der "Neuen Steuerungsmodelle" in der Sozialen Arbeit ein und stellt die zentralen Begriffe und den Spannungsbogen zwischen dem "Kosten- und Nutzendeken" des Managerialismus und dem Wissen der Sozialen Arbeit vor. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen des Diskurses um den Erfolg Sozialer Arbeit.
Profession Soziale Arbeit: Dieses Kapitel definiert Soziale Arbeit als Teildisziplin der Sozialwissenschaften und beschreibt klassische Arbeitsmethoden (Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit). Es präsentiert die Definition der International Federation of Social Workers (IFSW) und betont die Bedeutung von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit für die Soziale Arbeit.
Zur Neusteuerung der Sozialen Arbeit: Wie kam es dazu?: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklungen, die zur Neusteuerung der Sozialen Arbeit geführt haben, inklusive der Ökonomisierung und des New Public Management. Es analysiert den Wandel vom fürsorgenden zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat und die damit verbundenen Veränderungen im Verständnis von sozialer Gerechtigkeit und Eigenverantwortung.
Gesellschaftliche Entwicklungen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einzug des Managerialismus in die Soziale Arbeit und analysiert dessen zentrale Merkmale und Auswirkungen. Es untersucht den Managerialismus als neue Governanceform und Glaubenssystem und beleuchtet die daraus resultierenden Herausforderungen für die Soziale Arbeit.
Herausforderung für die Sozialwissenschaft: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen und die Verantwortung der Sozialwissenschaften im Kontext der neuen Steuerungsmechanismen. Es analysiert Forschungsergebnisse, Chancen und Risiken und den Dialog zwischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften im politischen Handeln.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Managerialismus, New Public Management, Ökonomisierung, Aktivierung, Eigenverantwortung, Wohlfahrtsstaat, Paradigmenwechsel, Sozialpolitik, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Evidenzbasierung, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Neusteuerung der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Spannungsfelder zwischen der Profession Soziale Arbeit und dem Managerialismus im Kontext neuer Steuerungsmechanismen. Sie analysiert die Auswirkungen der Ökonomisierung und des New Public Management auf die Soziale Arbeit und bewertet diese kritisch.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Paradigmenwechsel im Sozialstaat, die Auswirkungen des Managerialismus auf die Soziale Arbeit, die Konzepte von Ökonomisierung, Aktivierung und Eigenverantwortung, die Spannungen zwischen den Zielen Sozialer Arbeit und den Anforderungen des Managerialismus sowie Chancen und Risiken neuer Steuerungsmechanismen für die Soziale Arbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der Einleitung, der Definition Sozialer Arbeit, den Ursachen der Neusteuerung (Ökonomisierung und New Public Management), gesellschaftlichen Entwicklungen (Managerialismus), den Herausforderungen für die Sozialwissenschaften und einem Fazit befassen. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was versteht die Arbeit unter "Neusteuerung der Sozialen Arbeit"?
Die "Neusteuerung" bezieht sich auf den Wandel im Sozialstaat, weg vom fürsorgenden hin zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat, geprägt von Ökonomisierung und New Public Management. Dies führt zu neuen Steuerungsmechanismen und beeinflusst die Arbeitsweise Sozialer Arbeit.
Welche Rolle spielt der Managerialismus?
Der Managerialismus wird als zentrale Einflussgröße auf die Soziale Arbeit analysiert. Die Arbeit untersucht seine Merkmale, seine Auswirkungen als neue Governanceform und Glaubenssystem und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Profession.
Wie wird der Managerialismus kritisch bewertet?
Die Arbeit betrachtet den Managerialismus kritisch, indem sie die Spannungen zwischen den Zielen der Sozialen Arbeit (z.B. soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte) und den Anforderungen des Managerialismus (z.B. Effizienz, Wettbewerb) beleuchtet. Chancen und Risiken werden abgewogen.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Soziale Arbeit, Managerialismus, New Public Management, Ökonomisierung, Aktivierung, Eigenverantwortung, Wohlfahrtsstaat, Paradigmenwechsel, Sozialpolitik, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Evidenzbasierung und Professionalisierung.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen für die Kapitel Einleitung, Profession Soziale Arbeit, Zur Neusteuerung der Sozialen Arbeit, Gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderung für die Sozialwissenschaft. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den jeweiligen Kapitelinhalt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen der Ökonomisierung und des New Public Management auf die Soziale Arbeit zu analysieren und kritisch zu bewerten. Sie untersucht den Spannungsbogen zwischen dem "Kosten- und Nutzendeken" des Managerialismus und dem Wissen der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Birgit Schäfer-Biermann (Author), 2012, Zwei Rivalen? Profession Soziale Arbeit und Managerialismus , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215150