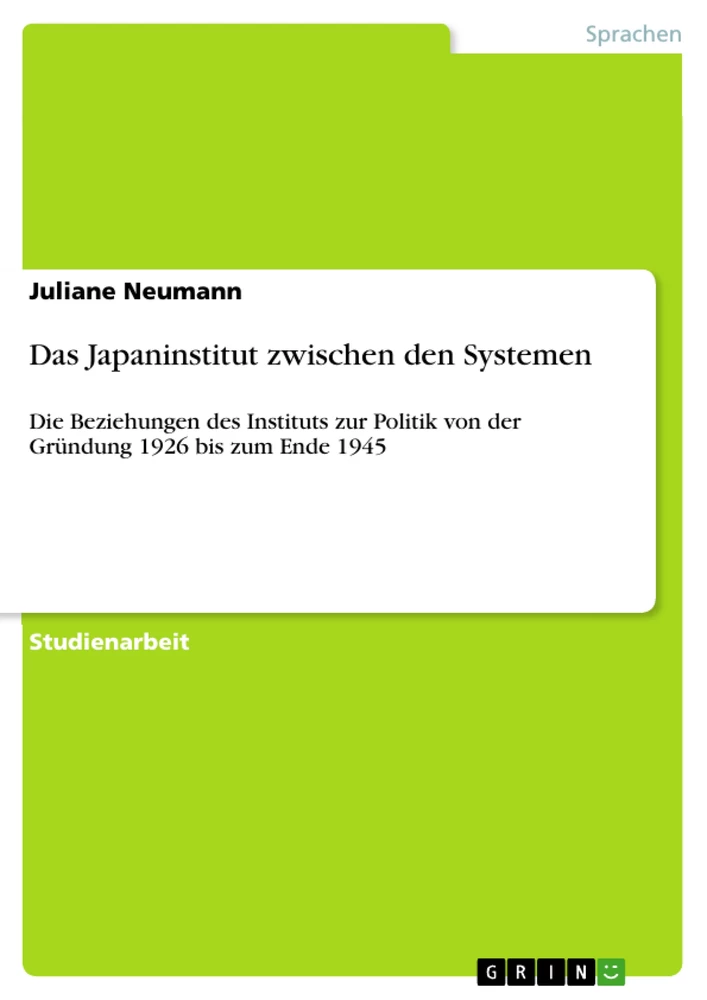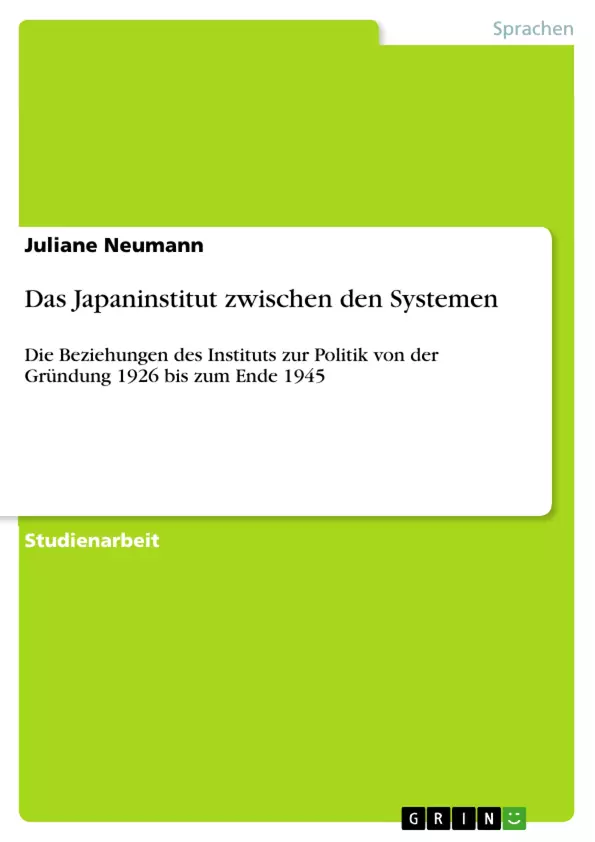Das Berliner Japaninstitut ist 1926 von Fritz Haber gegründet worden. Mit der Machtübernahme Hitlers kamen Veränderung auf verschiedenen Ebenen auf das Institut zu. Diese Arbeit hat zum Ziel, herauszufinden, ob das Japaninstitut als politisches Mittel der NS-Zeit verwendet wurde oder ob es seinen demokratischen Ansätzen treu blieb. Des Weiteren soll gezeigt werden, wie sich dieses Kulturinstitut im Laufe der Zeit verändert hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Gründung des Japaninstituts
3. Das Japaninstitut und Politik
3.1 Die 1920er Jahre
3.2 Die 1930er Jahre - Die Zeit nach der Machtergreifung
4. Schlussfolgerung
5. Anlagenverzeichnis
6. Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das Berliner Japaninstitut (Teil der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft[1] ) ist 1926 in einer Zeit der „wissenschaftsfreundlichen Politik“ (Albert 1990:356) gegründet worden. Des Weiteren legte die Weimarer Republik (1919-1933) großen Wert auf Erkenntnisgewinnung als Kulturaufgabe; wissenschaftliche Entdeckungen dienten außerdem dem nationalen Prestige (ibid.). Diese Politik änderte sich mit Hitlers Machtergreifung 1933. Zu der Zeit des Nationalsozialismus' galten Wissen und Wissenschaft als Schwäche[2] (Albrecht 1990:357). Die beiden politischen Systeme der Weimarer Republik und der NS- Zeit haben das Japaninstitut geprägt und genutzt - die Frage dieser Arbeit stellt sich allerdings: Inwiefern und zu welchem Zweck?
Nach dem 1. Weltkrieg hatte Deutschland mit einem Wissenschaftsboykott zu kämpfen. Nichtsdestotrotz entschloss sich Japan letzten Endes dazu, ein wechselseitiges Institut mit Deutschland zu gründen. Der Ruf und das Ansehen der deutschen Wissenschaft hat die deutsche Niederlage auf militärischer Ebene überdauert.
Wie Eberhard Friese aber 1986 schon in seinem Artikel „Vor sechzig Jahren: Die Gründung des Berliner Japaninstituts“ feststellte, geriet eben dieses Institut in Vergessenheit (Friese 1986:27). Die Nationalsozialisten verkauften „,die Völkerfreundschaft mit Japan' als eigenen Verdienst“ - es wurde kein Wort über die Wissenschaftsbeziehungen der Weimarer Republik oder über den jüdischen Gründer verloren (Friese (a) 1987:9, Friese 1989:76).
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob das Japaninstitut als politisches Mittel der NS-Zeit verwendet wurde oder ob es seinen demokratischen Ansätzen treu blieb. Des Weiteren soll gezeigt werden, ob und wie sich dieses Kulturinstitut im Laufe der Zeit verändert hat.
Die Arbeit befasst sich hauptsächlich mit dem Zeitraum von 1926, der Gründung des Japaninstituts, bis zum Ende des 2. Weltkrieges, was auch das Ende des Instituts bedeutete. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt allerdings auf den 1930er Jahren, da diese politisch und kulturell eine starke Veränderung mit sich brachten. Zunächst folgt aber ein kurzer Überblick über die Gründung und die allgemeine Tätigkeit des Japaninstituts.
Um die Fragen zur Beziehung von Japaninstitut und Politik zu beantworten, gibt es einige hilfreiche Materialien. Der Großteil dieser Literatur ist von Eberhard Friese verfasst worden. Dazu zählen u. a. „Japaninstitut Berlin und Deutsch-japanische Gesellschaft Berlin. Quellenlage und ausgewählte Aspekte ihrer Politik 1926-1945“. Insbesondere der Teil zur Quellenlage erweist sich als nützlich, weil dort (nahezu) alle Orte aufgeführt werden, die heute noch über Unterlagen des Japaninstituts verfügen.
„Das Japaninstitut in Berlin (1926-1945): Bemerkungen zu seiner Struktur und Tätigkeit“ (aus: „Du verstehst unsere Herzen gut“) von Eberhard Friese bietet einen guten Überblick über das Institut und geht zusätzlich auf die Politik ein. Der Zeitungsartikel „Vor sechzig Jahren: Die Gründung des Berliner Japaninstituts - Eine Leistung Weimars: der jüdische Anteil“ (Eberhard Friese) ist von Interesse, weil es darin ausschließlich um die jüdische Beteiligung am Institut geht. Von einem Juden gegründet, wurden auch weitere Juden im Institut angestellt. Das stellte v. a. zur NS-Zeit eine Hürde dar.
„Einige Gedanken zur deutsch-japanischen Kulturarbeit der 20er Jahre und zur Gründung des Berliner Japaninstituts 1926“ aus: Japan-Deutschland Wechselbeziehungen: Ausgewählte Vorträge der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Berlin aus den Jahren 1985 und 1986“ ergänzt die vorherigen Quellen. Das Schriftenverzeichnis[3] von E. Friese gibt einen guten Überblick über den Umfang seiner Literatur u. a. zum Japaninstitut.
Das Buch „Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft - Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft“ erweist sich als gute Ergänzungsliteratur, da auch die 1920er und 30er Jahre in Verbindung mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft betrachtet werden.
Der genauere Weg zur eigentlichen Gründung des Japaninstituts lässt sich in detaillierter Form in einigen Werken finden. Dazu zählen die Schriften Frieses, aber auch das Buch von Dietrich Stoltzenberg „Fritz Haber: Chemiker, Nobelpreisträger, Deutscher, Jude - eine Biographie“, das sich in Kapitel 12 mit der Reise Habers nach Japan und mit dem Japaninstitut befasst.
Weitere Sekundärliteratur befindet sich in dem Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin. Neben diesen Quellen gibt es aber auch Primärliteratur aus dem Nachlass Solf (Bundesarchiv Koblenz), der Haber-Sammlung (Archiv der MaxPlanck-Gesellschaft) und aus dem Nachlass Trautz (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Berlin)[4].
2. Die Gründung des Japaninstituts
Das Berliner Japaninstitut (japanisch: Berurin Nihon Kenkyüjo %hf, später Berurin Nihon Gakkai ^/h ÜU|3 wurde am 18. Mai 1926
gegründet und am 4. Dezember 1926 feierlich eröffnet (Friese 1990:821). Der offizielle Name des Instituts war Institut zur Förderung der wechselseitigen Kenntnis des geistigen Lebens und der öffentlichen Einrichtungen in Deutschland und Japan (Japaninstitut) e. V. Sein Gründer war der jüdische Nobelpreisträger und Physikochemiker Fritz Haber (1868-1934), der durch die Reiseberichte Albert Einsteins[5] (1879-1955; Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik) darin bestärkt wurde, auch nach Japan zu fahren. Haber[6] erkannte in Japan „die Notwendigkeit für Deutschland eines engeren Zusammengehens und auch die Möglichkeit, die zu realisieren“ (Friese 1990:820). In Singapur schrieb Haber dazu:
„... Ach wie gerne ich noch in Japan wär!
Denn Ihr habt mich gar zu gut behandelt
Und hier quält die feuchte Hitze sehr.
... Kommt in Form von allein, die geschworen,
Dass die Zukunft deutsch japanisch sei.
Füllt mein Zimmer, füllt mir meine Ohren.
Und verwandelt mich in dünnen Brei.
Helft, o helft, das Institut zu begründen,
Denn sonst ist es schnell mit mir vorbei.
Ach! Herr Mori scheint kein Geld zu finden!
Jeder Yen, der fehlt, wird ein Besuch.
Wer besucht, der kommt, um mich zu schinden. [...]“
(qtd. Stoltzenberg 1994:539).
Dieses Gedicht zeigt schon die Mühen und auch das rege Interesse an der Gründung eines Japaninstituts; aber eben auch die Probleme, vor die die Gründer gestellt wurden. Ferner betonte Haber 1925, dass es sowohl für die Deutschen als auch für die Japaner ein Bedürfnis sei, eine Anlaufstelle für Information und Orientierung über dasjeweils andere Land zu haben (Aufzeichnung 15. Juni 1925, Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Va. Abt., Rep. 5, Nr. 2032).
In Gesprächen u. a. mit Wilhelm Solf[7], Shinpei Goto[8] und Hajime Hoshi[9] kam die Idee eines wechselseitigen Instituts in Tökyö[10] und Berlin auf (Friese 1990:820). Es wurde versucht, die Verbindung mit dem Schwesterinstitut in Japan durch wechselseitige Ehrenmitgliedschaften zu manifestieren. So wurde Haber Ehrenmitglied in Tökyö und Goto sowie Solf und Honda Kumatarö wurden Ehrenmitglieder in Berlin (Szöllösi-Janze 1998:578-579). Jedoch wurde das japanische Institut stets als eine rein japanische Organisation angesehen. So reagierten die Japaner wohl „missvergnügt“ auf versuchte Einflussnahme von Deutschland (Szöllösi-Janze 1998:579). Haber schrieb über den langwierigen Prozess bis zur Gründung in einem Brief: „Die Schnecken, welche sich seit homerischen Zeiten besonders langsam bewegen, überholen dennoch in ihrem Vorankommen das Japaninstitut.“ (Ramming 1988:349).
Das Berliner Institut wurde als „schwebendes Institut“ der KaiserWilhelm-Gesellschaft (KWG) angegliedert. Somit konnten die Räumlichkeiten der Gesellschaft genutzt werden. Es warjedoch „nur“ ein „schwebendes Institut“, da das Japaninstitut keinem einzelnen wissenschaftlichen Gebiet (so z. B. wie das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik), sondern „allen Spezialwissenschaften in ihrer Sonderbedeutung für Deutschland und Japan“ (Haber) diente (Friese 1990:821).
Beide Länder konnten sich staatspolitisch einiges von der Bildung dieser Institute erhoffen. Deutschland sah eine Möglichkeit für eine längerfristige Partnerschaft mit einer bis dato noch nicht von allen anerkannten Weltmacht. Die Idee bestand weiterhin darin, eine militärische Niederlage auf Kultur- und Wissenschaftsdiplomatie auszugleichen (Friese 1990:821). Goto erhoffte sich einen gesicherten Zugang zu deutschen Forschungsstätten als Zeichen gegen den starkenanglo-amerikanischen Einfluss[11] (Friese 1990:820).
Das Berliner Institut wurde zum Großteil vom Auswärtigen Amt, vom Reichsministerium des Inneren und vom Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung finanziert (Friese 1980:2). Obwohl der Großteil der Gelder vom Staat kam, schloss das Japaninstitutjede politische und wirtschaftliche Tätigkeit explizit in der Satzung aus (Vgl. §2 der Satzung von 1926). Haber sah den Anschluss an die KWG gern, weil sich dadurch der Verdacht ausschließen ließ, dass das Japaninstitut ein wirtschaftliches Unternehmen sei, das mit anderen in Konkurrenz treten würde (Aufzeichnung 15. Juni 1925, Archiv der Max-Planck-Gesellschaft Va. Rep. 5, Nr. 2032). Die vorher erwähnten drei Ämter finanzierten das Institut nicht nur, sondern entsandten auch Mitglieder, sogenannte Offizial-Mitglieder, in das Kuratorium (Friese 1980:2). Das Kuratorium[12] bestand in Berlin aus 11-17 Personen[13]. Neben dem Kuratorium gab es eine Mitgliederversammlung und den Vorstand, der der Vorsitzende des Kuratoriums war („Präsident“) (Vgl. §3 sowie §§11 und 12 der Satzung von 1926). Den ersten Kuratoriumsvorstand übernahm der Gründer Fritz Haber (siehe Anlage 5.2). Zudem gab es in beiden Institutenjeweils zwei Leiter - einen deutschen und einen japanischen. Der erste deutsche Leiter des Berliner Instituts war F. M. Trautz (siehe Anlage 5.4)[14].
Die Aufgaben des Instituts beschreibt sein vollständiger Name - die „wechselseitige Kenntnis“ über beide Länder soll gefördert werden (Vgl. §1 der Satzung von 1926). Dies soll erreicht werden durch (Vgl. §2 der Satzung von 1 926):
1. Förderung aller Spezialwissenschaften, die sich auf Japan beziehen
2. Veröffentlichungen des Instituts (siehe Anlage 5.5)
3. Nachweisung von geeigneter Literatur an Interessenten
4. Übersetzung dieser Literatur
5. persönliche Auskunftserteilung
Weiter beschrieb Haber in seiner Rede anlässlich der Eröffnung des Instituts die Gründung und die Aufgaben wie folgt: . daß [sic] die Völker auf die Länge an äußerem Nutzen und an innerem Gewinn am meisten erreichen, wenn sie sich verstehen lernen und mit dem Denken und Empfinden des anderen vertraut werden“ (qtd. Lewin 1997:9).
In beiden Instituten wurde aber die politische Debatte vermieden, da „das konservative und liberale Bürgertum in seinen kulturellen und wissenschaftlichen Ambitionen angesprochen werden“ sollte (Friese 1990:827). Somit wurden weder die Krisen der Weimarer Republik noch die japanische Expansionspolitik im Institut zur Sprache gebracht (Becker 1996:27).
3. Das Japaninstitut und Politik
Nach dem 1. Weltkrieg hat Japan, wie alle anderen Siegermächte, Reparationszahlungen von Deutschland gefordert. In den 1920er Jahren legte sich diese Situationjedoch, als Japan zum isolierten Staat der Siegermächte wurde. Die isolierte Lage Japans ergab sich aus den Differenzen mit den anderen Siegermächten. Probleme gab es mit England in der Flottenfrage, mit den USA und China bei der Tsingtau-Problematik und der Festlandspolitik an sich. Eine Entfremdung von der Sowjetunion entstand durch die Entsendung von Truppen nach Sibirien (Friese 1987 (b): 11). Japan wollte eine Ausgleichspolitik mit den Verliererstaaten. Letzten Endes hat Japan auf die meisten ursprünglich erhobenen Forderungen verzichtet. Ein weiterer Faktor des Problems Japan - Deutschland wurde gelöst, als Deutschland nach dem Krieg jeglichen Anspruch auf Tsingtau fallen ließ (ibid.). In Deutschland setzte sich in den 20er Jahren die parlamentarische Demokratie durch. In Japan etablierte sich zur gleichen Zeit die Entwicklung zur Parteiendemokratie (Becker 1996:24).
Die Demokratie ging aber in den 30er Jahren in Deutschland unter und damit auch die Hintergründe der Institutsgründung. Die jüdischen Mitglieder sowie Mitglieder mit anderen politischen Ansichten mussten wissenschaftliche Institute (und andere Arbeitsstellen) verlassen. Wie in den folgenden Kapiteln gezeigt wird, suchte sich die Politik ihren Weg in das Institut, u. a. durch neue Präsidenten.
3.1 Die 1920er Jahre
Da das Japaninstitut Teil der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) war, hatte die Gesellschaft einen nicht geringen Einfluss auf das Berliner Institut. Zwar war der finanzielle Einfluss eher klein, der personelle und organisatorische hingegen nicht[15] (Friese 1989:73). Auch sollte das Vermögen im Falle der Auflösung des Instituts der KWG zufallen (Vgl. §17 der Satzung von 1926). Zumindest von der KaiserWilhelm-Gesellschaft ist bekannt, dass viele der Mitglieder für die ehemalige Monarchie und andere für die Republik waren (v. Brocke 1990:283). Die KaiserWilhelm-Gesellschaft war es auch, die ab 1928 ein Dankestelegramm für die erwiesene Hilfe an die Regierung schickte. Ab 1933 wurde dann jährlich ein Telegramm an Adolf Hitler geschickt (v. Brocke 1990:284).
Dennoch zeigt ein Brief an Gundert[16] aus dem Jahre 1926, dass das Japaninstitut von der deutschen Politik bzw. von der Gesamtsituation in Deutschland beeinflusst werden konnte:
„Ich kann leider darüber[17] nicht schreiben, was ich möchte und was auch in voller Übereinstimmung mit mir von den Herren des Auswärtigen Amts, des Kultusministeriums ja zum Teil des Kuratoriums selbst gedacht wird. Sie sehen mich in großer Sorge, dass wiederum anstatt sachverständiger, sachlicher Zusammenarbeit Laientum, Parteipolitik und Krieg auf der ganzen Linie auch diese rein geistige und kulturelle Schöpfung bedroht.“ (Nachlass Trautz, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, Siehe Anlage 5.6)
Zumindest die Aussage aus dem Gründungsjahr zeigt, dass sowohl die Geldgeber (das Auswärtige Amt) als auch die aktuelle Parteienpolitik im Land einen Einfluss auf das Institut hatten. Dennoch wird der „geistige und kulturelle“ Aspekt des Instituts hervorgehoben. Auch wenn der Absender hier von einem Krieg spricht, schloss zumindest Haber in dem Jahr darauf einen neuen Krieg für einige Zeit aus: „Es ist völlig klar, dass es in den nächsten Jahren zu keinem Kriege kommt [...]“ (Haber an Solf, 17. Juni 1927 Bundesarchiv Koblenz).
3.2 Die 1930er Jahre - Die Zeit nach der Machtergreifung
Die neue politische Situation nach der Machtergreifung Hitlers brachte auch Veränderungen für das Japaninstitut mit sich.
Zum einen zielte die Propaganda der NS-Zeit in diesem Bereich darauf ab, den Leuten glauben zu machen, dass die guten deutsch-japanischen Beziehungen ein Geschöpf der Nationalsozialisten seien und eben nicht in der Weimarer Republik entstanden sind (Friese 1997:240). Zum anderen änderte sich die Leitung des Instituts (auch von anderen Instituten, wie z. B. der DeutschJapanischen Gesellschaft) (Friese 1990:828).
[...]
[1] Heute Max-Planck-Gesellschaft
[2] Zitiert in Albrecht 1990:357: „Der völkische Staat muß [sic]...von der Voraussetzung ausgehen, daß [sic] ein zwar wissenschaftlich wenig gebildeter, aber körperlicher gesunder Mensch mit gutem, festem Charakter [...] für die Volksgemeinschaft wertvoller ist als ein geistreicher Schwächling.“
[3] Teil seines Nachrufes. Verfasst von H. Walravens. „ Eberhard Friese zum Gedenken“ (2004).
[4] Die Genehmigung zur Veröffentlichung der genannten Quellen aus den Archiven und Nachlässen liegt vor.
[5] Einstein unternahm 1922 eine Reise nach Japan. Zu dieser Zeit war es wegen der allgemeinen Haltung gegenüber Deutschland nicht möglich gewesen, eine offizielle Einladung für einen deutschen Wissenschaftler auszusprechen. Kitaro Nishida wandte sich an die Zeitung „Kaizo“, eine Zeitung, die zu „gesellschaftspolitischen Experimenten bereit“ war (Friese 1990:810). Während Einstein auf dem Dampfer nach Japan unterwegs war, wurde ihm der Nobelpreis zugesprochen (Friese 1990:811). Bei Versammlungen betonte Einstein, dass „nunmehr nach der Katastrophe des Krieges die moderne Wissenschaft vordringlich dazu berufen sei, der Menschheit den Weg zu einer Weltkultur zu eröffnen, in der der Nationalsozialismus einzelner Länder durch friedliche kulturelle Begegnung überwunden werden müsste“ (ibid.).
[6] Diese Reise schien Haber und seine Frau sehr zu beeindrucken. Charlotte Haber schreibt über die Reise: „Kioto, der Biwasee, Osaka, Maiko, Nara - eine Kette glückseliger Erinnerungen . Ihre Gärten, Tempel, Statuen, Schreine. Die Ufer, die Menschen...wie wirkte es in uns nach!“ (Haber 1970:204).
[7] 1868-1936; Botschafterin Tokyo unddeutscher Gouverneur auf Samoa; Orientalistund Indologe; Gegner des NS-Regimes (Friese (b) 1987:11-12).
[8] Japanischer Mediziner, Kulturpolitker und Staatsmann (Vgl. Friese 1990:806).
[9] 1873-1951; japanischer Pharmazie-Industrieller, der die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und das Japaninstitut finanziell unterstützt hat (=Hoshi-Stiftung) (Friese 1990:812). Neben der Hoshi-Stiftung gab es aber auch noch die Mochizuki-Stiftung durch den Kaufmann Gunshiro Mochizuki (1879-1940) (Friese 1990:814). Diese Stiftungen waren äußerst wertvoll für die deutsche Wissenschaft zu der Zeit. So wurde Hoshi zum Ehrenbürger von der technischen Hochschule in Charlottenburg ernannt (Siehe Anlage 5.2). Ferner war Hoshi der erste Ausländer, der solch eine finanzielle Unterstützung zu dieser Zeit geleistet hatte (Siehe Anlage 5.3). Es sollte aber auch noch festgehalten werden, dass diese Schenkung erbracht wurde, als es „keinerlei private Beziehung zwischen Schenkern und Beschenkten“ gab (Rede von Haber im Imperial Hotel, Tokyo am 3. November 1924 (aus: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Va. Abt., Rep. 5, Nr. 2030).
[10] Das Institut in Tokyo wurde am 18. Juni 1927 mit einiger Verzögerung eingeweiht. Der erste Präsident war Goto (Friese 1990:822). Offiziell hieß es Japanisch-Deutsches Kulturinstitut (japanisch: Nichi-Doku Bunka kyökai BJÊAfLfê'è) (Friese 1980:3). Das Tokyoer Institut wurde eher für kulturpropagandistische Zwecke genutzt (Lewin 1997:10). Solf war maßgeblich an der Gründung des Tokyoer Instituts beteiligt (Friese (b) 1987:16). Er beschreibt seine Tätigkeitjedoch wie folgt: „[...] so kann ich nur sagen, dass mein Anteil an dem Zustandekommen meine hier in Superlative gesteigerte Geduld war und die große Reserve, die ich mir auferlegen musste, um mich in diejapanische Vorbereitung zur Gründung möglichst wenig einzumischen. Meine Förderung war also lediglich eine Unterlassung alles dessen, was hemmend auf den Willen der Japaner hätte wirken können.“ (Bundesarchiv Koblenz - Nachlass Solf27.7.1927 Brief Solfan Haber).
[11] Friese führt weiterhin aus, dass bei diesem Punkt auch die Brüskierung Japans durch das amerikanische Einwanderungsverbot für Japaner von 1923 eine Rolle spielte (Friese 1990:820821).
[12] In Tokyo hieß das Kuratorium Direktorium und bestand aus 17-20 Mitgliedern (Friese 1990:822).
[13] Die Mindestanzahl lag bei 11 Mitgliedern. Daraus waren zwei vom Auswärtigen Amt, einer vom Reichsministerium des Inneren, einer vom Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Dazu kam ein Mitglied der preußischen Akademie für die Wissenschaften, ein Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, ein Mitglied der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und ein Mitglied vom Institut für ausländisches öffentliches Recht und Volksrecht. Die anderen Mitglieder (Leute mit Interesse an den bilateralen Beziehungen zwischen Japan und Deutschland) wurden auf Antrag aufgenommen (Vgl. §4 der Satzung von 1926).
[14] Anlage 5.1 ist eine Liste mit Namen, die in Verbindung mit dem Japan-Institut standen. Allerdings taucht Habers Name nicht in der Liste auf (siehe Anlage 5.1).
[15] Ein Mitglied der KWG saß im Kuratorium des Japaninstituts (Vgl. Fußnote 12). Jedoch steht in einem Schreiben von 1925: „Ein näheres Verhältnis zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft komme seines [Haber, J.N.]Erachtens nicht in Frage, da es sich nicht um ein Forschungsinstitut handele“ (Archiv der Max-Planck-Gesellschaft Va. Abt., Rep. 5, Nr. 2032). Dieser Einfluss ging erst zurück, als die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mehr unter politische Kontrolle geriet (Friese 1989:73).
[16] Wilhelm Gundert, 1880-1971; Leiter des Japanisch-Deutschen Kulturinstituts Tokyo von 19271936 (Seckel 2003).
[17] In den vorangehenden Sätzen wurde über die weniger erfolgreiche Zukunft geschrieben, gesetzt den Fall, dass Haber weiterhin Präsident ist.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde das Berliner Japaninstitut gegründet?
Das Institut wurde am 18. Mai 1926 gegründet und am 4. Dezember 1926 feierlich eröffnet.
Wer war der Gründer des Japaninstituts?
Der Gründer war der jüdische Physikochemiker und Nobelpreisträger Fritz Haber, der die Notwendigkeit einer deutsch-japanischen Annäherung nach dem Ersten Weltkrieg erkannte.
Wie veränderte sich das Institut während der NS-Zeit?
Nach 1933 versuchten die Nationalsozialisten, die deutsch-japanischen Beziehungen als ihr eigenes Verdienst darzustellen. Der jüdische Anteil an der Gründung wurde verschwiegen und jüdische Mitarbeiter standen vor großen Hürden.
Welche Rolle spielte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG)?
Das Japaninstitut war als „schwebendes Institut“ der KWG angegliedert, was ihm wissenschaftliche Reputation verlieh und den Verdacht rein wirtschaftlicher Interessen ausschloss.
Was war der offizielle Zweck des Instituts?
Der Zweck laut Satzung war die „Förderung der wechselseitigen Kenntnis des geistigen Lebens und der öffentlichen Einrichtungen in Deutschland und Japan“.
Wurde das Institut als politisches Mittel genutzt?
Die Arbeit untersucht, ob das Institut seinen demokratischen Ansätzen treu blieb oder ob es zunehmend als Instrument der NS-Kulturdiplomatie instrumentalisiert wurde.
- Arbeit zitieren
- M.A. Juliane Neumann (Autor:in), 2012, Das Japaninstitut zwischen den Systemen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215205