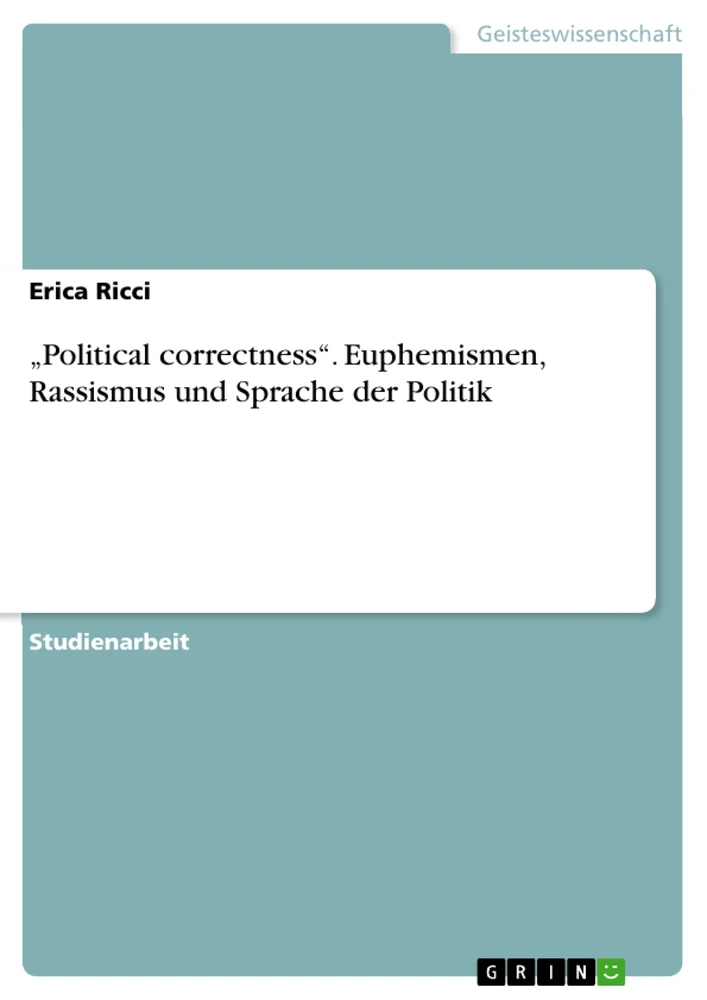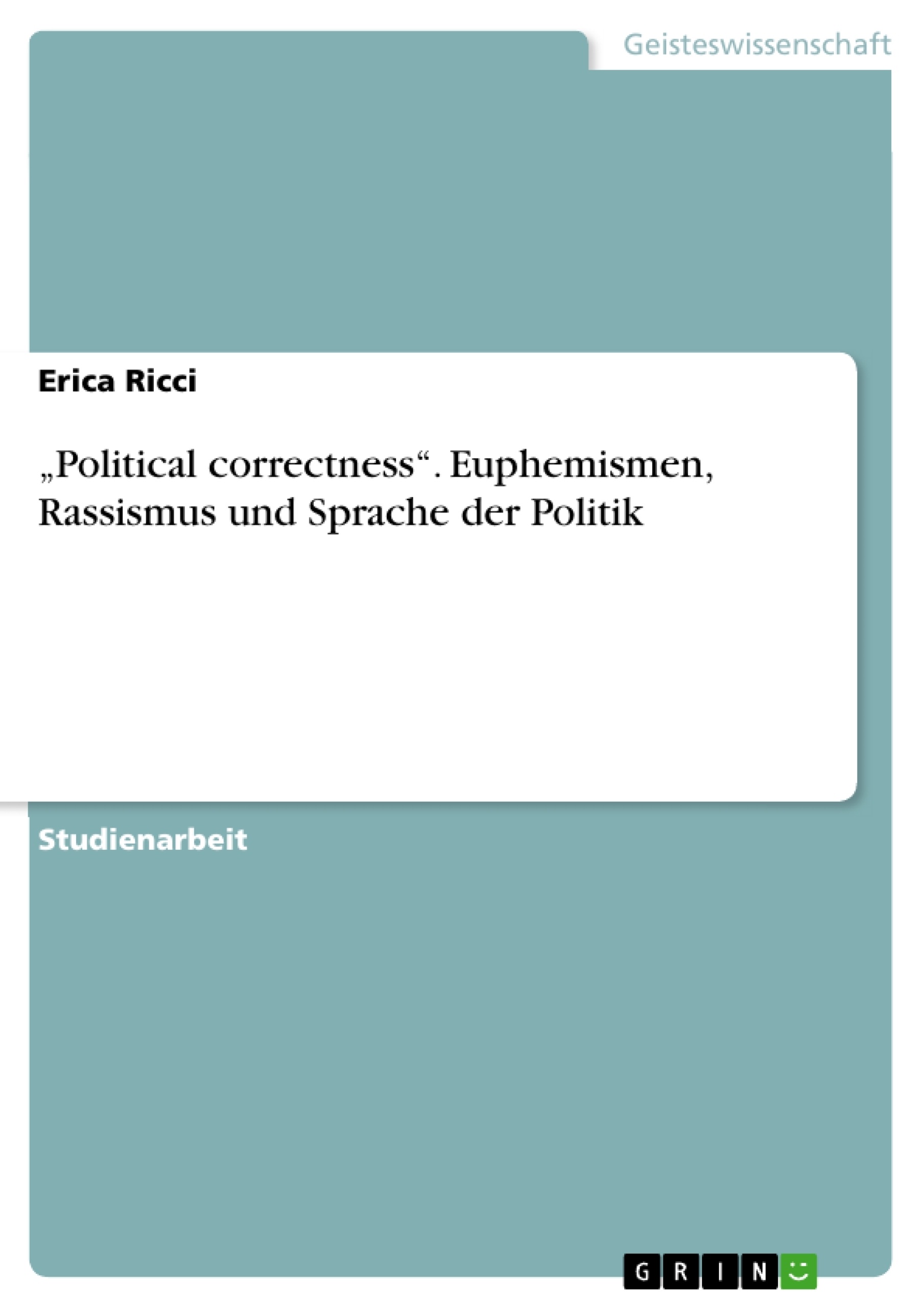Vor einigen Jahren behauptet der nigerianische Schriftsteller Wole Soyinka, der 1986 den Nobelpreis für Literatur bekam, während eines literarischen Festivals in Neapel über Political Correctness: „Wir sind nahe an einem Jahrtausend von Wörtern, die von ihrem Kontext abgezogen sind, ohne Risiken, ohne Beleidigungen, ohne Nuancen, ohne Geschichte: eine menschliche neutralisierte Kommunikation“.
[...] Obwohl das Thema der political correctness ein sehr breites Thema ist, werde ich in diesen Abschnitten einen Eindruck davon zu geben versuchen, wie die Sprache der neuen Tendenz folgt, politically correct zu sein. Meine Analyse betrifft vor allem die englische Sprache und die amerikanische Gesellschaft, wo die polical correctness geboren ist und sich entwickelt hat. Erstens werde ich mich mit der Definition von political correctness und seiner Stellung in der heutzutage Gesellschaft beschäftigen. Ich analysiere insbesondere einige Wörter, um besser zu verstehen, was heute die Debatte über political correctness bedeutet. Ich habe mich entschieden, von „Euphemismen“ zu sprechen, obwohl dieses Wort nicht ganz neutral ist, weil ich finde, dass das Wort ‚Euphemismus‘ das richtige Bild ist, um eine immer stärker grassierende Tendenz, sich politically „incorrect“ zu erklären, um sich sprachlichen Entscheidungen, die für heuchlerisch gehalten werden, entgegenzusetzen. Danach werde ich über George Orwell und seine Idee von politischer Sprache sprechen: sowohl sein Essay Politics and the English Language (1946) als auch sein Roman 1984 (Nineteen Eighty-Four) (1948) stellen eine beachtliche Analyse von Euphemismen und des Gebrauchs der Sprache von Institutionen vor, auch wenn diese Werke vor der Debatte über political correctness geschrieben wurden.
Zum Schluss werde ich im letzten Paragraph auf den linguistischen Rassismus, auf seine Bedeutung, und darauf, wie Wörter und Gedanken in der Konzeption des ‚Anderen‘ miteinander verbunden sind, eingehen. In diesem Abschnitt werde ich mich auf die amerikanische Gesellschaft und besonders auf die Afroamerikaner konzentrieren, obwohl das Phänomen in vielen anderen Kontexten analysierbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist "politically correct"?
- Die Euphemismen
- George Orwell und die Sprache der Politik
- Der linguistische Rassismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse des Konzepts von „Political Correctness“ und seinen Auswirkungen auf die Sprache der Politik. Dabei werden die Entstehung und Bedeutung von Euphemismen, die Ideen George Orwells zur politischen Sprache und der linguistische Rassismus beleuchtet.
- Die Entstehung und Bedeutung von Euphemismen im Kontext von „Political Correctness“
- Die Analyse der politischen Sprache nach George Orwell und ihre Relevanz für die heutige Debatte
- Der linguistische Rassismus und seine Auswirkungen auf die Konzeption des "Anderen"
- Die Rolle der Sprache im gesellschaftlichen Diskurs und die Bedeutung von "korrekter" Wortwahl
- Die politischen und kulturellen Kämpfe, die sich um die Sprache drehen und die Bedeutung der Identität in diesem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Leser mit dem Thema „Political Correctness“ und seiner Bedeutung in der heutigen Gesellschaft vertraut. Der Fokus liegt auf der Sprache und ihrer Rolle im gesellschaftlichen Diskurs sowie auf der Entstehung der Debatte um „Political Correctness“.
- Was ist "politically correct"?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von „Political Correctness“ und seiner Stellung in der heutigen Gesellschaft. Es analysiert insbesondere die Bedeutung von Euphemismen und deren Einfluss auf die Debatte um „Political Correctness“.
- George Orwell und die Sprache der Politik: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ideen George Orwells zur politischen Sprache und deren Relevanz für die heutige Debatte um „Political Correctness“.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Political Correctness, Euphemismen, Rassismus, Sprache, Politik, Identität, George Orwell, linguistische Ökologie, soziale Hegemonie.
Häufig gestellte Fragen
Woher stammt das Konzept der „Political Correctness“?
Das Konzept der Political Correctness (PC) ist primär in der amerikanischen Gesellschaft entstanden und hat sich von dort aus international entwickelt.
Welche Rolle spielen Euphemismen in der PC-Debatte?
Euphemismen werden genutzt, um potenziell beleidigende oder diskriminierende Begriffe durch neutralere Formulierungen zu ersetzen. Kritiker sehen darin oft eine Form der sprachlichen Verschleierung oder Heuchelei.
Was war George Orwells Ansicht zur politischen Sprache?
Orwell analysierte bereits 1946 (z.B. in „1984“), wie Institutionen Sprache nutzen, um Gedanken zu manipulieren. Seine Kritik an Euphemismen ist heute hochrelevant für die Diskussion um sprachliche Normen.
Was versteht man unter „linguistischem Rassismus“?
Linguistischer Rassismus beschreibt, wie durch Sprache Vorurteile reproduziert und das Bild des „Anderen“ (z.B. Afroamerikaner) abgewertet wird, oft tief verwurzelt in historischen Kontexten.
Ist Political Correctness eine Form der sozialen Hegemonie?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Durchsetzung bestimmter Sprachnormen als Versuch gewertet werden kann, eine kulturelle und soziale Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs zu erlangen.
- Quote paper
- Erica Ricci (Author), 2013, „Political correctness“. Euphemismen, Rassismus und Sprache der Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215213