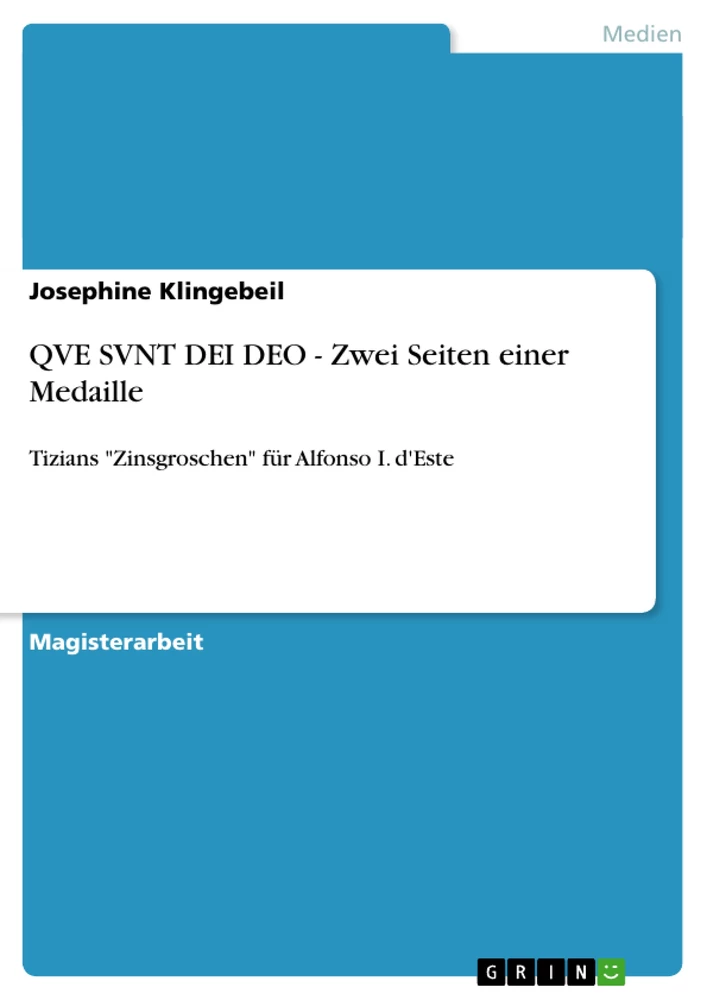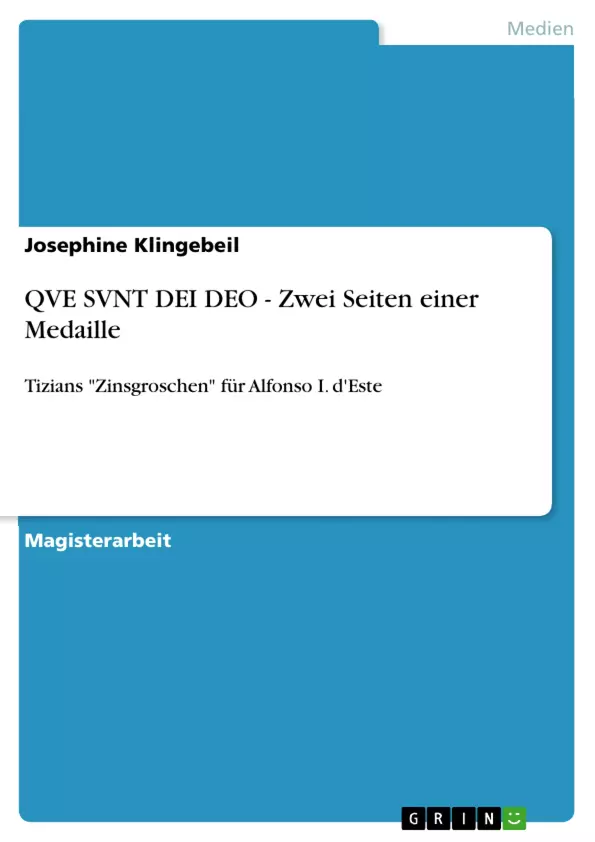Tizinas Zinsgroschen war, obwohl er in den Privaträumen des Herzogs sicher nur einer ausgewählten Öffentlichkeit zugänglich, bereits kurz nach seiner Entstehung so bekannt, dass noch zu Lebzeiten des Künstlers zahlreiche Kopien angefertigt worden sind, worin sich eine offensichtliche zeitgenössische Anerkennung der künstlerischen Leistung äußert.
Bisher sind Informationen, die das Gemälde sowie seinen ursprünglichen Aufenthaltsort betreffen, nicht umfassend zusammengetragen, bzw. Kontexte generell vernachlässigt worden. In dieser Arbeit möchte ich daher die bisherigen Forschungsleistungen einer besonneneren Prüfung unterziehen und im Vergleich zu einander neu bewerten. Der Zinsgroschen ist mehr als ein simples ‚Probestück’, mit dem sich Tizian dem Herzog von Ferrara empfahl, auch wenn Werbegeschenke durchaus nicht unüblich waren, um an Aufträge zu gelangen. Werke des 16. Jahrhunderts verfügten über eine Eloquenz, die für den heutigen Betrachter nur schwer zu entschlüsseln ist, daher geht es mir darum diese anderen Dimensionen des Gemäldes aufzuzeigen.
Neben einer intensiven Bildbeschreibung und -analyse, bei der besonders auf die kontrastreiche Gegenüberstellung der beiden Hauptfiguren eingegangen werden soll, möchte ich auf die Beziehung des jungen Künstlers zu seinem Auftraggeber sowie auf soziokulturelle und historische Zusammenhänge eingehen. Vor allem im Sammlungskontext des herzoglichen Studiolo blieb der Zinsgroschen bisher fast unbeachtet, obwohl diese spezifische Rezeptionsform, neben der Ikonographie, grundlegend für das Verständnis von frühneuzeitlicher Kunst ist. Eine besondere Rolle spielt in meiner Untersuchung darüber hinaus eine Neuinterpretation mittels der zeitgenössischen, humanistischen Vita activa et contemplativa-Debatte, die durch die psychologisierende Dualität des Bildthemas und dessen Umsetzung nahe liegt, von der Forschung jedoch bisher unbeachtet blieb. Die Diskussion um das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis war im 16. Jahrhundert für Kirche und Politik ein gegenwärtiger Konflikt, der mit Sicherheit durch die Kunst der Zeit seinen Ausdruck finden musste. Dieser Aspekt wird heute oftmals unterschätzt und bleibt deswegen unbemerkt. Den Kern meiner Arbeit bildet die Münze, die alle Wirklichkeitsebenen miteinander verbindet und den Schlüssel zur Neudeutung des Werkes darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext und biographische Bezüge
- Zur Vita des Tiziano Vecellio da Cadore
- Zwischen Innovation und Tradition: Der junge Tizian in Venedig
- Italien und die Markusrepublik im 15. und 16. Jahrhundert
- Ferrara und das Haus Este
- Zur Vita des Tiziano Vecellio da Cadore
- Politik und Kunst: Alfonso I. d’Este als Mäzen
- Ogni medaglia ha il suo rovescio… Numismatische Politik der Este
- Tizians Beziehung zum Hof von Ferrara – Porträts des Herzogs
- Das Studiolo als Sammlungsraum
- Alfonsos Camerino d’Alabastero
- Zur Provenienz des Zinsgroschen „nella porta d’un armario“
- Ein Porträtdeckel? Zur Hypothese Herbert Siebenhüners
- Überlegungen zur Etymologie des Schrankbegriffs
- Der Medaillenschrank im „primo camerino adorato“
- Tizians Arbeit im Auftrag des Herzogs Alfonso I. d’Este von Ferrara
- ·QVE·SVNT·DEI·DEO· Das Biblische Thema
- Vorbilder und Einflüsse?
- Beschreibung und Analyse des Zinsgroschen
- Zur Theorie des immanenten Selbstbildnisses
- Schönheit vs. Hässlichkeit – Zur Physiognomie
- „Beredte Hände“ – Die Gestik im Zinsgroschen
- Vita activa et contemplativa
- Die Münze
- Spätere Darstellungen der Zinsgroschenthematik
- Tizian: Der Zinsgroschen, 1568. National Gallery, London
- Mariachers „neuer Christus mit dem Zinsgroschen“
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Tizians "Zinsgroschen", ein Frühwerk des Künstlers, das im Kontext der Kunst- und Kulturgeschichte des frühen 16. Jahrhunderts analysiert wird. Die Arbeit beleuchtet die ikonographischen, kunsthistorischen und politischen Bezüge des Gemäldes.
- Die Bedeutung des "Zinsgroschen" als Frühwerk Tizians und seine Einordnung in sein Gesamtwerk.
- Der politische und kulturelle Kontext des Gemäldes im Kontext des Hofes von Alfonso I. d’Este in Ferrara.
- Die numismatische Politik der Este und ihre Bedeutung für die Interpretation des "Zinsgroschen".
- Die ikonographische Analyse des Gemäldes und die Rolle der Physiognomie und Gestik.
- Die Diskussion der Vita activa und Vita contemplativa im Kontext des Werkes und seiner Entstehungszeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die vergessene Bedeutung des "Zinsgroschen" im Vergleich zu anderen Werken Tizians. Sie skizziert die Forschungslücke und die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, bisherige Forschungsleistungen neu zu bewerten und den "Zinsgroschen" als mehr als nur ein Werbegeschenk zu verstehen.
1. Historischer Kontext und biographische Bezüge: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung des Gemäldes, indem es die Biografie Tizians, die politische Situation in Italien und insbesondere in Venedig und Ferrara sowie die Rolle des Hauses Este als Mäzene beschreibt. Es analysiert Tizians Weg als Künstler, seinen Kontakt zu Bellini und Giorgione und seine Beziehung zum Ferrareser Hof.
2. Politik und Kunst: Alfonso I. d’Este als Mäzen: Dieses Kapitel untersucht die Rolle Alfonsos I. d’Este als Kunstmäzen und seinen Einfluss auf Tizians Arbeit. Es analysiert die numismatische Politik der Este, die Bedeutung von Medaillen und Münzen als politische Statements und die Beziehungen zwischen Tizian und dem Hof von Ferrara. Der Fokus liegt auf dem Studiolo als Sammlungsraum und der Provenienz des "Zinsgroschen", inklusive der Diskussion über dessen mögliche Funktion als Porträtdeckel.
3. Tizians Arbeit im Auftrag des Herzogs Alfonso I. d’Este von Ferrara: Dieses Kapitel konzentriert sich auf eine detaillierte Analyse des "Zinsgroschen" selbst. Es untersucht das biblische Thema, mögliche Vorbilder und Einflüsse, die Bildbeschreibung und -analyse (insbesondere die Gegenüberstellung von Christus und dem Pharisäer), die Theorie des immanenten Selbstbildnisses im Gemälde, die Anwendung physiognomischer Prinzipien und die Bedeutung der Gestik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Diskussion der Vita activa und contemplativa und der symbolischen Bedeutung der Münze im Bild.
Schlüsselwörter
Tizian, Zinsgroschen, Alfonso I. d’Este, Ferrara, Renaissance, Italien, Kunstpatronage, Numismatik, Physiognomie, Gestik, Vita activa, Vita contemplativa, Ikonographie, Bildanalyse, Selbstbildnis, Bibel, Matthäusevangelium.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Magisterarbeit: Tizians "Zinsgroschen"
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert Tizians "Zinsgroschen", ein Frühwerk des Künstlers, eingeordnet in den kunst- und kulturgeschichtlichen Kontext des frühen 16. Jahrhunderts. Sie beleuchtet ikonographische, kunsthistorische und politische Bezüge des Gemäldes und untersucht dessen Bedeutung über die eines bloßen Werbegeschenks hinaus.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung des "Zinsgroschen" als Frühwerk Tizians, den politischen und kulturellen Kontext am Hof Alfonsos I. d’Este in Ferrara, die numismatische Politik der Este, die ikonographische Analyse (Physiognomie, Gestik), die Vita activa und contemplativa im Werk, und die Diskussion über die mögliche Funktion des Gemäldes als Porträtdeckel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu historischem Kontext und biographischen Bezügen (Tizians Vita, Italien im 15./16. Jahrhundert, Ferrara und die Este), Politik und Kunst unter Alfonso I. d’Este (Numismatik, Tizians Beziehung zum Hof, das Studiolo), Tizians Arbeit im Auftrag Alfonsos I. (detaillierte Bildanalyse, biblische Thematik, Selbstbildnis), spätere Darstellungen der Thematik und ein Schlusswort. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind enthalten.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die Arbeit zielt darauf ab, die bisherige Forschung zum "Zinsgroschen" neu zu bewerten und dessen Bedeutung im Gesamtwerk Tizians zu ergründen. Sie untersucht die Funktion des Gemäldes im Kontext der politischen und kulturellen Strategien der Este und analysiert die ikonographischen Details, um deren Bedeutung im Kontext der Zeit zu verstehen. Die Hypothese einer möglichen Funktion als Porträtdeckel wird ebenfalls diskutiert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet ikonographische und kunsthistorische Methoden zur Analyse des Gemäldes. Der historische Kontext wird durch die Untersuchung von Quellen zur Biografie Tizians, zur Politik der Este und zur Kultur Ferraras im frühen 16. Jahrhundert erschlossen. Die Interpretation des Bildes beinhaltet die Analyse von Physiognomie, Gestik und Symbolen.
Welche Bedeutung hat der "Zinsgroschen" im Kontext des Gesamtwerks Tizians?
Die Arbeit argumentiert, dass der "Zinsgroschen" trotz seines vermeintlich untergeordneten Status als Frühwerk eine bedeutende Rolle im Verständnis von Tizians künstlerischem Werdegang und dessen Beziehungen zum Hof der Este spielt. Er bietet Einblicke in die frühen künstlerischen Strategien Tizians und dessen Auseinandersetzung mit biblischen Themen und politischen Symbolen.
Welche Rolle spielt die numismatische Politik der Este?
Die numismatische Politik der Este wird als wichtiger Kontext für die Interpretation des "Zinsgroschen" betrachtet. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Medaillen und Münzen als politische Instrumente und zeigt auf, wie diese Praktiken die Entstehung und Bedeutung des Gemäldes beeinflusst haben könnten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tizian, Zinsgroschen, Alfonso I. d’Este, Ferrara, Renaissance, Italien, Kunstpatronage, Numismatik, Physiognomie, Gestik, Vita activa, Vita contemplativa, Ikonographie, Bildanalyse, Selbstbildnis, Bibel, Matthäusevangelium.
- Citation du texte
- Josephine Klingebeil (Auteur), 2010, QVE SVNT DEI DEO - Zwei Seiten einer Medaille, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215284