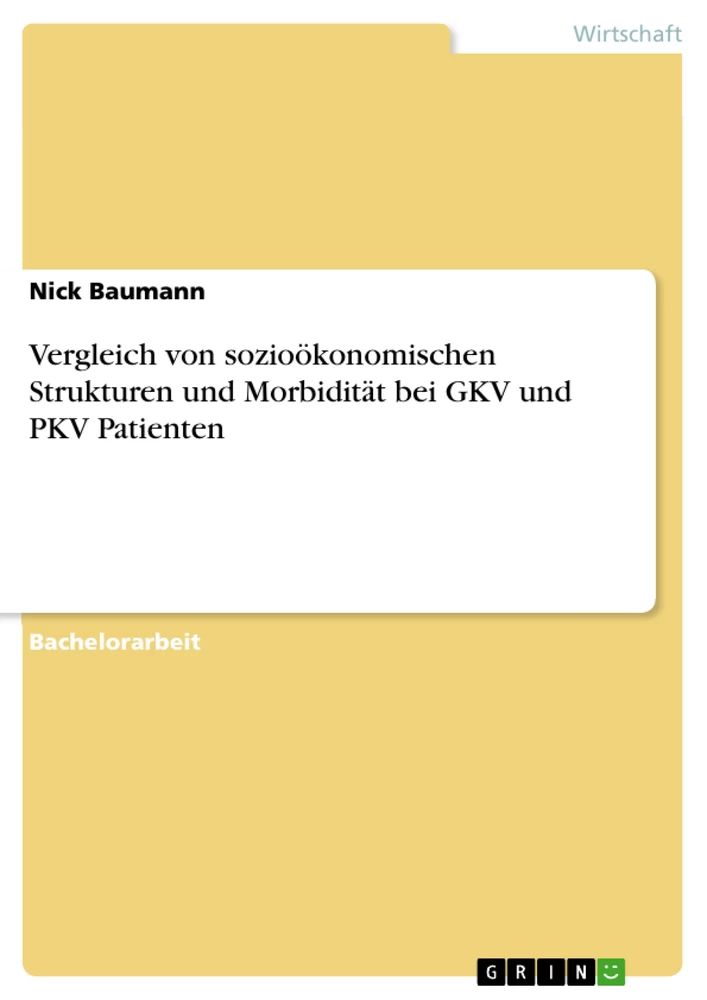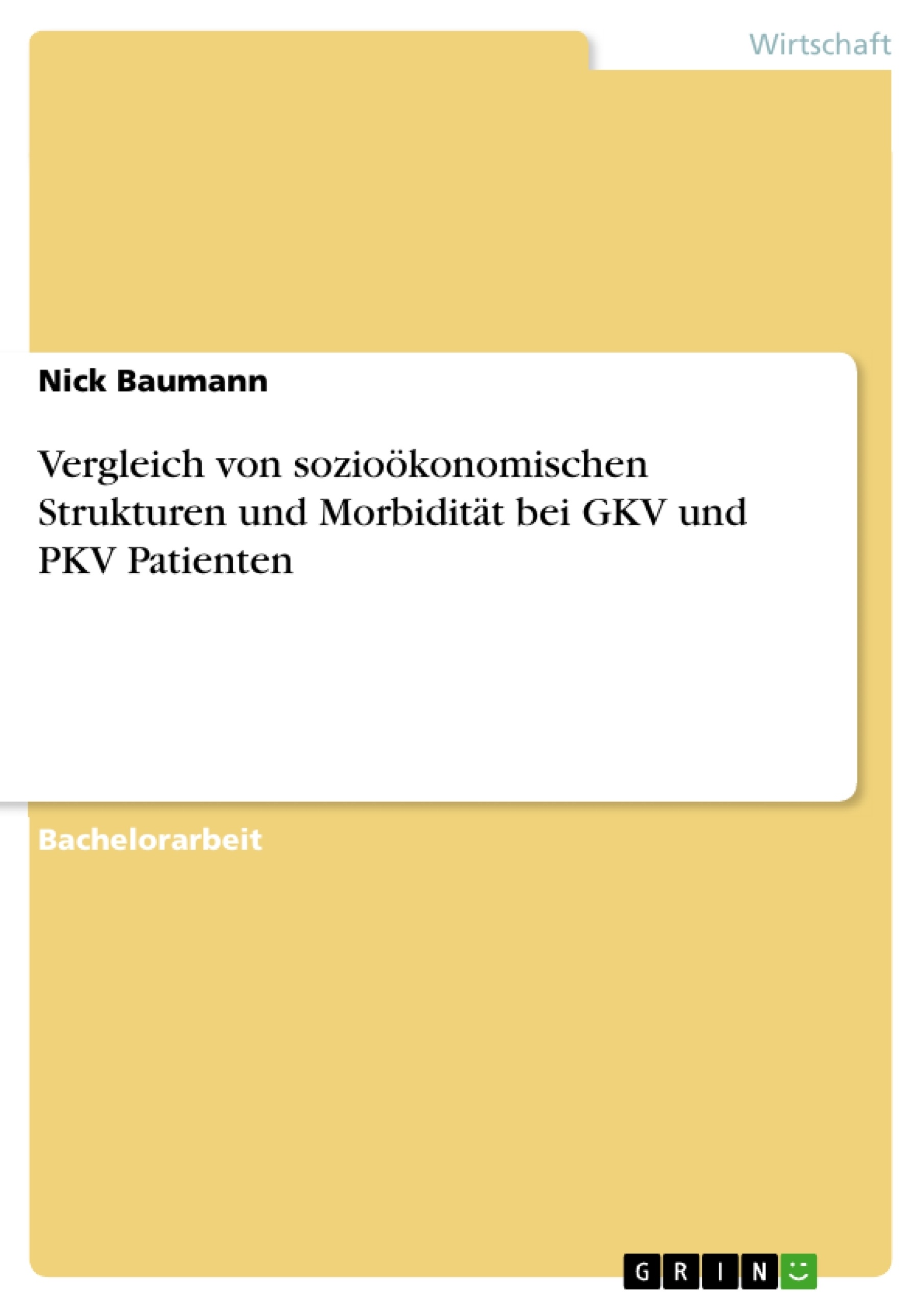[...]Das Thema gesetzlicher Krankenschutz wird oft, heiß und öffentlich diskutiert. Dahinter steht einerseits die Unsicherheit im Krankheitsfall auch langfristig genügend abgesichert zu sein und andererseits der Unmut über eine Versicherungspflicht, mit steigenden Beiträgen aber sinkenden „Kundenservice“ bei medizinischen Leistungen. Ganz anders soll es da den Versicherten der privaten Krankenversicherung (PKV) gehen. [...] Es lässt sich also feststellen, dass die PKV sich trotz geringeren Prämien besser refinanzieren kann als die GKV. Dies klingt paradox wenn die Kosten für das Gesundheitswesen doch steigen. Voraussetzung um in diesem Prozess involviert zu sein ist, dass die Versichertengemeinschaft Kosten verursacht, welche durch die Einnahmen des Versicherers nicht mehr gedeckt werden können. [...]
Zuerst soll der Begriff Gesundheit wissenschaftlich greifbarer gemacht werden um zu klären, welche Facetten unter Gesundheit zu verstehen und zu betrachten sind. Daran anschließend gilt es zu analysieren, durch welche Faktoren Gesundheit gefördert beziehungsweise gehemmt wird. Ziel soll es sein, anhand von ausschlaggebenden sozioökonomischen Indikatoren wie Einkommen, Bildung oder Wohnraum eine gesellschaftliche Unterteilung, von potenziell krank bis potenziell gesund, vornehmen zu können. Danach soll diese Schablonen auf die Versichertengemeinschaft von PKV und GKV gelegt werden, um zu zeigen, dass Privatpatienten aufgrund ihrer sozialen Stellung gesünder sind als Kassenpatienten. Dies soll dann an bestehenden Evaluationen bestätigt werden. Im letzten Schritt soll eine historische Herleitung Aufschluss über die morbiditätsbezogene Schieflage im Gesundheitssystem geben.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zum Begriff der Gesundheit
2.1. Gesundheit als Gut
3. Sozioökonomischen Strukturen und Morbidität
3.1. Schicht und Krankheit
3.2. Sozioökonomische Strukturen als soziale Ungleichheit
3.2.1. Bildung
3.2.2. Beruf
3.2.3. Einkommen
3.2.4. Regionale Lage
3.2.5. Geschlecht und Alter
3.2.6. Individuelles Verhalten
3.2.7. Medizinische Versorgung
3.2.8. Drift Hypothese
3.3. Relevanz für das Gesundheitssystem
4. Morbidität im Vergleich GKV und PKV
4.1. Gesundheitszustand
4.2. Inanspruchnahme von Leistungen
5. Systematische Bedingung und Berücksichtigung von sozialer Ungleichheit und Morbidität bei GKV und PKV
5.1. Entstehung von GKV und PKV
5.1.1. Jüngere Entwicklung der GKV und PKV
5.2. Versicherter Personenkreis
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Sind Privatpatienten gesünder als gesetzlich Versicherte?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass Privatpatienten aufgrund ihrer oft höheren sozioökonomischen Stellung (Einkommen, Bildung) statistisch gesehen eine geringere Morbidität aufweisen.
Welche sozioökonomischen Faktoren beeinflussen die Gesundheit?
Wichtige Indikatoren sind Bildung, Beruf, Einkommen, die regionale Lage sowie das individuelle Gesundheitsverhalten.
Was besagt die „Drift-Hypothese“?
Sie beschreibt den Prozess, bei dem Krankheit zu einem sozialen Abstieg führen kann (z.B. durch Arbeitsplatzverlust), was die Morbidität in unteren sozialen Schichten weiter erhöht.
Wie unterscheiden sich GKV und PKV in der Refinanzierung?
Trotz steigender Kosten im Gesundheitswesen kann sich die PKV oft besser refinanzieren, da ihre Versichertengemeinschaft tendenziell weniger Kosten verursacht.
Gibt es Unterschiede in der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen?
Ja, die Arbeit vergleicht, wie häufig und welche Arten von Leistungen Kassen- und Privatpatienten im Gesundheitssystem abrufen.
- Quote paper
- B.Sc. Nick Baumann (Author), 2011, Vergleich von sozioökonomischen Strukturen und Morbidität bei GKV und PKV Patienten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215314