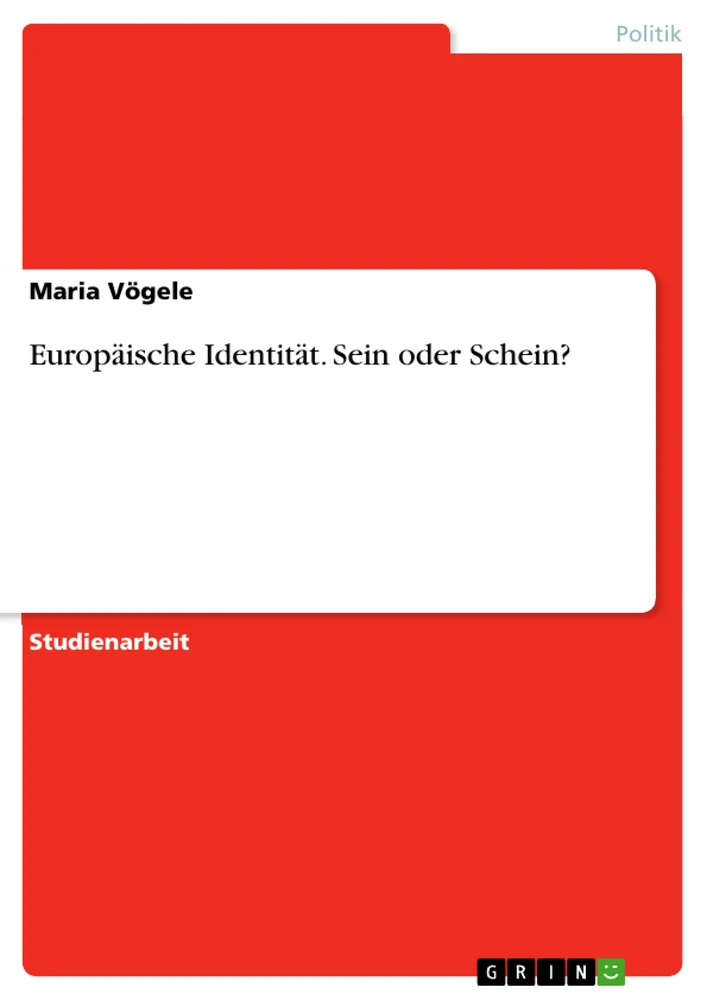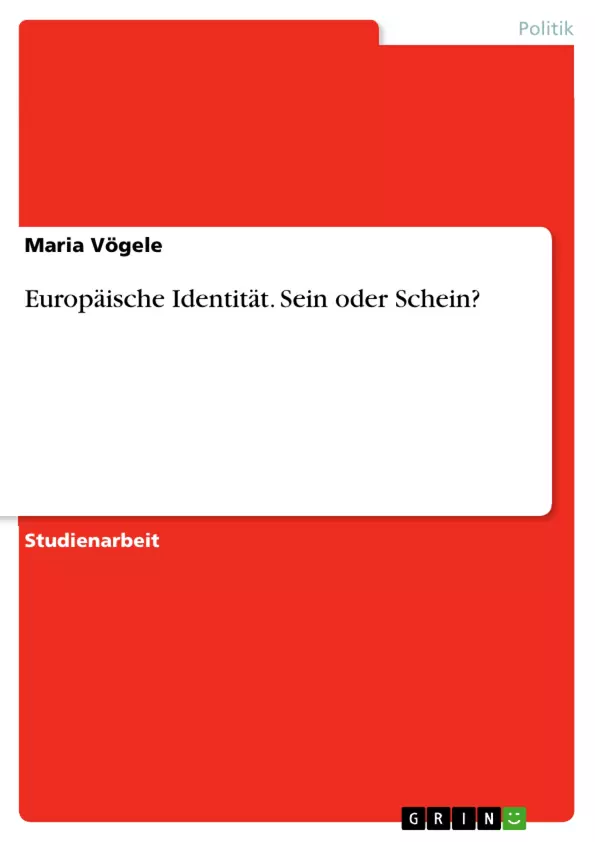Die EU besteht derzeit aus 27 Mitgliedsstaaten. Diese sind zu einem großen Teil Kleinstaaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Jeder der 27 Staaten hat seine Geschichte, seine Sprache, sein kulturelles Gut. Vor gar nicht allzu langer Zeit bekriegten sich einige der Staaten noch untereinander. Angesichts dieser Fakten fällt es einem schwer, zu glauben, dass aus dieser Diversität eine einheitliche Identität entwachsen kann. Vor allem in der größten bisherigen EU-Erweiterungsrunde im Jahr 2004 kamen zahlreiche mitteleuropäische
Kleinstaaten zur EU, die bezüglich ihrer Kultur und ihrer Geschichte stark vom Kulturgut der bisherigen EU-Mitgliedsstaaten abwichen. Identifikation mit einer politischen Struktur ist heute wie damals ein wichtiges Thema in der EU. (...) Die eigentliche Frage, die meiner Arbeit zugrunde liegt, wird lauten: Warum gibt es in der EU keine europäische Identität? Ich gehe also von dem theoretischen Standpunkt aus, dass es aufgrund der verschiedenen Kulturen in Europa mit allem, was dazu gehört, kein einheitliches „Wir-Gefühl“ gibt. Die Unionsbürger identifizieren sich nämlich nach wie vor als Bürger ihres Mitgliedslandes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition der zentralen Begriffe
- Was ist Identität?
- Was ist Kultur?
- Europas „Soul searching“
- Der EU-Osten
- Methodische Vorgehensweise
- Explikation der Fragestellung
- Forschungsmethode
- Forschungsergebnisse
- Wie „europäisch“ fühlen sich die Mitgliedsstaaten vor 2004?
- „Feel European“ nach 2004
- Die einzelnen Länder im Überblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, warum es in der EU keine europäische Identität gibt. Sie analysiert die Herausforderungen, die die kulturelle Vielfalt Europas für die Bildung einer gemeinsamen Identität darstellt, insbesondere im Kontext der EU-Osterweiterung von 2004. Die Arbeit basiert auf einer Analyse von Statistiken der EU-Kommission zum Thema „feel european“ und untersucht, ob die Osterweiterung das „Wir-Gefühl“ der EU-Mitgliedsstaaten beeinflusst hat.
- Die Herausforderungen der kulturellen Vielfalt für die EU-Identität
- Die Bedeutung der Osterweiterung 2004 für die europäische Identität
- Die Rolle der politischen Kommunikation für die Identitätsbildung in der EU
- Die Bedeutung der Selbst-Charakterisierung von EU-Bürgern für die Entstehung einer gemeinsamen Identität
- Die Entwicklung des „Wir-Gefühls“ in den EU-Mitgliedsstaaten vor und nach 2004
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Hintergrund der Arbeit vor. Das zweite Kapitel definiert die zentralen Begriffe Identität und Kultur und erläutert den Prozess von Europas „Soul searching“. Es widmet sich außerdem dem Einfluss des EU-Ostens auf die europäische Identitätsbildung. Das dritte Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf Statistiken der EU-Kommission zum Thema „feel european“ stützt. Es analysiert die Fragestellung, die wichtigsten Hypothesen und die Vorgehensweise bei der Auswertung der Daten. Das vierte Kapitel untersucht die Statistiken vor und nach 2004 und analysiert die Ergebnisse länderspezifisch.
Schlüsselwörter
Europäische Identität, kulturelle Vielfalt, EU-Osterweiterung, „feel european“, politische Kommunikation, Identitätsbildung, Selbst-Charakterisierung, „Wir-Gefühl“, EU-Mitgliedsstaaten.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine einheitliche europäische Identität?
Die Arbeit geht davon aus, dass aufgrund der großen kulturellen Diversität in der EU bisher kein einheitliches „Wir-Gefühl“ entstanden ist.
Welchen Einfluss hatte die Osterweiterung 2004?
Zahlreiche mitteleuropäische Kleinstaaten mit unterschiedlicher Geschichte traten bei, was die Herausforderung einer gemeinsamen Identitätsbildung vergrößerte.
Wie identifizieren sich die meisten EU-Bürger?
Die meisten Bürger identifizieren sich primär über ihre nationale Herkunft und erst sekundär oder gar nicht als Europäer.
Was bedeutet „Feel European“ in den Statistiken?
Dies ist eine Messgröße der EU-Kommission, um den Grad der subjektiven Identifikation der Bürger mit der Europäischen Union zu ermitteln.
Welche Rolle spielt politische Kommunikation für die EU?
Sie ist entscheidend, um die Vorteile der Union zu vermitteln und ein gemeinsames Wertebewusstsein über Landesgrenzen hinweg zu schaffen.
Warum fällt die Identifikation mit der EU so schwer?
Unterschiedliche Sprachen, Kulturen und historische Konflikte zwischen den Mitgliedsstaaten erschweren das Zusammenwachsen zu einer Identität.
- Quote paper
- Bakk. Komm. Maria Vögele (Author), 2013, Europäische Identität. Sein oder Schein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215481