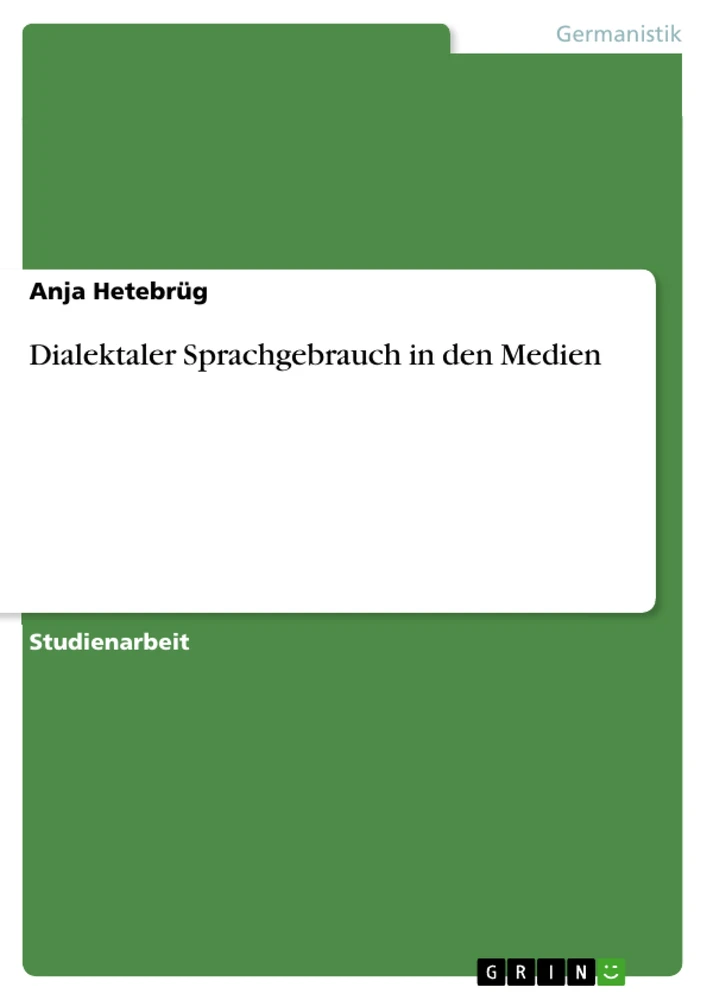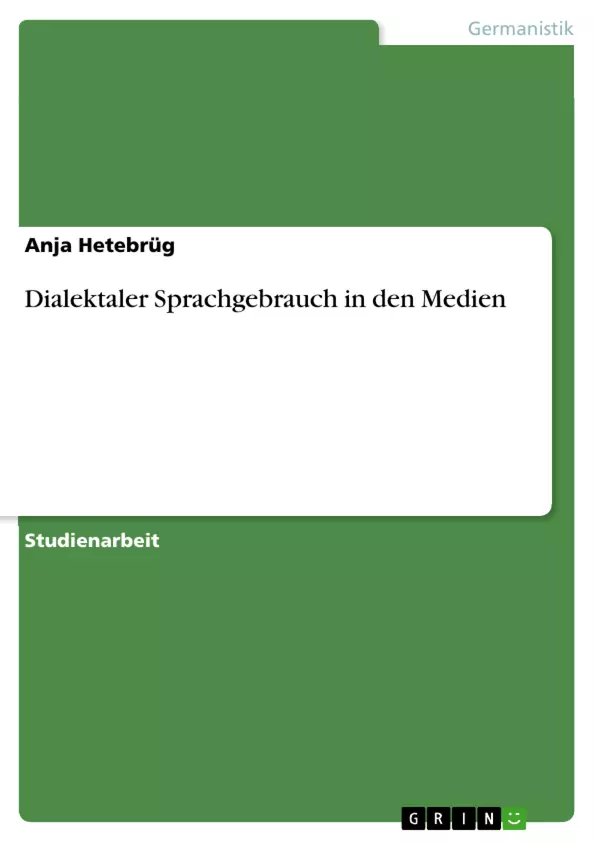Die Mediensprache hat genauso wie die Gegenwartssprache viele verschiedene Variationsmöglichkeiten. Eine Variante dieser Sprache ist der Dialekt in den Medien. In den folgenden Seiten wird dieser dialektale Gebrauch aus historischer Sicht erläutert. Mit den Medien sind in diesem Zusammenhang die Presse, der Hörfunk, das Fernsehen und das Internet gemeint, welche in der Arbeit betrachtet werden. Doch zuerst erfolgt eine Definition der Standardsprache, der Umgangssprache und des Dialekts, um Unterschiede aufzuzeigen, die für das jeweilige Medium konstitutiv sein könnten. Die Ausführungen nehmen vor allem Bezug auf die Arbeit von Erich Straßner aus dem Jahre 1983, da er die geschichtliche Entwicklung des Mediendialekts zumindest bis in die 1980er Jahre gut dargestellt hat. Auf die heutige Situation dieser Sprachform in den Medien wird jeweils kurz eingegangen. Zudem wird die Ausarbeitung angereichert mit anderen Texten, die zum größten Teil spezifische Beispiele darstellen. Die Arbeit beschränkt sich hierbei auf den deutschsprachigen Raum (also Deutschland, teilweise Österreich und die Schweiz).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Standardsprache – Umgangssprache - Dialekt
- Untersuchung der einzelnen Medien
- Presse
- Hörfunk
- Fernsehen
- Internet
- Exkurs: Dialekt in der Werbung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den dialektalen Sprachgebrauch in den Medien aus historischer Perspektive. Der Fokus liegt dabei auf den Medien Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internet. Die Arbeit beleuchtet, wie sich der dialektale Sprachgebrauch in diesen Medien entwickelt hat und welche Rolle er heute spielt. Dabei werden die Unterschiede zwischen Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt definiert und in Bezug zu den jeweiligen Medien gesetzt.
- Die Entwicklung des dialektalen Sprachgebrauchs in den Medien
- Die Rolle des Dialekts in der Presse, im Hörfunk, im Fernsehen und im Internet
- Die Unterschiede zwischen Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt
- Die Bedeutung des Dialekts für die sprachliche Identität und die regionale Kultur
- Die Herausforderungen des dialektalen Sprachgebrauchs in einer globalisierten Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den dialektalen Sprachgebrauch in den Medien als ein relevantes Thema vor. Dabei wird die Bedeutung der Medien für die Verbreitung von Sprache und Kultur hervorgehoben und die historische Entwicklung des dialektalen Sprachgebrauchs in den Medien skizziert.
- Definition: Standardsprache – Umgangssprache - Dialekt: Dieses Kapitel definiert die drei Sprachformen Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt, um die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen ihnen zu verdeutlichen. Die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Analyse des dialektalen Sprachgebrauchs in den Medien wird betont.
- Untersuchung der einzelnen Medien: Dieser Abschnitt beleuchtet den dialektalen Sprachgebrauch in den einzelnen Medienarten. Die Kapitel Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internet analysieren jeweils die Rolle des Dialekts in diesen Medien und untersuchen, wie er genutzt wird, um bestimmte Effekte zu erzielen.
- Exkurs: Dialekt in der Werbung: Dieser Exkurs widmet sich der Verwendung des Dialekts in der Werbung und untersucht, welche Strategien eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu gewinnen und den Absatz zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf den dialektalen Sprachgebrauch in den Medien, insbesondere auf Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internet. Dabei spielen Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt als wichtige Sprachformen eine Rolle. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des dialektalen Sprachgebrauchs in der Geschichte und untersucht seine aktuelle Verwendung in den Medien. Zu den zentralen Themen gehören die sprachliche Identität, regionale Kultur und die Herausforderungen der Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Dialekt in den heutigen Medien?
Dialekt wird in den Medien (Presse, Funk, Fernsehen, Internet) oft gezielt eingesetzt, um Regionalität, Authentizität oder Humor zu vermitteln, steht aber immer im Spannungsfeld zur Standardsprache.
Was ist der Unterschied zwischen Standardsprache und Dialekt?
Die Standardsprache ist die überregionale, normierte Sprachform, während der Dialekt eine regional begrenzte Variante ist, die oft nur mündlich gebraucht wird.
Wie hat sich der Dialektgebrauch im Fernsehen entwickelt?
Historisch war das Fernsehen stark auf die Standardsprache fixiert. Heute wird Dialekt häufiger in Serien, Reportagen oder bei regionalen Sendern verwendet, um Nähe zum Zuschauer zu schaffen.
Warum wird Dialekt in der Werbung genutzt?
In der Werbung dient Dialekt dazu, Vertrauen aufzubauen, Heimatgefühle zu wecken oder ein Produkt als bodenständig und traditionell zu positionieren.
Gibt es Dialekt auch im Internet?
Ja, das Internet ermöglicht durch soziale Medien und Foren eine Renaissance des Dialekts in geschriebener Form, da die Kommunikation dort oft informeller und nähesprachlicher ist.
- Quote paper
- Anja Hetebrüg (Author), 2008, Dialektaler Sprachgebrauch in den Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215757