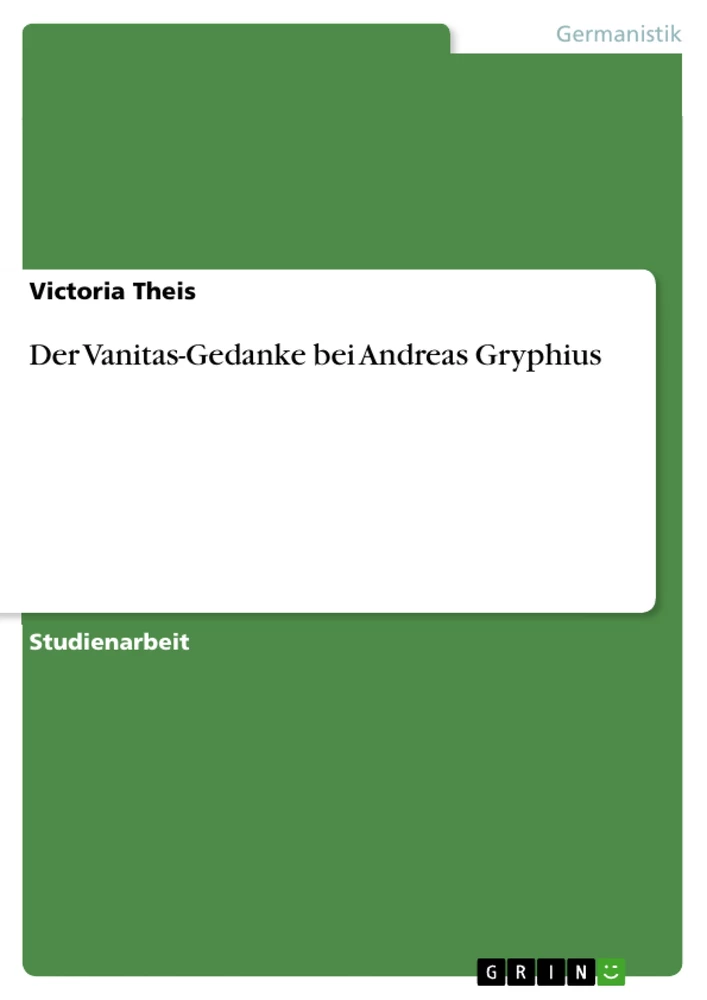Im Fernsehen, Radio, Internet und in Zeitungen ist die Thematik des Älterwerdens und des Todes omnipräsent. Wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft, in der Jugendlichkeit das anzustrebende Ideal darstellt. Falten und graues Haar dagegen sind Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen und unerwünscht. Alles, was ein Mensch besitzen kann, sei es Geld, Macht oder Ruhm, ist auf Erden unbeständig und vergänglich. Nicht nur in unserer Gesellschaft ist dieses Problem von großer Bedeutung.
Bereits in der Bibel wurden der Tod und die Vergänglichkeit beschrieben. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie die Menschen in früheren Generationen mit dieser Thematik umgingen.
Hierbei wird besonders die Zeit des Barock genauer betrachtet werden. Als Beispiel soll ein lyrisches Werk der Barockzeit herangezogen werden.
Der Gedanke der Vergänglichkeit alles Irdischen war eines der bedeutendsten Motive der Barockzeit und prägte vor allem die dichterische Kunst des wohl bekanntesten Lyrikers jener Epoche: Andreas Gryphius.
Zunächst soll beschrieben werden, welche Einflüsse die Dichtkunst Andreas Gryphius’ beeinflusst haben. Der sich anschließende „Vanitas- Gedanke“ gibt Aufschluss über den Ursprung der Vergänglichkeitsvorstellung im Alten und Neuen Testament. Hierbei soll der Vermutung nachgegangen werden, dass die „Eitelkeit“ nicht erst ein Phänomen der barocken Zeit war, sondern ihre Anfänge bereits im christlichen, biblischen Kanon zu finden sind.
Eine weitere Thematik, die behandelt wird, ist der „christliche Stoizismus“. Er ist eng verwandt mit dem Vanitas- Motiv und bietet dem barocken Menschen eine geistige Hilfestellung, um der pessimistischen Grundhaltung mit Rationalität und Akzeptanz entgegenzutreten.
1. EINLEITUNG 3
2. EINFLÜSSE AUF DIE LYRIK GRYPHIUS’ 4
2.1. Literaturhistorische Einordnung 4
3. DER VANITAS- GEDANKE 5
3.1 Der Vanitas- Gedanke im Alten- und Neuen Testament 6
3.2 Christlicher Stoizismus 8
4. INTERPRETATION AN EINEM AUSGEWÄHLTEN BEISPIEL 10
4.1 „Es ist alles eitel“- Andreas Gryphius 10
4.2 Formale Aspekte 11
4.3 Analyse 11
5. VERÄNDERUNGEN AM GEDICHT „VANITAS, VANITATUM ET OMNIA VANITAS. ES IST ALLES GANTZ EYTEL.“ 14
6. DIE ZAHLENKOMBINATION IN DEN LISSAER SONETTEN 16
7. SINNBILDER DER VANITAS UND IHR BIBLISCHER URSPRUNG 18
8. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG 20
9. ANHANG 21
BIBLIOGRAPHIE 22
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- EINFLÜSSE AUF DIE LYRIK GRYPHIUS'
- Literaturhistorische Einordnung
- DER VANITAS- GEDANKE
- Der Vanitas- Gedanke im Alten- und Neuen Testament
- Christlicher Stoizismus
- INTERPRETATION AN EINEM AUSGEWÄHLTEN BEISPIEL
- „Es ist alles eitel"- Andreas Gryphius
- Formale Aspekte
- Analyse
- VERÄNDERUNGEN AM GEDICHT „VANITAS, VANITATUM ET OMNIA VANITAS. ES IST ALLES GANTZ EYTEL."
- DIE ZAHLENKOMBINATION IN DEN LISSAER SONETTEN
- SINNBILDER DER VANITAS UND IHR BIBLISCHER URSPRUNG
- ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG
- ANHANG
- BIBLIOGRAPHIE
- Quellen
- Sekundärliteratur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Vanitas-Gedanken in der Lyrik von Andreas Gryphius. Ziel ist es, die Einflüsse auf Gryphius' Dichtung aufzuzeigen, den Ursprung des Vanitas-Gedankens im Alten und Neuen Testament zu beleuchten und die Bedeutung des christlichen Stoizismus im Kontext der Vergänglichkeitsvorstellung zu erörtern. Darüber hinaus wird anhand eines ausgewählten Beispiels, dem Gedicht „Es ist alles eitel", die Thematik der Vergänglichkeit und ihre Darstellung in Gryphius' Werk analysiert. Die Arbeit befasst sich auch mit den Veränderungen, die Gryphius an seinem Gedicht „Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel." vorgenommen hat, sowie mit der Zahlenkombination in seinen Lissaer Sonetten und den Sinnbildern der Vanitas in Bezug auf ihren biblischen Ursprung.
- Einflüsse auf Gryphius' Lyrik
- Der Vanitas-Gedanke in der Bibel
- Christlicher Stoizismus als Antwort auf die Vergänglichkeit
- Analyse des Gedichts „Es ist alles eitel"
- Sinnbilder der Vanitas und ihre biblische Grundlage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Alters und des Todes in der heutigen Gesellschaft sowie in der Literatur des Barock vor. Sie führt den Vanitas-Gedanken als zentrales Motiv der Barockzeit ein und stellt Andreas Gryphius als einen der bedeutendsten Lyriker dieser Epoche vor. Die Einleitung skizziert die Themenfelder der Arbeit, die sich mit den Einflüssen auf Gryphius' Dichtung, dem Ursprung des Vanitas-Gedankens, dem christlichen Stoizismus sowie mit der Analyse eines ausgewählten Beispiels und der Sinnbilder der Vanitas befassen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Einflüsse auf Gryphius' Lyrik, indem es die literaturhistorische Einordnung des 17. Jahrhunderts im Kontext des Dreißigjährigen Krieges und seiner Auswirkungen auf die deutsche Dichtung beschreibt. Es werden die Werke von Christoph Weigel, Volker Press, Martin Heckel und Ernst Walter Zeeden herangezogen, um die Bedeutung des Dreißigjährigen Krieges als Religionskrieg und Machtkampf zu verdeutlichen. Das Kapitel beleuchtet auch die Blütezeit der schlesischen Dichtung trotz der Kriegswirren und den Einfluss des „Buches von der deutschen Poeterey" von Martin Opitz auf die Entwicklung der deutschen Dichtung.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Vanitas-Gedanken und seinem Ursprung im Alten und Neuen Testament. Es werden Bibelzitate des Predigers Salomo und Hiob sowie die Interpretation des Vanitas-Begriffs im Kontext der menschlichen Existenz und des ständigen Wechsels von Glück und Elend analysiert. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle des christlichen Stoizismus als geistige Hilfestellung, um der pessimistischen Grundhaltung der Barockzeit mit Rationalität und Akzeptanz entgegenzutreten. Es werden die Werke von Thomas Mann, Franz Bächtiger, Ferdinand van Ingen und Dirk Nießner herangezogen, um die Bedeutung des Vanitas-Motivs in der deutschen Literatur des Barock zu veranschaulichen.
Das vierte Kapitel analysiert das Gedicht „Es ist alles eitel" von Andreas Gryphius. Es werden die formalen Aspekte des Sonetts, wie Reimschema, Rhythmus und Syntax, sowie die inhaltliche Analyse des Gedichts im Hinblick auf die Thematik der Vergänglichkeit, die Verwendung von Antithesen und Exempla sowie die Darstellung des Menschen als Spielball der Fortuna untersucht. Das Kapitel beleuchtet auch die didaktische Funktion des Gedichts und die Botschaft, dass der Mensch trotz der Eitelkeit der Welt auf das Jenseits hoffen und sein Leben nutzen sollte.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Veränderungen, die Gryphius an seinem Gedicht „Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel." vorgenommen hat. Es werden die Unterschiede zwischen den beiden Fassungen des Gedichts in Bezug auf die Uberschrift, die Verwendung des „Ich" und des „Du", die Einhaltung der Sprachregularien von Martin Opitz sowie die Auswirkungen dieser Veränderungen auf den Sinngehalt des Gedichts analysiert. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle des „Buches von der deutschen Poeterey" von Martin Opitz als Einflussfaktor auf Gryphius' Dichtung.
Das sechste Kapitel untersucht die Zahlenkombination in den Lissaer Sonetten von Andreas Gryphius. Es werden die Erkenntnisse von Marian Szyrocki über die Zahlenkomposition in Gryphius' Sonetten und deren Bezug zum christlichen Weltenbau und zur Exegesetradition dargestellt. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Zahlen „Drei" und „Sieben" in den Lissaer Sonetten und deren symbolische Bedeutung im Kontext des christlichen Glaubens. Es werden auch alternative Zahlenkombinationen und deren Deutungen im Hinblick auf die Apokalyptik und die Stimme des Johannes als Sprecher des Gedichts „Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel." diskutiert.
Das siebte Kapitel analysiert die Sinnbilder der Vanitas in Gryphius' Werk und ihren biblischen Ursprung. Es werden die Metaphern der Blume, der Asche, des Traums, des Schattens und des Windes in Bezug auf ihre symbolische Bedeutung für die Vergänglichkeit und ihre biblische Grundlage untersucht. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Bildmetaphorik in Gryphius' Dichtung und deren Funktion, den Vanitas-Gedanken auf metaphorischer Ebene zu verdeutlichen.
Die zusammenfassende Betrachtung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und betont die Bedeutung des Vanitas-Gedankens als zentrales Motiv in der Lyrik von Andreas Gryphius. Es wird der Einfluss des christlichen Glaubens und des Stoizismus auf Gryphius' Dichtung sowie der Einfluss des „Buches von der deutschen Poeterey" von Martin Opitz auf Gryphius' Schaffen hervorgehoben. Die Arbeit verdeutlicht, dass der Vanitas-Gedanke keine Erfindung der Barockzeit ist, sondern seine Ursprünge bereits im Alten und Neuen Testament zu finden sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Vanitas-Gedanken, die Vergänglichkeit, Andreas Gryphius, Barocklyrik, christlicher Stoizismus, Bibel, Sinnbilder, Zahlenkombination, Lissaer Sonette, „Es ist alles eitel". Die Arbeit analysiert die Einflüsse auf Gryphius' Dichtung, den Ursprung des Vanitas-Gedankens in der Bibel, die Bedeutung des christlichen Stoizismus als Antwort auf die Vergänglichkeit sowie die Sinnbilder der Vanitas und ihre biblische Grundlage.
- Quote paper
- Victoria Theis (Author), 2013, Der Vanitas-Gedanke bei Andreas Gryphius, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215928