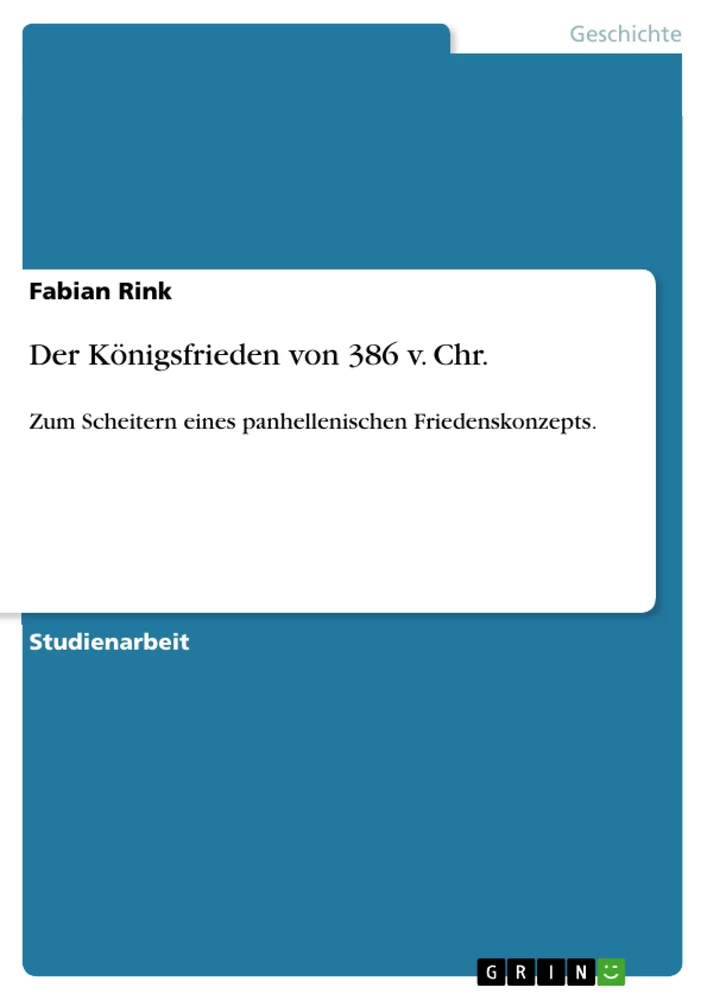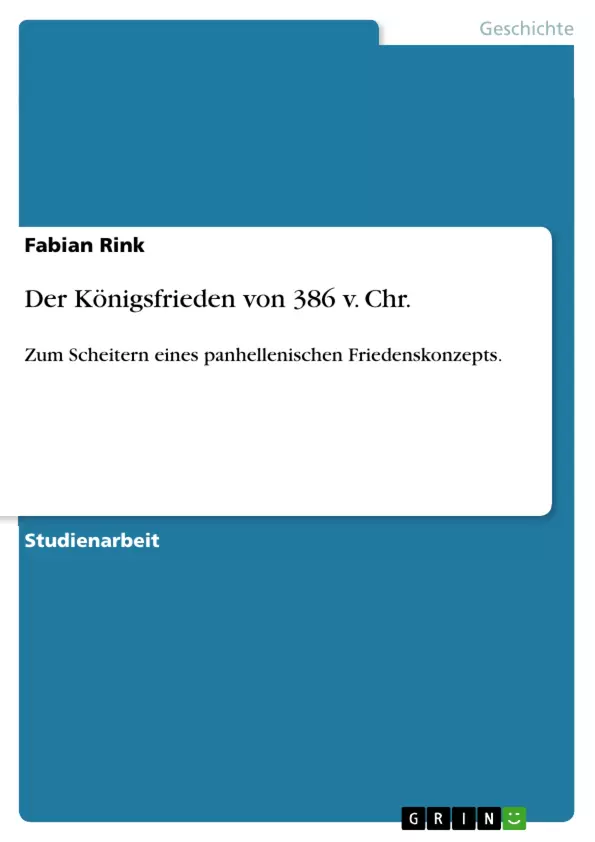Das 4. Jahrhundert v. Chr. war in der griechischen Welt geprägt von einem fast permanenten Kriegszustand. Trotz etlicher Bemühungen gelang es den hellenischen Poleis nicht, eine dau-erhafte Stabilisierung und Befriedung der zwischenstaatlichen Beziehungen herbeizuführen. Obwohl Krieg in der griechischen Antike als durchaus probates Mittel der Politik galt, wurden die permanenten Waffengänge in Hellas von den Zeitgenossen als Verschlechterung im Ge-gensatz zu den Zuständen früherer Zeit angesehen, wie Martin Jehne herausgearbeitet hat. Dies steht im augenfälligen Kontrast zum Anspruch des Königsfriedens von 387/6 v. Chr. und der Idee eines allgemeinen Friedens – der koiné eiréne – die damit einherging und sich im Laufe des 4. Jahrhunderts v. Chr. zum bedeutendsten Referenzpunkt der Außenpolitik grie-chischer Staaten entwickelte. Diese Arbeit soll die Gründe aufzeigen, wieso der Königsfrie-den trotz seines programmatischen Anspruchs, sowie die weiteren Friedensschlüsse des 4. Jahrhunderts, die ihn erneuerten und weiterentwickelten, keinen dauerhaften Friedenszustand hervorbringen konnten. Darüber hinaus soll geklärt werden, inwieweit in der Idee der koine eiréne selbst, angelegt und verwirklicht im Vertragsschluss von 386 v. Chr., eine kriegsför-dernde Struktur enthalten war. Dieses neue panhellenische Konzept und seine faktische Um-setzung nach dem Korinthischen Krieg stellte ein Novum in der bisherigen Geschichte des antiken Griechenlands dar, eine Untersuchung zum Friedensschluss von 386 v. Chr. erscheint gerade im Hinblick auf dessen scheinbare Unzulänglichkeiten lohnenswert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sparta als Nutznießer des Königsfriedens?
- Der Zweite Attische Seebund und die koine eiréne von 362 v. Chr. — Stabilitätsphasen auf Grundlage des Königsfriedens?
- Der Königsfrieden — Segen für die griechischen Kleinstaaten?
- Das Theoriedefizit des Königsfriedens als Kriegskatalysator?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Scheitern des Königsfriedens von 386 v. Chr. als panhellenisches Friedenskonzept im 4. Jahrhundert v. Chr. Sie analysiert die Gründe, warum der Königsfrieden trotz seines programmatischen Anspruchs und weiterer Friedensschlüsse des 4. Jahrhunderts keinen dauerhaften Friedenszustand hervorbringen konnte. Des Weiteren wird die Frage geklärt, ob in der Idee der koine eiréne selbst, die im Vertragsschluss von 386 v. Chr. verwirklicht wurde, eine kriegsfördernde Struktur angelegt war.
- Die Rolle Spartas als Nutznießer des Königsfriedens
- Die Bedeutung des Zweiten Attischen Seebundes und der koine eiréne von 362 v. Chr. für die Stabilität Griechenlands
- Die Auswirkungen des Königsfriedens auf die kleineren griechischen Poleis
- Das Theoriedefizit des Königsfriedens als Kriegskatalysator
- Die Bedeutung des Korinthischen Bundes unter Philipp II. für die Stabilität Griechenlands
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Rolle Spartas im Königsfrieden. Es wird untersucht, ob Sparta als Ordnungsmacht durch den persischen Großkönig eingesetzt wurde und ob der Königsfrieden lediglich ein Instrument Spartas zur Zerschlagung von Machtgebilden war.
Das zweite Kapitel analysiert die Stabilitätsphasen des 4. Jahrhunderts v. Chr., die auf der Grundlage des Königsfriedens entstanden sind. Es wird untersucht, ob der Zweite Attische Seebund und die koine eiréne von 362 v. Chr. zu einer kurzen Phase relativer Stabilität in Griechenland führten.
Das dritte Kapitel untersucht den Nutzen des Königsfriedens für die kleineren griechischen Poleis. Es wird erörtert, ob die kleineren Poleis durch den Vertragsschluss lediglich zu Objekten politischen Taktierens der Großmächte wurden oder ob sie vom Königsfrieden profitierten.
Das vierte Kapitel analysiert das Theoriedefizit des Königsfriedens als Kriegskatalysator. Es wird untersucht, ob die Kriege der Folgezeit bereits in den Bestimmungen des Königsfriedens angelegt waren und ob die fehlende Institutionalisierung zwischenstaatlicher Beziehungen zu einem Scheitern des Friedenskonzepts beitrug.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Königsfrieden, die koine eiréne, die Polisautonomie, das 4. Jahrhundert v. Chr., Sparta, Athen, Theben, die griechischen Kleinstaaten, der Zweite Attische Seebund, der Korinthische Bund, Philipp II., der persische Großkönig, das Theoriedefizit des Königsfriedens und die Kriegskatalysatoren.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Königsfrieden von 386 v. Chr.?
Der Königsfrieden (auch Frieden von Antalkidas) war ein Vertrag, der den Korinthischen Krieg beendete und die persische Oberhoheit über die kleinasiatischen Griechen festschrieb.
Was bedeutet der Begriff 'koine eiréne'?
Es bedeutet "Allgemeiner Friede". Es war ein neues Konzept, das einen dauerhaften Frieden zwischen allen griechischen Poleis auf Basis von Autonomie und Gleichberechtigung anstrebte.
Warum scheiterte der Königsfrieden als Friedensinstrument?
Er scheiterte, weil Großmächte wie Sparta ihn instrumentalisierten, um gegnerische Machtgebilde unter dem Vorwand der "Autonomie" zu zerschlagen, was neue Kriege provozierte.
Welche Rolle spielte Persien bei diesem Vertrag?
Der persische Großkönig fungierte als Schiedsrichter und Garantiemacht. Er diktierte die Bedingungen, um ein Gleichgewicht der Kräfte in Griechenland zu halten und seine eigenen Interessen zu sichern.
War Sparta der alleinige Nutznießer des Friedens?
Zunächst ja, da Sparta als "Vollstrecker" des Friedens seine Hegemonie festigen konnte. Langfristig führte diese aggressive Politik jedoch zum Aufstieg von Theben und dem Ende der spartanischen Vorherrschaft.
- Citation du texte
- Fabian Rink (Auteur), 2012, Der Königsfrieden von 386 v. Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215948