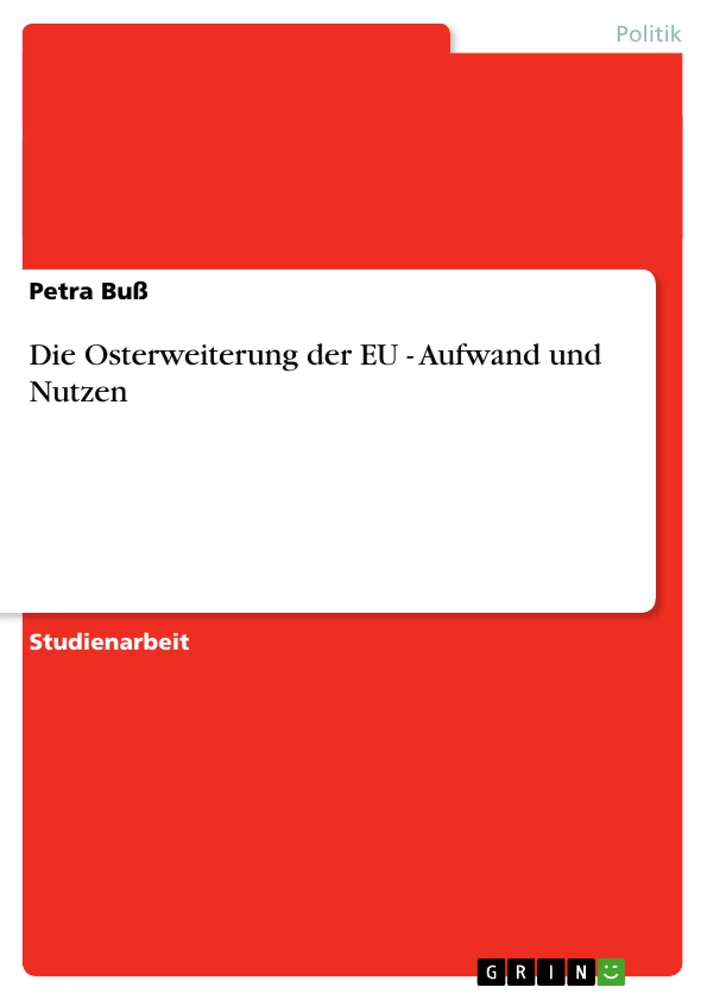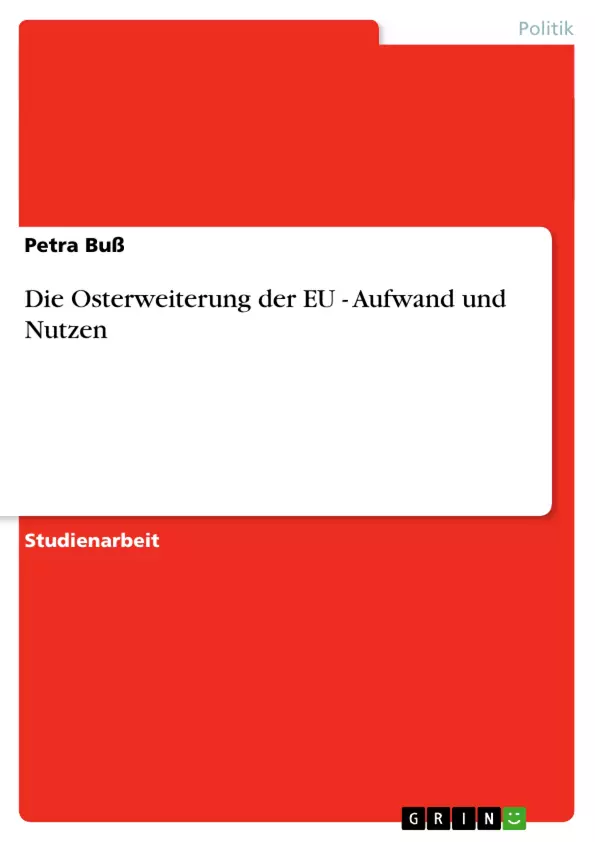Die tiefgreifenden Veränderungen der letzten zehn Jahre in den mittel- und osteuropäischen Staaten haben die Grundlage der Europapolitik völlig verändert: Die kommunistischen Regime sind zusammengebrochen, der Warschauer Pakt und der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) haben sich aufgelöst, und die Staatenwelt des ehemaligen Ostblocks hat sich neu formiert. Die Europäische Gemeinschaft hatte sich bis dahin als stabile Größe in Europa erwiesen und wurde deshalb zum natürlichen Adressaten vielfältiger und weitreichender Erwartungen von Seiten der teilweise neu entstandenen Staaten Mittel- und Osteuropas (MOE). Sie sehen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) als eine Chance auf politische und vor allem wirtschaftliche Stabilität, auf Modernisierung und Sicherheit.
Bei der Erweiterungsrunde vom 1. Januar 1995, als Finnland, Schweden und Österreich in die EU aufgenommen wurden, waren die Beitrittsverhandlungen - trotz der Streitpunkte um Alpentransit und Fischfangquote - relativ rasch und problemlos verlaufen, denn es handelte sich damals bereits um Länder, die über eine ausreichende bis gute Wirtschaftskraft verfügten. Daher konnte die Erweiterung um die ehemaligen EFTA-Staaten auch ohne Reformen innerhalb der Gemeinschaft bestritten werden.
In bezug auf die mittel- und osteuropäischen Staaten ist es jedoch fraglich, ob gleichzeitig mit der geplanten Weiterentwicklung der bestehenden Gemeinschaft zu einer Wirtschafts- und Währungsunion und zur Politischen Union auch eine rasche Vollmitgliedschaft aller mittel- und osteuropäischen Staaten zu bewältigen ist. Sie müssen zunächst ihre politischen Systeme zu stabilen Demokratien entwickeln und in wirtschaftlicher Hinsicht zu funktionierenden Marktwirtschaften umgebaut werden, und sicherheitspolitisch gilt es, die Gefahr gewaltsamer, ethnisch-national motivierter Konflikte abzuwenden und die Sicherheit aller Staaten Europas zu garantieren. Neben den wirtschaftlichen Strukturproblemen stellt sich auch die Frage, wie eine Europäische Union mit 20 Mitgliedern und mehr verfaßt sein muß, damit sie handlungsfähig bleibt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Aufwand und dem Nutzen der EU-Osterweiterung. Ziel ist es, die Frage zu klären, ob oder auf welche Art und Weise eine Osterweiterung der EU aufgrund der herausgearbeiteten Ergebnisse sinnvoll ist und welche Gefahren und Risiken sowie Chancen und Herausforderungen sich dabei ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bestimmungen und Grundlagen für die Osterweiterung
- 2.1 Annäherung der MOE-Staaten an die EU
- 2.1.1 Regionale Zusammenschlüsse und Europaabkommen
- 2.1.2 Bedingungen für die EU-Osterweiterung
- 2.2 Agenda 2000
- 2.2.1 Erweiterung als Herausforderung
- 2.2.2 Bewertung nach den Beitrittskriterien
- 2.2.3 Folgen der Erweiterung und Intensivierung der Heranführungsstrategie
- 2.2.4 Der neue Finanzierungsrahmen für den Zeitraum von 2000 bis 2006
- 2.3 Einigungen bezüglich der Agenda 2000
- 2.4 Bisherige Ergebnisse im Beitrittsprozess
- 2.1 Annäherung der MOE-Staaten an die EU
- 3. Aufwand und Nutzen der Osterweiterung für die EU
- 3.1 Aufwand
- 3.1.1 Komplizierte Ausgangslage und zeitlicher Aufwand
- 3.1.2 Kosten
- 3.2 Nutzen
- 3.2.1 Stabilitäts- und sicherheitspolitischer Aspekt
- 3.2.2 Wirtschaftlicher Aspekt
- 3.1 Aufwand
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Aufwand und dem Nutzen der EU-Osterweiterung. Sie untersucht die Bestimmungen und Grundlagen für die Osterweiterung, analysiert die Agenda 2000 und deren Einfluss auf den Beitrittsprozess, und diskutiert die Chancen und Risiken der Erweiterung für die EU.
- Annäherung der mittel- und osteuropäischen Staaten (MOE-Staaten) an die EU
- Bedingungen für die EU-Mitgliedschaft
- Agenda 2000 und deren Auswirkungen auf die Erweiterung
- Kosten und Nutzen der Osterweiterung für die EU
- Sicherheitspolitische und wirtschaftliche Aspekte der Erweiterung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa nach dem Fall des Kommunismus beschreibt und die Bedeutung der EU-Mitgliedschaft für die MOE-Staaten hervorhebt. Anschließend werden die Bestimmungen und Grundlagen für die Osterweiterung vorgestellt. Hierbei werden die Annäherung der MOE-Staaten an die EU durch regionale Zusammenschlüsse und Europaabkommen sowie die Bedingungen für die Mitgliedschaft beleuchtet. Kapitel 2 analysiert die Agenda 2000 und deren Auswirkungen auf die Erweiterung, einschließlich der neuen Finanzierungsrahmen und der Heranführungsstrategie. Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit dem Aufwand und dem Nutzen der Osterweiterung für die EU. Die Diskussion konzentriert sich auf die Kosten, den zeitlichen und organisatorischen Aufwand, sowie die stabilitäts- und sicherheitspolitischen sowie wirtschaftlichen Vorteile der Erweiterung. Schließlich werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und bewertet.
Schlüsselwörter
EU-Osterweiterung, MOE-Staaten, Agenda 2000, Beitrittsprozess, Aufwand, Nutzen, Stabilität, Sicherheit, Wirtschaft, Kosten, Chancen, Risiken, Heranführungsstrategie, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmotive für die EU-Osterweiterung?
Zentral sind die Schaffung politischer und wirtschaftlicher Stabilität in Europa sowie die Förderung von Demokratie und Sicherheit nach dem Fall des Kommunismus.
Was ist die "Agenda 2000"?
Ein Aktionsprogramm der EU zur Vorbereitung auf die Erweiterung, das Reformen der Agrarpolitik, der Kohäsionspolitik und den Finanzrahmen für 2000-2006 festlegte.
Welchen wirtschaftlichen Nutzen bringt die Osterweiterung?
Sie eröffnet neue Märkte, fördert den Handel und bietet durch die Integration der MOE-Staaten langfristige Wachstumspotenziale für die gesamte EU.
Welche Kosten und Risiken sind mit der Erweiterung verbunden?
Zu den Herausforderungen zählen die hohen Transferzahlungen, die Modernisierung schwacher Wirtschaftssysteme und das Risiko ethno-nationaler Konflikte.
Welche Bedingungen müssen Beitrittskandidaten erfüllen?
Sie müssen stabile demokratische Institutionen, eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit zur Übernahme des EU-Besitzstandes (Acquis communautaire) nachweisen.
- Quote paper
- Petra Buß (Author), 1999, Die Osterweiterung der EU - Aufwand und Nutzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21612