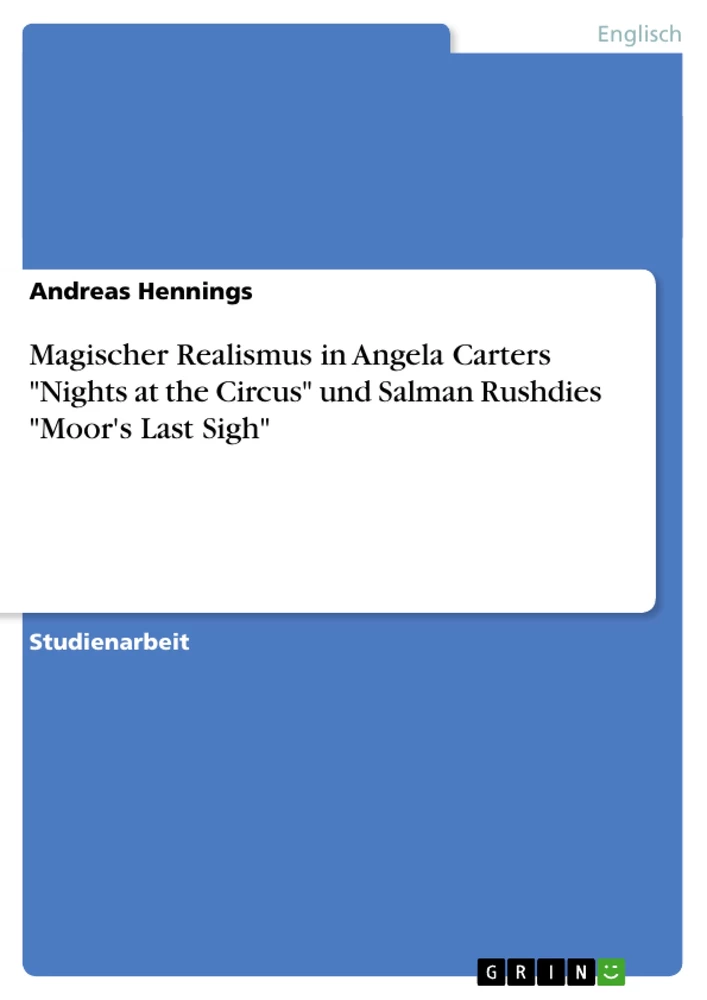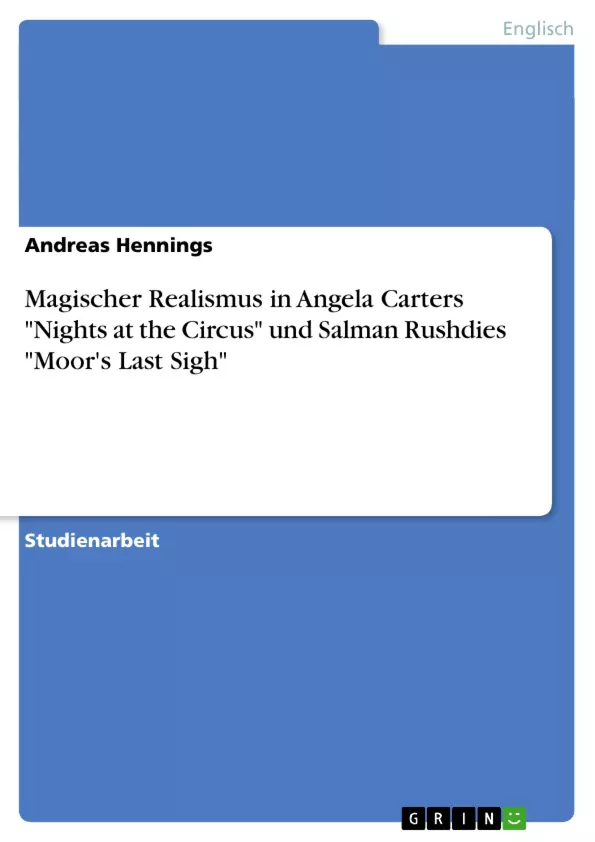Magischer Realismus - der Begriff allein scheint schon ein Widerspruch in sich selbst zu sein. Magie und Realität scheinen uns heute inkompatibel, da sich seit dem Zeitalter der Aufklärung das Denken der Menschen, speziell ihr Verständnis von Wirklichkeit, grundlegend geändert hat. In den modernen, aufgeklärten Gesellschaft des westlichen Kulturkreises wird die Magie meist mit Zauberei, Aberglaube und „Humbug“ assoziiert. Vorgänge und Erscheinungen, die nicht mit Hilfe der Wissenschaften und ihrer Logik erklärbar sind, werden von den meisten Menschen als „irrationell“ und daher „unmöglich“ abgetan. Diese Haltung ist durchaus nachvollziehbar, können doch die Tricks bekannter Zauberer (oder besser: Illusionisten) leicht durch Sinnestäuschung oder das Präparieren der
verwendeten Gegenstände erklärt werden. Eine Folge davon ist, daß wir versuchen, nicht erklärbare, „übernatürliche“ Erfahrungen, die die
meisten von uns bestimmt schon wenigstens einmal in ihrem Leben gemacht haben, in ein rationelles Schema zu pressen, anstatt sie als Teil der Wirklichkeit zu akzeptieren. Auch in der Literatur sind wir gewohnt, Realität und Fiktion zu trennen. Die Glaubwürdigkeit eines
Romans, zum Beispiel, beurteilen wir aus einem Vergleich der dargestellten Charaktere und Inhalte mit unserer Lebenswirklichkeit.
Jeder, der sich dem Studium der Literatur der Gegenwart widmet, wird irgendwann einmal auf den Begriff „Magischer Realismus“ oder seinen Entsprechungen „magic(al) realism“ (in der englischen und
amerikanischen Literaturwissenschaft) beziehungsweise „realismo mágico“ (in der hispanoamerikanischen Literaturwissenschaft) stoßen.
Da dieser Begriff für die Werke unterschiedlichster Autoren mit verschiedenen ethnischen oder kulturellen Hintergründen verwendet wird, sowohl in der Kunst- und Literaturkritik als auch in der
Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft, werde ich im ersten Teil der vorliegenden Arbeit versuchen, den Ausdruck „Magischer Realismus“ genauer zu definieren, so daß er an Klarheit gewinnt und für eine wissenschaftliche Arbeit verwendet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Magischer Realismus
- Problemstellung und Methodik
- Begriffsgeschichte
- F. Roh und M. Bontempelli: Die Väter des Begriffs
- Die weitere Verwendung des Begriffs in Europa
- „Realismo mágico“ in Südamerika
- Zusammenfassung
- Angela Carters „Nights at the Circus“
- Strukturanalyse
- Fevvers - Die „neue“ Frau
- Madame Schrecks Museum
- Tiere - Die besseren Menschen?
- Sibirien
- Salman Rushdies „Moors Last Sigh“
- Strukturanalyse
- Moor
- Die Fliesen von Cochin
- Die Stewardess
- Kontrastive Analyse, Ergebnisse und Diskussion der Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Einsatz des „Magischen Realismus“ in den Romanen „Nights at the Circus“ von Angela Carter und „Moors Last Sigh“ von Salman Rushdie. Im ersten Teil wird der Begriff „Magischer Realismus“ anhand seiner historischen Entwicklung und Verwendung beleuchtet. Anschließend wird untersucht, wie diese beiden Romane das Genre des Magischen Realismus nutzen und wie sie sich dabei unterscheiden.
- Begriffsgeschichte und Definition des Magischen Realismus
- Analyse des Magischen Realismus in „Nights at the Circus“
- Analyse des Magischen Realismus in „Moors Last Sigh“
- Kontrastive Analyse beider Romane
- Diskussion der verwendeten Sekundärliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Magischer Realismus“ ein und erläutert die Relevanz dieses literarischen Stils in der Gegenwartsliteratur. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Geschichte des Begriffs „Magischer Realismus“ und analysiert verschiedene Definitionen und Interpretationen dieses literarischen Stils.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich Angela Carters „Nights at the Circus“. Er untersucht die Struktur des Romans und analysiert die Verwendung des Magischen Realismus in Bezug auf die Darstellung der Protagonistin Fevvers, die besondere Rolle des Museums von Madame Schreck und die Rolle von Tieren im Roman.
Der dritte Teil der Arbeit konzentriert sich auf Salman Rushdies „Moors Last Sigh“. Die Struktur des Romans wird analysiert und die Verwendung des Magischen Realismus in Bezug auf die Figur des Moor, die Fliesen von Cochin und die Rolle der Stewardess wird untersucht.
Schlüsselwörter
Magischer Realismus, Angela Carter, Salman Rushdie, „Nights at the Circus“, „Moors Last Sigh“, Realismus, Fantasie, Interkulturalität, Postkolonialismus, Gender, Geschlechterrollen, Mythos, Mythen, Märchen, Erzählkunst, Metafiktion, Literaturwissenschaft, Literaturkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Magischer Realismus?
Ein literarischer Stil, bei dem magische Elemente als selbstverständlicher Teil einer ansonsten realistisch dargestellten Welt erscheinen.
Wer prägte den Begriff „Magischer Realismus“?
Der Begriff geht ursprünglich auf den Kunstkritiker Franz Roh (1925) zurück und wurde später von Autoren wie Massimo Bontempelli weiterentwickelt.
Wie nutzt Angela Carter den Magischen Realismus in „Nights at the Circus“?
Sie verwendet ihn unter anderem zur Darstellung der Protagonistin Fevvers, einer Frau mit Flügeln, und zur Hinterfragung von Geschlechterrollen.
Welche Rolle spielt der Magische Realismus bei Salman Rushdie?
In „Moors Last Sigh“ nutzt Rushdie den Stil, um komplexe Themen wie Interkulturalität, Postkolonialismus und indische Geschichte zu verweben.
Wie unterscheidet sich Magischer Realismus von Fantasy?
Während Fantasy oft eigene Welten mit eigenen Regeln erschafft, bleibt der Magische Realismus in unserer Realität verankert, in der das Übernatürliche nicht hinterfragt wird.
- Quote paper
- Andreas Hennings (Author), 2003, Magischer Realismus in Angela Carters "Nights at the Circus" und Salman Rushdies "Moor's Last Sigh", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21712