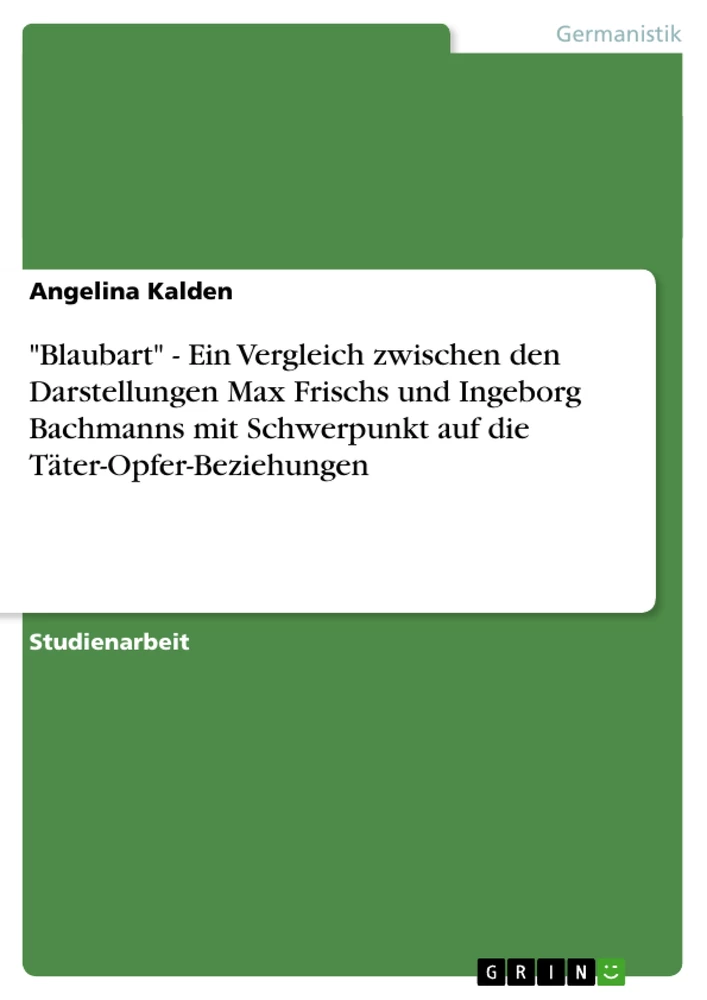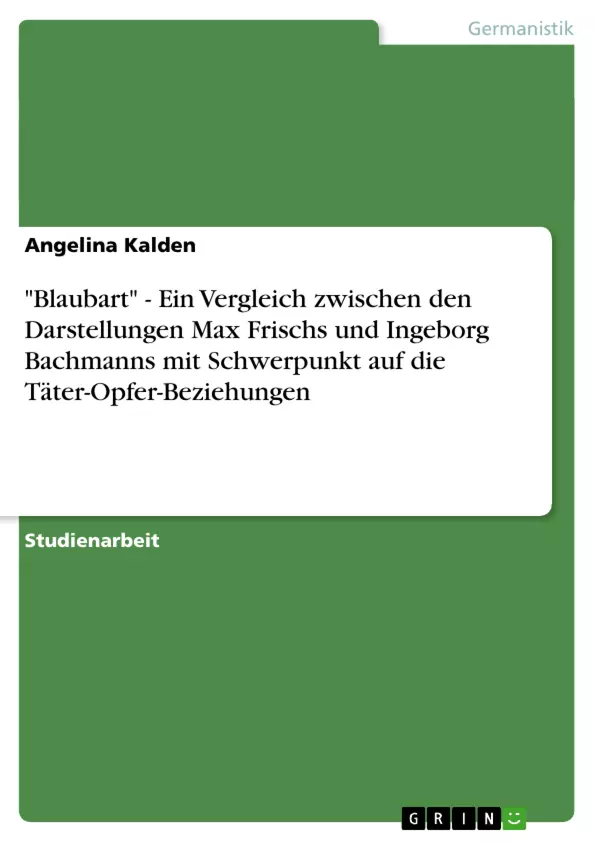Der Blaubartstoff, der auf das Märchen Blaubart von Charles Perrault zurückgeht, ist im Verlauf der Zeit häufig aufgegriffen und verändert worden. Diese Veränderungen reichen von geringen Abweichungen und leicht veränderten Darstellungsweisen bis zu Erzählungen, die nur noch Elemente des Blaubartstoffes enthalten und teils durch die Weiterentwicklung des Menschenbildes, wie bei Frischs Darstellung, in der die Scheidung bereits möglich war, geprägt sind.
Max Frisch soll seine Anregungen nach Walter Schmitz (1985: 152) durch die Erzählungen von Ingeborg Bachmann Der Fall Franza und Anatole Frances Blaubarts sieben Frauen erhalten haben. Die Motivation durch Bachmann ergibt sich vermutlich aus der Tatsache, dass die beiden früher eine Beziehung geführt haben. Anatole France hat die Blaubartthematik umgedreht und Blaubart als einen unschuldigen, gütigen Menschen dargestellt, der aufgrund seiner Schüchternheit immer an die falschen Frauen gerät, die ihn ausnutzen, betrügen oder hintergehen. Frisch interessierte sich in seinen Texten eine Zeit lang sehr dafür, den Mann neben der Frau unschuldig darzustellen, wodurch er sich wahrscheinlich von France inspirieren ließ.
Diese Arbeit beabsichtigt eine Untersuchung vorzunehmen, wie Max Frisch und Ingeborg Bachmann mit der Blaubartthematik umgingen und welche Bezüge, Konvergenzen und Divergenzen zum ursprünglichen Blaubart nach Perrault bzw. zwischen den beiden Darstellungen bestehen. Dabei soll der Schwerpunkt auf die jeweilige Darstellung der Beziehung zwischen Mann und Frau bzw. Täter und Opfer und das dahinter stehende Machtverhältnis gelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Täter und Opfer bei Charles Perrault
- 2.1 Perraults Blaubart
- 2.2 Die Frauen bei Perrault
- 2.3 Fazit
- 3 Täter und Opfer bei Ingeborg Bachmann
- 3.1 Jordan
- 3.2 Franza
- 3.3 Fazit
- 4 Täter und Opfer bei Max Frisch
- 4.1 Herr Schaad
- 4.2 Rosalinde Zogg
- 4.3 Fazit
- 6 Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Blaubartthematik bei Ingeborg Bachmann und Max Frisch im Vergleich zu Charles Perraults ursprünglichem Märchen. Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen Mann und Frau, insbesondere auf den Rollen von Täter und Opfer und dem dahinterliegenden Machtverhältnis.
- Untersuchung der unterschiedlichen Interpretationen der Blaubartthematik durch Bachmann, Frisch und Perrault
- Analyse der Charaktere und ihrer Motivationen, insbesondere der Beziehung zwischen Täter und Opfer
- Betrachtung des Machtverhältnisses zwischen Mann und Frau in den verschiedenen Darstellungen
- Erforschung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Interpretationen des Blaubartstoffes
- Analyse der Auswirkungen der jeweiligen Darstellungen auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Blaubartthematik und die verschiedenen Interpretationen, die über die Zeit entstanden sind. Es beleuchtet die Motivationen von Bachmann und Frisch, sich mit dem Blaubartstoff zu befassen, und legt den Fokus auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft.
Kapitel 2 analysiert die Darstellung von Täter und Opfer bei Charles Perrault. Es beleuchtet Blaubarts Charakter, seine Motivationen und die Rolle der Frauen in seinem Märchen.
Kapitel 3 befasst sich mit der Interpretation der Blaubartthematik bei Ingeborg Bachmann. Es stellt den Charakter von Jordan und sein Verhalten gegenüber Franza dar und analysiert die Rolle der Frau in dieser Beziehung.
Kapitel 4 analysiert die Darstellung der Blaubartthematik bei Max Frisch. Es beleuchtet die Beziehung zwischen Herr Schaad und Rosalinde Zogg und untersucht die Rollen von Täter und Opfer in dieser Konstellation.
Schlüsselwörter
Blaubartthematik, Täter und Opfer, Machtverhältnis, Geschlechterrollen, Interpretationen, Perrault, Bachmann, Frisch, Jordan, Franza, Herr Schaad, Rosalinde Zogg.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ursprung der Blaubart-Thematik?
Der Stoff geht auf das berühmte Märchen von Charles Perrault zurück, in dem ein wohlhabender Mann seine Ehefrauen ermordet, sobald sie ein verbotenes Zimmer betreten.
Wie interpretieren Max Frisch und Ingeborg Bachmann diesen Stoff?
Beide Autoren modernisieren das Thema. Während Perrault ein klassisches Märchen schrieb, nutzen Frisch und Bachmann den Stoff, um komplexe psychologische Täter-Opfer-Beziehungen und Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau zu untersuchen.
Welche Rolle spielt die „Schuld“ in Max Frischs Darstellung?
Frisch interessiert sich oft für die Darstellung des Mannes, der sich unschuldig fühlt oder als gütig dargestellt wird, ähnlich wie in der Blaubart-Version von Anatole France.
Was wird in Ingeborg Bachmanns „Der Fall Franza“ analysiert?
Die Arbeit untersucht die Figur Jordan und seine Beziehung zu Franza, wobei der Fokus auf der Unterdrückung und dem psychologischen Leid der Frau liegt.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den verschiedenen Blaubart-Versionen?
Zentrales Thema bleibt in allen Werken das Machtgefälle in der Geschlechterbeziehung und die Frage nach der Identität und dem Schicksal der „Opfer“.
- Quote paper
- Angelina Kalden (Author), 2003, "Blaubart" - Ein Vergleich zwischen den Darstellungen Max Frischs und Ingeborg Bachmanns mit Schwerpunkt auf die Täter-Opfer-Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21716