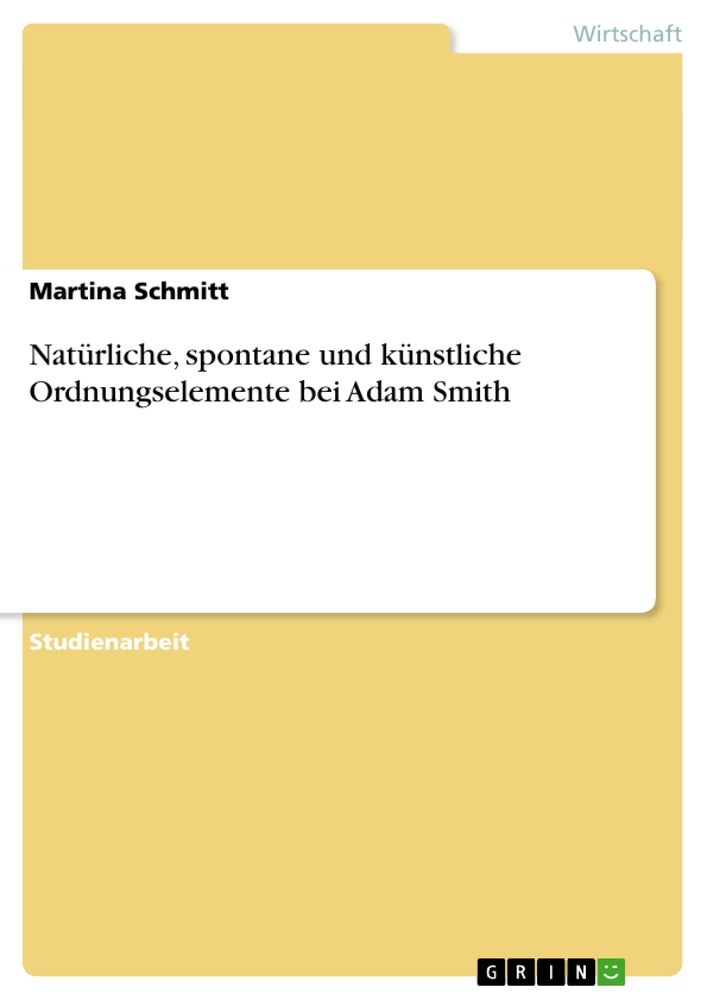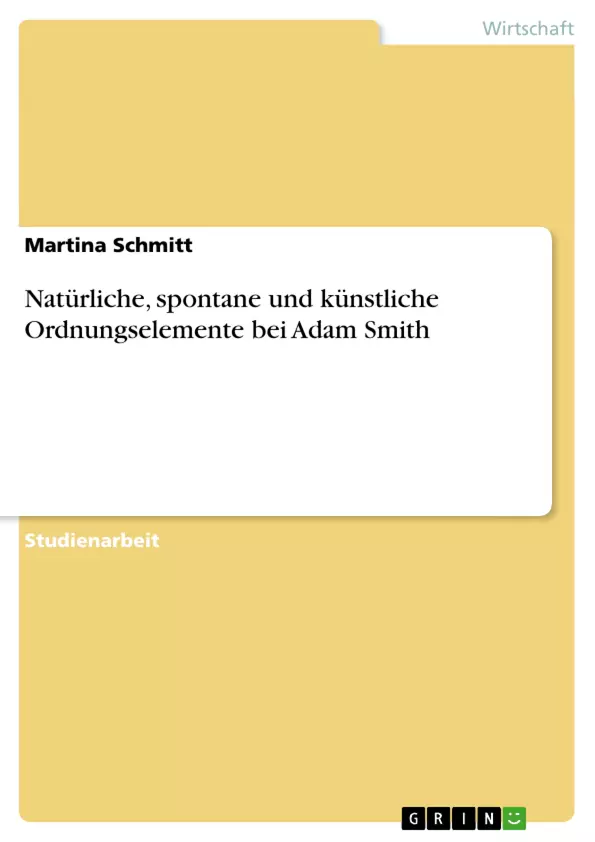Adam Smith (1723 – 1790) ist der Begründer der klassischen ökonomischen Theorie
und zählt bis heute zu den bedeutendsten Ökonomen der Geschichte.
Ordnungstheoretische Überlegungen bilden einen wesentlichen Bestandteil der Theorie
von Adam Smith: der Aufbau der Gesellschaftsordnung spielt sowohl in seinen ökonomischen
als auch in seinen moralphilosophischen Schriften eine zentrale Rolle.
Bemerkenswert ist, dass Smith seiner Ordnungstheorie ein wirklichkeitsnahes Menschenbild
zugrundelegt. Er entwirft keine Gesellschaftsordnung nach ideologischen
Vorstellungen, sondern leitet seine Ordnungstheorie aus tatsächlich beobachteten
Verhaltensweisen der Menschen ab.1
Das Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, inwieweit die Theorie der Gesellschaftsordnung
von Adam Smith Elemente einer natürlichen, künstlichen und spontanen Ordnung
enthält.
Hierzu wird zunächst in Kapitel 2 kurz auf das Leben und die Werke von Adam Smith
sowie auf die philosophische Lehre des Utilitarismus, der seine Theorie zugeordnet
werden kann, eingegangen. Im Anschluss daran befasst sich das dritte Kapitel mit verschiedenen
Formen der gesellschaftlichen Ordnung. Es werden die Begriffe der natürlichen,
künstlichen und spontanen Ordnung erläutert und voneinander abgegrenzt. Die
folgenden Kapitel 4 bis 6 sind jeweils einer der oben genannten Formen der Gesellschaftsordnung
in der Theorie von Adam Smith gewidmet. Es wird gezeigt, dass Elemente
aller betrachteten Ordnungstypen im Ansatz von Smith enthalten sind, und dargestellt,
wie sie konkret zum Ausdruck kommen.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
1 Vgl. Düppen, B., Utilitarismus, 1996, S. 78.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Historische Positionierung von Adam Smith
- Leben und Schriften von Adam Smith
- Der Utilitarismus
- Formen der gesellschaftlichen Ordnung
- Natürliche Ordnungselemente bei Adam Smith
- Deismus und Naturrecht als Basis der Gesellschaftsordnung
- Die Bedeutung der natürlichen Anlagen für das Wirtschaftsleben
- Das Eigeninteresse
- Die Sympathie
- Der Mensch als Gemeinschaftswesen
- Die natürliche Neigung zum Tausch
- Spontane Ordnungselemente bei Adam Smith
- Die Koordination der individuellen Handlungen durch die unsichtbare Hand
- Die Arbeitsteilung
- Künstliche Ordnungselemente bei Adam Smith
- Das System der natürlichen Freiheit
- Die Aufgaben des Staates
- Die Schaffung und Durchsetzung von Rechtssicherheit
- Die Wahrung der äußeren Sicherheit
- Die Förderung der Interessen der Allgemeinheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ordnungstheorie von Adam Smith und zeigt auf, inwieweit sie Elemente einer natürlichen, künstlichen und spontanen Ordnung beinhaltet. Die Arbeit analysiert Smiths Werk, um die verschiedenen Ordnungselemente zu identifizieren und zu erläutern, wie sie in seinen Ausführungen zum Ausdruck kommen.
- Die Rolle des Deismus und des Naturrechts in Smiths Gesellschaftsordnung
- Das Konzept der unsichtbaren Hand und ihre Auswirkungen auf die Koordination individueller Handlungen
- Die Bedeutung von Eigeninteresse, Sympathie und der natürlichen Neigung zum Tausch im Wirtschaftsleben
- Die Bedeutung der Arbeitsteilung für den Wohlstand der Nationen
- Die Aufgaben des Staates im System der natürlichen Freiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung von Adam Smith als Begründer der klassischen ökonomischen Theorie. Kapitel zwei beleuchtet das Leben und die Werke von Adam Smith sowie die philosophische Lehre des Utilitarismus, der seine Theorie zugeordnet werden kann. Kapitel drei befasst sich mit verschiedenen Formen der gesellschaftlichen Ordnung und definiert die Begriffe der natürlichen, künstlichen und spontanen Ordnung.
Kapitel vier widmet sich den natürlichen Ordnungselementen in Smiths Theorie. Hier werden die Grundlagen der Gesellschaftsordnung, die Bedeutung der natürlichen Anlagen für das Wirtschaftsleben und die Rolle von Eigeninteresse, Sympathie und der natürlichen Neigung zum Tausch diskutiert. Kapitel fünf beleuchtet die spontane Ordnung in Smiths Theorie und zeigt, wie die Koordination individueller Handlungen durch die unsichtbare Hand und die Arbeitsteilung zum Wohlstand beitragen. Kapitel sechs behandelt die künstlichen Ordnungselemente und analysiert das System der natürlichen Freiheit sowie die Aufgaben des Staates in der Gewährleistung von Rechtssicherheit, äußerer Sicherheit und der Förderung der Interessen der Allgemeinheit.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Ordnungstheorie von Adam Smith, insbesondere mit den Begriffen der natürlichen, spontanen und künstlichen Ordnung. Die zentralen Themen sind das Konzept der unsichtbaren Hand, die Rolle des Eigeninteresses und der Sympathie im Wirtschaftsleben, die Bedeutung der Arbeitsteilung und die Aufgaben des Staates im System der natürlichen Freiheit. Weitere Schlüsselbegriffe sind Deismus, Naturrecht, Utilitarismus und die klassische ökonomische Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Ordnungselemente nach Adam Smith?
Smith unterscheidet zwischen natürlicher Ordnung (Naturrecht), spontaner Ordnung (Marktmechanismen) und künstlicher Ordnung (staatliche Rahmenbedingungen).
Was symbolisiert die „unsichtbare Hand“?
Sie steht für die spontane Ordnung, bei der die Koordination individueller Handlungen ohne zentrale Steuerung zum Wohlstand der Allgemeinheit führt.
Welche Rolle spielt das Eigeninteresse bei Smith?
Das Eigeninteresse ist ein natürliches Element, das Menschen zum Tausch und zur Arbeitsteilung antreibt, was wiederum die wirtschaftliche Entwicklung fördert.
Was sind die Aufgaben des Staates laut Adam Smith?
Der Staat bildet die künstliche Ordnung und ist zuständig für Rechtssicherheit, äußere Sicherheit und öffentliche Einrichtungen, die dem Gemeinwohl dienen.
Wie hängen Sympathie und Wirtschaft zusammen?
Smith sieht den Menschen als Gemeinschaftswesen; Sympathie ist die moralische Basis, die das Handeln in der Gesellschaft reguliert und ergänzt das ökonomische Eigeninteresse.
- Quote paper
- Martina Schmitt (Author), 2003, Natürliche, spontane und künstliche Ordnungselemente bei Adam Smith, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21884