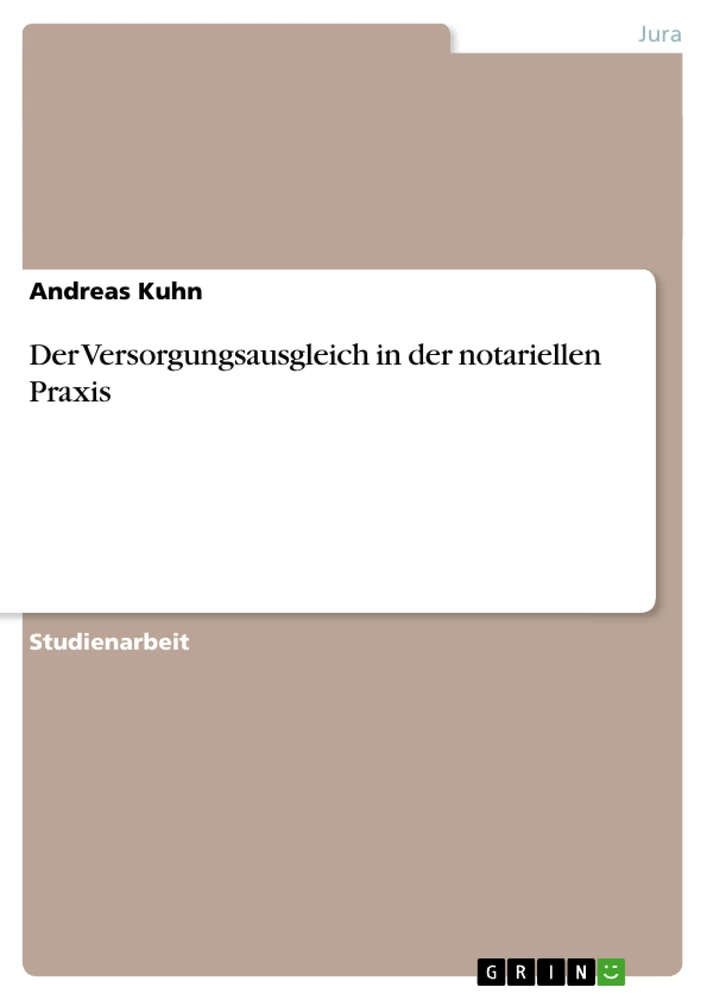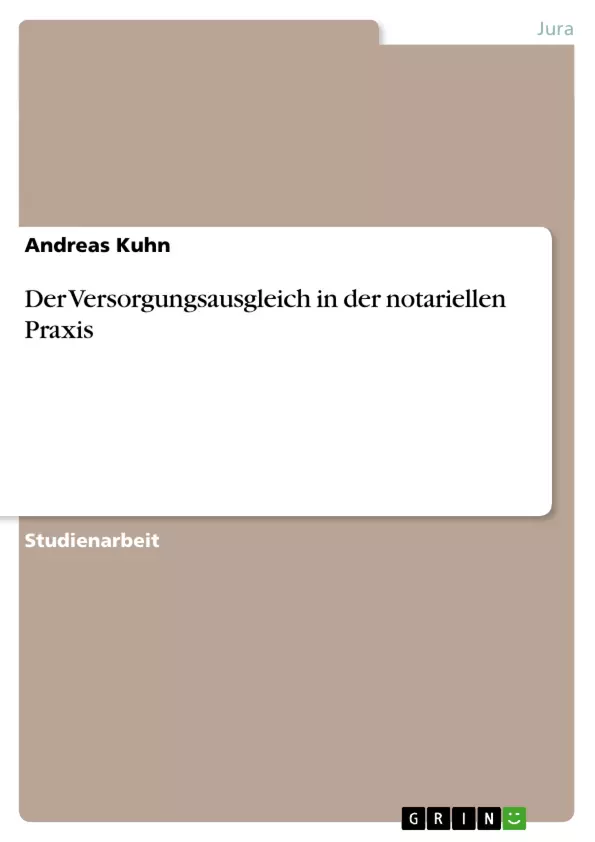Die unbefriedigende soziale und rechtliche Position der teilweise oder überhaupt nicht berufstätigen Ehefrau im Falle der Scheidung einer Ehe war ebenso wie der Gedanke, dass Versorgungsanrechte für den Fall des Alters und/oder der Invalidität wie anderes Vermögen während der Ehezeit von beiden Ehegatten gemeinsam erarbeitet werden, Anlass für die Einführung des Versorgungsausgleiches durch das 1. Eherechtsre formgesetz vom 14. Juni 1976 (vgl. Planken, Die soziale Sicherung der nicht erwerbstätigen Frau, 1961; Beschluss Nr. II 4 der Sozialrechtlichen Arbeitsgemeinschaft des 47. Juristentags 1968; Beschluss Nr. 21 b der Zivilrechtlichen Abteilung des 48. Deutschen Juristentags; Beitzke, RdA 1971, S. 99 (101ff.); Bogs in: Eherechtsreform, hsrg. von Bogs, Deubner, u.a,, 1971, S.96 (113ff.); Begründung der Bundesregierung zum Entwurf des 1. EheRG, BTDr. 7/650, S.61, 71, 154). Damals wie auch heute ist noch in der Mehrzahl aller Ehen die Aufgabenteilung dergestalt geregelt, dass der Ehemann erwerbstätig ist, während die gar nicht oder teilweise berufstätige Ehefrau die Haushaltsführung sowie die Kindererziehung übernimmt. Der durch das 1. EheRG eingeführte Versorgungsausgleich sollte dem ausgleichsberechtigten Ehegatten, meist der Ehefrau, eine eigenständige Sicherung schaffen (BT-Drucks 7/650 S.155; BT-Drucks 7/4361 S.18) und dessen Alterssicherung und/oder Invalidität von den Vorstellungen über den Unterhaltssatz lösen (vgl. Stellungsnahme des BMJ BVerfGE 53, 257, 2872, FamRZ 1980, 326, 330). Der Versorgungsausgleich sollte dadurch realisiert werden, dass die während der Ehezeit erworbenen Anwartschaften gleichmäßig auf beide Ehegatten verteilt werden und zwar unabhä ngig vom jeweiligen Güterstand der Ehegatten – mit Ausnahme des § 1408 Abs. 2 BGB – (§§ 1587 Abs. 1 Satz 1, 1587a Abs. 1 BGB).
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1 Grundgedanke und Zweck
- Kapitel 2 Allgemeines zum Versorgungsausgleich
- 1. Der Anwendungsbereich des Versorgungsausgleichs
- 2. Prinzip der Ehezeit
- 3. Versorgungsausgleich und Güterstand
- 4. Verfahren über den Versorgungsausgleich
- 5. Übergangsrecht und Verfassungsmäßigkeit
- 6. Deutsch-deutsche Fragen
- 7. Der Versorgungsausgleich und das Internationale Privatrecht (IPR)
- Kapitel 3 Arten des Versorgungsausgleichs
- 1. Der Versorgungsausgleich durch Wertausgleich (§§ 1587a-1587e BGB)
- 2. Der schuldrechtliche Versorgungsausgleich (§§ 1587f – 1587n BGB)
- Kapitel 4 Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich
- 1. Eheverträge nach § 1408 Abs. 2 BGB
- 2. Scheidungsvereinbarung nach § 1587o BGB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Versorgungsausgleich in der notariellen Praxis. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen und praktischen Aspekte des Versorgungsausgleichs zu geben. Die Arbeit richtet sich an Notaranwärter und andere juristische Fachkräfte, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
- Rechtliche Grundlagen des Versorgungsausgleichs
- Arten des Versorgungsausgleichs (Wertausgleich, schuldrechtlicher Ausgleich)
- Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich (Ehevertrag, Scheidungsvereinbarung)
- Praktische Anwendung des Versorgungsausgleichs in der notariellen Praxis
- Spezifische Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 Grundgedanke und Zweck: Dieses Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis des Versorgungsausgleichs, indem es dessen zentralen Gedanken und Zweck erläutert. Es wird die Bedeutung der rechtlichen Absicherung des Versorgungsausgleichs im Kontext von Ehescheidungen hervorgehoben und die sozialen und wirtschaftlichen Implikationen für die betroffenen Ehegatten beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Gerechtigkeit und dem Ausgleich von Versorgungsansprüchen, die während der Ehezeit erworben wurden. Das Kapitel dient als Einführung und bildet die Basis für die detaillierten Erörterungen in den folgenden Kapiteln.
Kapitel 2 Allgemeines zum Versorgungsausgleich: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in den Versorgungsausgleich, indem es dessen Anwendungsbereich, das Prinzip der Ehezeit, die Interaktion mit unterschiedlichen Güterständen, die Verfahrensabläufe, das Übergangsrecht, verfassungsrechtliche Aspekte, deutsch-deutsche Besonderheiten und die Berücksichtigung des internationalen Privatrechts detailliert untersucht. Es bildet somit den Rahmen für das Verständnis der komplexen Rechtsmaterie des Versorgungsausgleichs und bereitet den Leser auf die detaillierteren Ausführungen in den nachfolgenden Kapiteln vor. Die verschiedenen Aspekten werden systematisch dargestellt und beleuchten die Vielschichtigkeit des Themas.
Kapitel 3 Arten des Versorgungsausgleichs: Dieses Kapitel differenziert zwischen den beiden Hauptarten des Versorgungsausgleichs: dem Wertausgleich und dem schuldrechtlichen Ausgleich. Es analysiert die jeweiligen gesetzlichen Grundlagen (§§ 1587a-1587e BGB und §§ 1587f – 1587n BGB), erläutert die unterschiedlichen Berechnungsmethoden und die damit verbundenen praktischen Auswirkungen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Unterschiede und der Auswahl der jeweils passenden Variante in Abhängigkeit von den individuellen Umständen des Einzelfalls. Die verschiedenen Möglichkeiten werden anhand von Beispielen illustriert und miteinander verglichen.
Kapitel 4 Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich: Dieses Kapitel behandelt die Möglichkeiten, den Versorgungsausgleich vertraglich zu regeln, sowohl im Ehevertrag als auch in der Scheidungsvereinbarung. Es analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen (§ 1408 Abs. 2 BGB und § 1587o BGB), die Grenzen der Gestaltungsfreiheit und die möglichen Auswirkungen unterschiedlicher Vertragsgestaltungen auf die Rechte und Pflichten der Ehegatten. Die Kapitel betrachtet verschiedene Szenarien, wie den vollständigen, teilweisen oder einseitigen Ausschluss des Versorgungsausgleichs, und untersucht die rechtlichen Folgen dieser Vereinbarungen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und den damit verbundenen Herausforderungen in der notariellen Praxis.
Schlüsselwörter
Versorgungsausgleich, Ehevertrag, Scheidungsvereinbarung, Wertausgleich, schuldrechtlicher Ausgleich, notarielle Praxis, § 1587a BGB, § 1587f BGB, § 1408 BGB, Ehezeit, internationales Privatrecht, Verfassungsmäßigkeit.
FAQ: Versorgungsausgleich in der notariellen Praxis
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf ein Werk zum Thema Versorgungsausgleich, speziell für die notarielle Praxis. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf den rechtlichen Grundlagen und praktischen Aspekten des Versorgungsausgleichs für Notaranwärter und juristische Fachkräfte.
Welche Kapitel umfasst das Werk?
Das Werk gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 behandelt den Grundgedanken und Zweck des Versorgungsausgleichs. Kapitel 2 bietet einen allgemeinen Überblick zum Versorgungsausgleich, inklusive Anwendungsbereich, Ehezeitprinzip, Güterstand, Verfahren, Übergangsrecht, verfassungsrechtliche Aspekte, deutsch-deutsche Fragen und internationales Privatrecht. Kapitel 3 differenziert zwischen Wertausgleich und schuldrechtlichem Ausgleich. Kapitel 4 befasst sich mit Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich mittels Ehevertrag und Scheidungsvereinbarung.
Welche Zielsetzung verfolgt das Werk?
Ziel des Werkes ist es, einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen und praktischen Aspekte des Versorgungsausgleichs zu geben. Es richtet sich an Notaranwärter und andere juristische Fachkräfte, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die rechtlichen Grundlagen des Versorgungsausgleichs, die Arten des Versorgungsausgleichs (Wertausgleich und schuldrechtlicher Ausgleich), Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich (Ehevertrag und Scheidungsvereinbarung), die praktische Anwendung in der notariellen Praxis und spezifische Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Die Kapitelzusammenfassungen bieten detaillierte Einblicke in den Inhalt jedes Kapitels. Kapitel 1 erläutert den Grundgedanken und Zweck des Versorgungsausgleichs. Kapitel 2 bietet eine umfassende Einführung in die rechtlichen Grundlagen. Kapitel 3 analysiert die Unterschiede zwischen Wertausgleich und schuldrechtlichem Ausgleich. Kapitel 4 behandelt die vertragliche Regelung des Versorgungsausgleichs durch Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Versorgungsausgleich, Ehevertrag, Scheidungsvereinbarung, Wertausgleich, schuldrechtlicher Ausgleich, notarielle Praxis, § 1587a BGB, § 1587f BGB, § 1408 BGB, Ehezeit, internationales Privatrecht und Verfassungsmäßigkeit.
Für wen ist dieses Werk gedacht?
Das Werk richtet sich vorrangig an Notaranwärter und andere juristische Fachkräfte, die sich professionell mit dem Thema Versorgungsausgleich auseinandersetzen möchten.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnte ein Link zum vollständigen Werk eingefügt werden)
- Citation du texte
- Andreas Kuhn (Auteur), 2003, Der Versorgungsausgleich in der notariellen Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22156