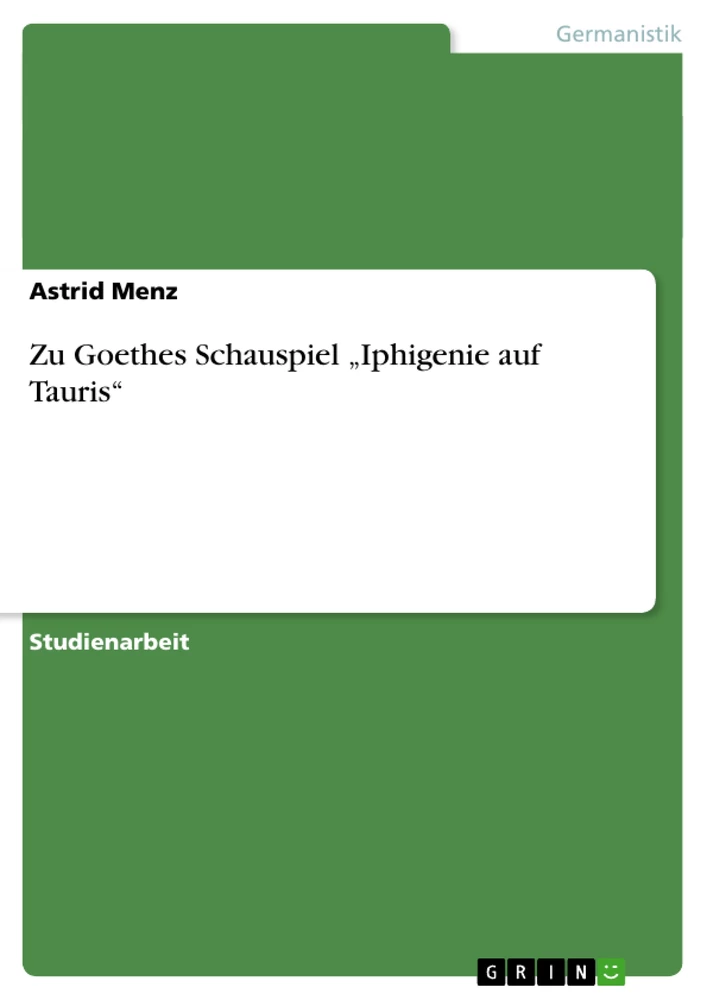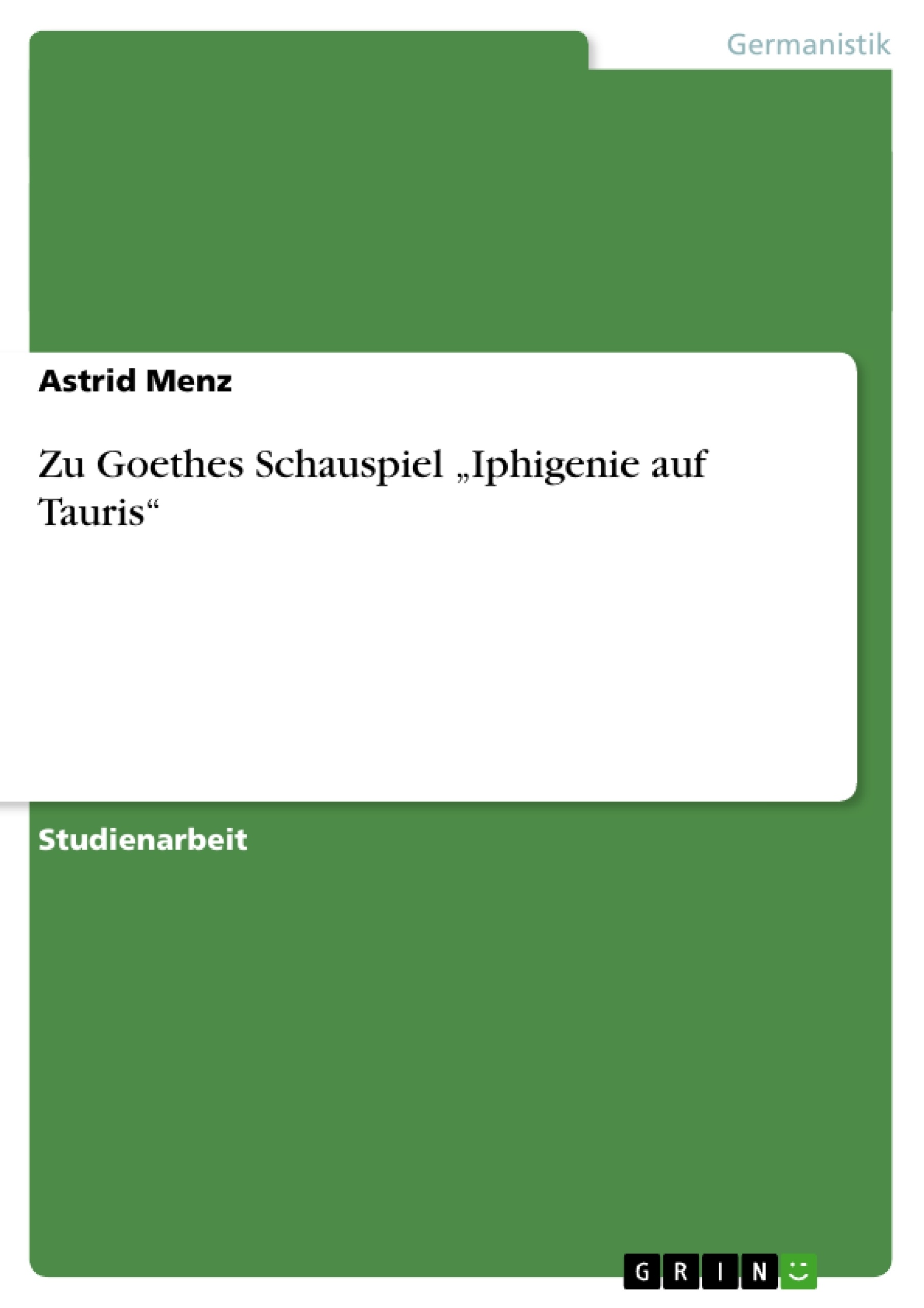Das von Johann Wolfgang von Goethe verfasste Schauspiel gilt bis heute als das Beispiel für ein Drama der geschlossenen Form und entspricht mehr als seine anderen Dramen der „classique doctrine.“1 Es ist ein klassisches Drama, das sich, entsprechend der Epoche, die Antike als Vorbild nimmt. Das betrifft die Komposition, d.h. Aufbau und Gestaltung, als auch die Thematik bzw. die Stoffauswahl.2
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit das Bühnenwerk die Anforderungen eines tektonischen Dramas erfüllt. Dazu werden zunächst die Merkmale dieses Dramentyps im Einzelnen aufgeführt. Im Anschluss daran werden diese Aspekte mit Beispielen aus dem Schauspiel belegt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den formalen Merkmalen und besonders auf dem Handlungsgang. Die Arbeit bedient sich vorwiegend der Darstellung aus dem Buch von Volker Klotz „Die geschlossene und offene Form des Dramas“. 3 Darin fasst er u.a die Charakteristika des klassizistischen Regeldramas Frankreichs des 17. Jahrhundert mit all seinen Konventionen, Ort, Zeit und Handlung betreffend, zusammen. Ferner erweitert er diese Aspekte durch die von Gustav Freytag 1863 beschriebenen Aktfunktionen und den pyramidialen Dramenaufbau.4
Die Arbeit beschränkt sich auf die Darstellung der geschlossenen Dramenform. Sie verzichtet auf eine Gegenüberstellung mit dem offenen Dramentyp. Als Hilfsmittel zur Analyse und Erschließung des Schauspiels dienen vorwiegend die Monographien von Walter Henze5 und die Interpretation von Achim Geisenhanslüke.6 Es wird versucht, formale Gestaltungsmerkmale und inhaltliche Themen miteinander zu verbinden, damit der Aspekt der Geschlossenheit vollends in dem Schauspiel aufgedeckt wird. Auch die Merkmale, bei denen das Drama von den Vorgaben abweicht, werden aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Merkmale des geschlossenen Dramas
- II. 1 Die Handlung und ihre Komposition
- II. 2 Raum und Zeit
- II. 3 Personen und Sprache
- III. Iphigenie auf Tauris als ein Drama der geschlossenen Form
- III. 1 Handlung und Komposition
- III. 2 Raum und Zeit als Rahmen
- III. 3 Personen und ihre Sprache
- IV. Zusammenfassung
- V. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes „Iphigenie auf Tauris“ auf seine Übereinstimmung mit den Merkmalen eines geschlossenen Dramas. Zunächst werden die charakteristischen Eigenschaften dieser Dramenform definiert, um sie anschließend anhand von Beispielen aus dem Schauspiel zu belegen. Der Fokus liegt dabei auf den formalen Aspekten, insbesondere dem Handlungsverlauf.
- Merkmale des geschlossenen Dramas nach klassischer Dramentheorie
- Analyse der Handlungsstruktur und -komposition in „Iphigenie auf Tauris“
- Untersuchung von Raum und Zeitgestaltung im Drama
- Charakterisierung der Figuren und ihrer sprachlichen Ausdrucksweise
- Verbindung von formalen Gestaltungsmerkmalen und inhaltlichen Themen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung von Goethes „Iphigenie auf Tauris“ als Drama der geschlossenen Form. Sie benennt die verwendete Literatur und den methodischen Ansatz, der sich auf die Charakteristika des klassischen Regeldramas und den pyramidialen Dramenaufbau stützt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der geschlossenen Dramenform ohne expliziten Vergleich mit offenen Dramenformen. Die Einleitung betont den Versuch, formale und inhaltliche Aspekte des Dramas miteinander zu verknüpfen, um die Geschlossenheit des Werks aufzuzeigen. Dabei werden auch Abweichungen von den klassischen Vorgaben berücksichtigt.
II. Merkmale der geschlossenen Form: Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale eines Dramas der geschlossenen Form, basierend auf Aristoteles' „Poetik“ und der Arbeit von Volker Klotz. Es betont die Einheit und Ganzheit der Handlung, die Unterordnung von Nebenhandlungen, die Bedeutung des Aktes als in sich geschlossene Einheit, und die fünfaktige Struktur mit den Freytagschen Aktfunktionen (Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt, fallende Handlung, Lösung/Katastrophe). Die lineare Handlung, die Dreipersonenregel, die „Liaison des scènes“ und die Bedeutung der Symmetrie in der Komposition werden erläutert. Die Methode der Entstofflichung von Gewalt und Brutalität durch Teichoskopie und Botenberichte wird ebenfalls diskutiert, sowie die Auswirkung dieser Techniken auf die Lebhaftigkeit der Handlung und die Verlagerung des Fokus auf die Personen und deren Reaktionen.
Schlüsselwörter
Goethe, Iphigenie auf Tauris, geschlossene Dramenform, klassisches Drama, Handlungskomposition, Raum und Zeit, Figurencharakterisierung, Sprache, Aristoteles, Freytag, Klotz, Symmetrie, Humanität.
Goethes "Iphigenie auf Tauris": Eine Analyse der geschlossenen Dramenform - FAQs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes "Iphigenie auf Tauris" im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den Merkmalen eines geschlossenen Dramas. Der Fokus liegt auf der formalen Struktur des Dramas, insbesondere der Handlungsführung, der Raum- und Zeitgestaltung sowie der Charakterisierung der Figuren und ihrer Sprache.
Welche Aspekte des geschlossenen Dramas werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die charakteristischen Eigenschaften der geschlossenen Dramenform, basierend auf der klassischen Dramentheorie (Aristoteles, Volker Klotz). Dies beinhaltet die Einheit und Ganzheit der Handlung, die fünfaktige Struktur mit den Freytagschen Aktfunktionen, die lineare Handlung, die Dreipersonenregel, die "Liaison des scènes" und die Bedeutung der Symmetrie in der Komposition. Die Entstofflichung von Gewalt durch Teichoskopie und Botenberichte sowie deren Einfluss auf die Handlung und die Figuren werden ebenfalls betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Merkmale des geschlossenen Dramas, ein Kapitel zur Analyse von "Iphigenie auf Tauris" unter dem Aspekt der geschlossenen Form, eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und den methodischen Ansatz. Das Kapitel über die Merkmale des geschlossenen Dramas legt die theoretischen Grundlagen dar. Das Hauptkapitel untersucht "Iphigenie auf Tauris" anhand der zuvor definierten Kriterien. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Goethe, Iphigenie auf Tauris, geschlossene Dramenform, klassisches Drama, Handlungskomposition, Raum und Zeit, Figurencharakterisierung, Sprache, Aristoteles, Freytag, Klotz, Symmetrie, Humanität.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Charakteristika des klassischen Regeldramas und den pyramidialen Dramenaufbau. Sie konzentriert sich auf die Analyse der geschlossenen Dramenform ohne expliziten Vergleich mit offenen Dramenformen. Ein wichtiger Aspekt ist der Versuch, formale und inhaltliche Aspekte des Dramas miteinander zu verknüpfen, um die Geschlossenheit des Werks aufzuzeigen. Dabei werden auch Abweichungen von den klassischen Vorgaben berücksichtigt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Aristoteles' "Poetik" und die Arbeiten von Volker Klotz. Ein detailliertes Literaturverzeichnis ist im Anhang enthalten.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise.
- Quote paper
- Astrid Menz (Author), 2002, Zu Goethes Schauspiel „Iphigenie auf Tauris“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22325