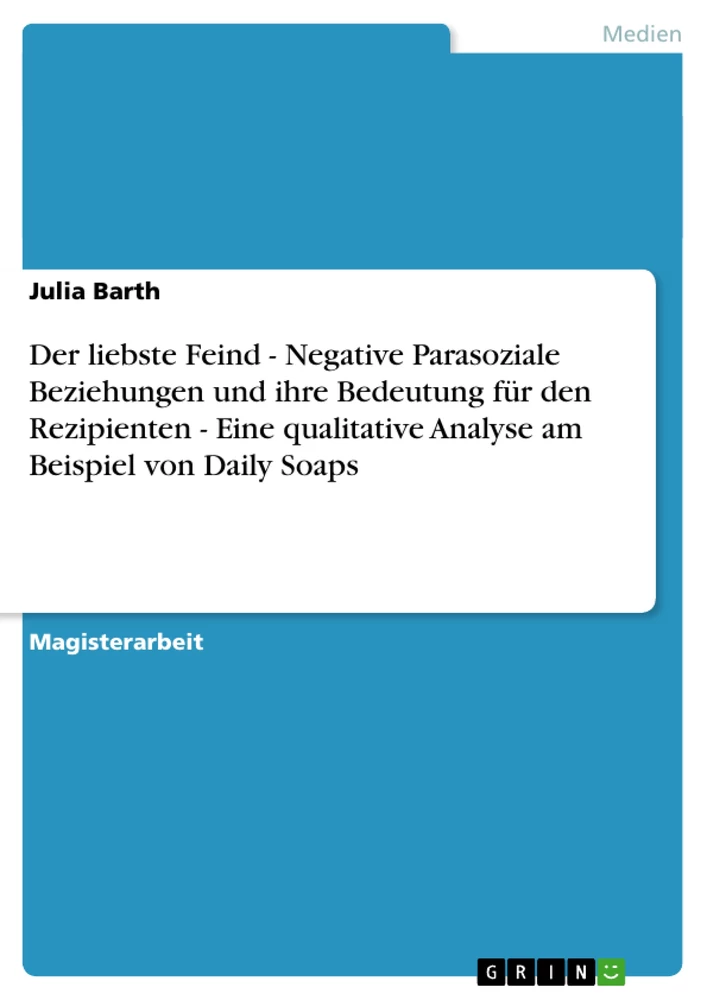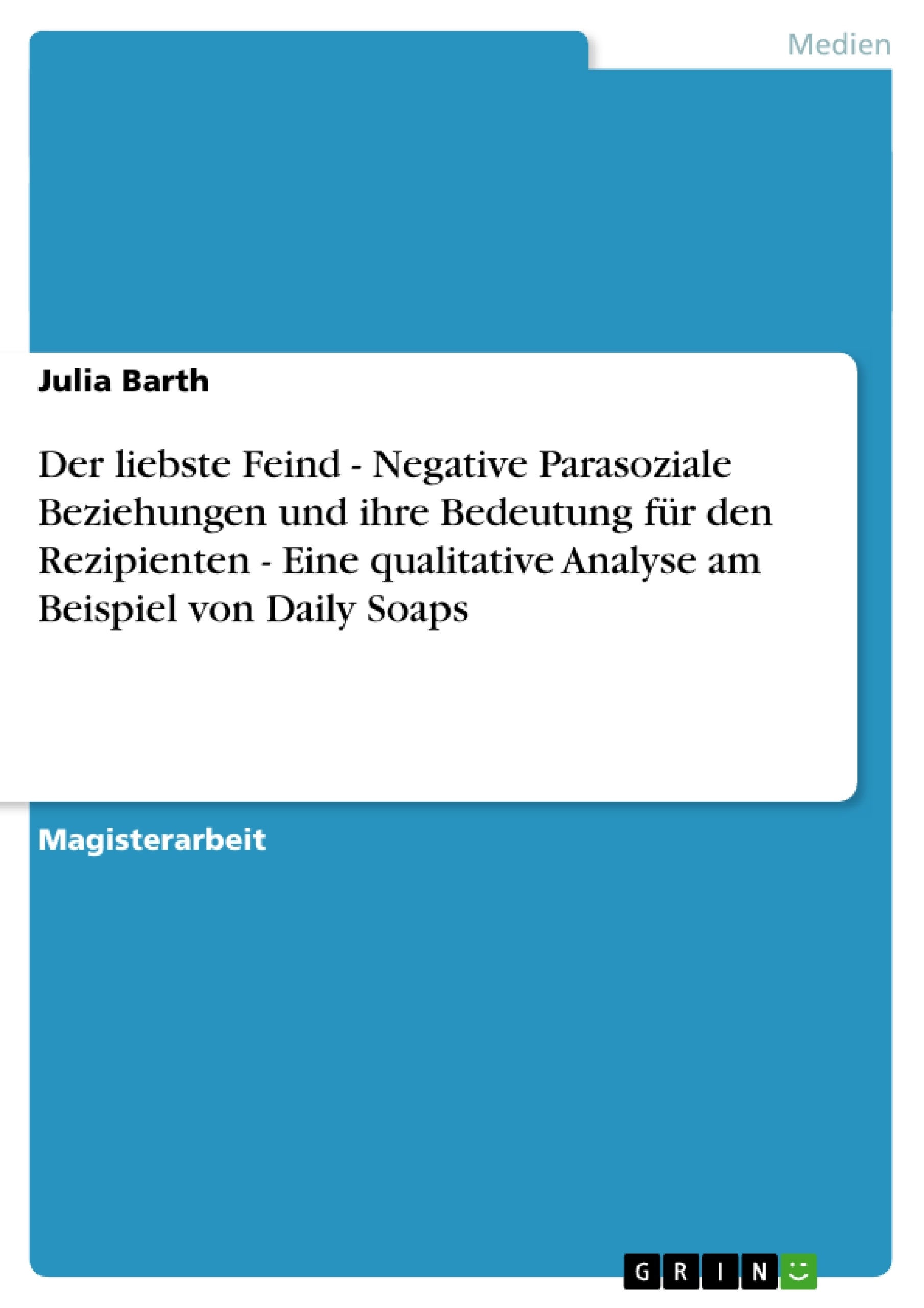[...] Da die vorliegende Arbeit ausschließlich parasoziale Beziehungen zu Charakteren von Daily Soap Operas erforscht, stehen auch in diesem Überblick Untersuchungen im Bereich fiktionaler serieller Unterhaltungsangebote im Mittelpunkt. Das Kapitel soll außerdem verdeutlichen, dass auch die empirische Auseinandersetzung mit negativen parasozialen Beziehungen bisher stark vernachlässigt wurde, woraus sich u. a. das Forschungsinteresse begründen lässt. Im darauffolgenden Kapitel wird auf die theoretischen Aspekte negativer parasozialer Beziehungen eingegangen. Die strukturelle Ähnlichkeit zu den Ausführungen zu parasozialen Beziehungen allgemein wurde bewusst gewählt, um die Parallelen der beiden Ausprägungen des Phänomens besonders zu verdeutlichen. Es sollen aber hier vor allem die besonderen Aspekte und die Relevanz abgelehnter Beziehungspartner herausgestellt werden. In Kapitel 3 wird erklärt, welche Faktoren dazu beitragen, dass sich gerade Jugendliche als Forschungssubjekte für die Untersuchung (negativer) parasozialer Beziehungen anbieten. Dazu werden zunächst Definitionen von Jugend gegeben. Es werden zusätzlich die Besonderheiten dieser Lebensphase herausgestellt und die daraus resultierende Rolle der Medien verdeutlicht. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über die Entstehung und die Ausdifferenzierung des Genres Serie sowie die Erlangung seiner Vormachtposition im medialen Unterhaltungsmarkt. Eine Beschreibung der aktuellen Daily Soaps im deutschen Fernsehen soll bei der Einordnung der Sendungen helfen, auf die sich die empirische Untersuchung bezieht. Des Weiteren soll in diesem Kapitel noch einmal verdeutlicht werden, inwiefern Serien und insbesondere Daily Soaps mehr als andere Medienformate zur Ausbildung von Beziehungen mit Medienakteuren beitragen und sich damit gut als Untersuchungsmaterial eignen. Der empirische Teil gibt einleitend mit Kapitel 5 einen detaillierteren Einblick in die Fragestellung und das Forschungsinteresse. Nach einer kurzen Beschreibung zur Anwendung der Methode folgen Ausführungen über die Umstände und Rahmenbedingungen der Durchführung der qualitativen Befragung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zum Gegenstandsbereich parasozialer Beziehungen
- 2.1 Grundlagen
- 2.1.1 Das Konzept von Horton und Wohl
- 2.1.2 Darstellung parasozialer Beziehungen
- 2.1.2.1 Vergleiche zu orthosozialen Beziehungen
- 2.1.2.2 Parasoziale Beziehungen aus Rezipienten- und Produzentensicht
- 2.1.2.3 Motive für die Herausbildung parasozialer Beziehungen
- 2.1.3 Parasoziale Beziehungen und Daily Soaps
- 2.2 Die Erforschung parasozialer Beziehungen
- 2.2.1 Ausgewählte Studien
- 2.2.2 Die Messung parasozialer Beziehungen
- 2.3 Negative parasoziale Beziehungen
- 2.3.1 Darstellung negativer parasozialer Beziehungen
- 2.3.1.1 Vergleiche zu negativen orthosozialen Beziehungen
- 2.3.1.2 Negative parasoziale Beziehungen aus Rezipienten- und Produzentensicht
- 2.3.1.3 Motive für die Herausbildung negativer parasozialer Beziehungen
- 2.3.2 Negative parasoziale Beziehungen und Daily Soaps
- 3 Die jugendlichen Rezipienten
- 3.1 Definitionen von Jugend
- 3.2 Besonderheiten der Jugendphase
- 3.3 Die Rolle der Medien
- 3.3.1 Orientierungsfunktion der Medien
- 3.3.2 Mediennutzung
- 4 Zur Relevanz von Serienformaten
- 4.1 Das Genre der Serie und der Soap Opera
- 4.2 Soap Operas im deutschen Fernsehen
- 4.3 Die Geschichte der Soap Opera
- 4.4 Begründung für Soap Operas als Forschungsobjekt
- 4.5 Serienrezeption
- 4.5.1 Identifikation, Projektion und Übertragungserleben
- 4.5.2 Eskapismus und Alltagsflucht
- 5 Grundlagen für die empirische Analyse
- 5.1 Theoretische Anbindung
- 5.2 Fragestellung
- 6 Methodisches Vorgehen
- 6.1 Die Methode
- 6.1.1 Die Wahl der Methode
- 6.1.2 Die Grounded Theory
- 6.2 Die Befragung
- 6.2.1 Die Interviewpartner
- 6.2.2 Die Leitfäden
- 6.2.3 Durchführung und Transkription
- 7 Die Auswertung
- 7.1 Die Kategorien
- 7.2 Die Ergebnisse
- 7.2.1 Generelle Beurteilung der Soap Operas
- 7.2.2 Gründe für die Serienrezeption
- 7.2.3 Die negativen parasozialen Beziehungspartner
- 7.2.3.1 Die Typen und ihre Eigenschaften
- 7.2.3.2 Die Reaktionen auf die Bildschirmpräsenz
- 7.2.3.3 Die Notwendigkeit der negativen parasozialen Beziehungspartner
- 7.2.4 Parallelen zum eigenen Umfeld
- 7.2.5 Parallelen zur eigenen Person
- 7.2.6 Thema im Freundeskreis
- 7.2.7 Vergleichende Analsye
- 7.3 Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse
- 7.3.1 Zentrale Aspekte
- 7.3.2 Theoretischer Bezug
- 8 Schlussbemerkung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen negativer parasozialer Beziehungen, die sich in der Rezeption von Daily Soaps manifestieren. Die Arbeit untersucht, wie Jugendliche diese Beziehungen erleben und welche Bedeutung sie für die Rezipienten haben.
- Parasoziale Beziehungen in der Medienrezeption
- Negative parasoziale Beziehungen und ihre Entstehung
- Die Rolle von Daily Soaps in der Medienlandschaft
- Die Rezeption von Daily Soaps durch Jugendliche
- Die Bedeutung negativer parasozialer Beziehungen für die Rezipienten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik parasozialer Beziehungen und deren Bedeutung im Kontext der Medienrezeption. Es werden die grundlegenden Konzepte erläutert und die bisherigen Forschungsansätze beleuchtet.
Im Anschluss daran werden negative parasoziale Beziehungen im Detail betrachtet. Hierbei werden die Unterschiede zu negativen orthosozialen Beziehungen aufgezeigt und die Motive für die Herausbildung negativer parasozialer Beziehungen analysiert.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der jugendlichen Rezipienten von Daily Soaps. Es werden die Besonderheiten der Jugendphase und die Rolle der Medien für Jugendliche beleuchtet.
Die Arbeit widmet sich anschließend dem Genre der Soap Opera und untersucht die Geschichte und die Bedeutung dieser Serienformate im deutschen Fernsehen.
Im methodischen Teil wird die Grounded Theory als Forschungsmethode vorgestellt und die Durchführung der Befragung detailliert beschrieben. Die Ergebnisse der Analyse werden anhand von Kategorien präsentiert und interpretiert.
Schlüsselwörter
Parasoziale Beziehungen, negative parasoziale Beziehungen, Daily Soaps, Serienrezeption, Jugendliche, Mediennutzung, Grounded Theory, qualitative Analyse.
- Citation du texte
- Julia Barth (Auteur), 2003, Der liebste Feind - Negative Parasoziale Beziehungen und ihre Bedeutung für den Rezipienten - Eine qualitative Analyse am Beispiel von Daily Soaps, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22347