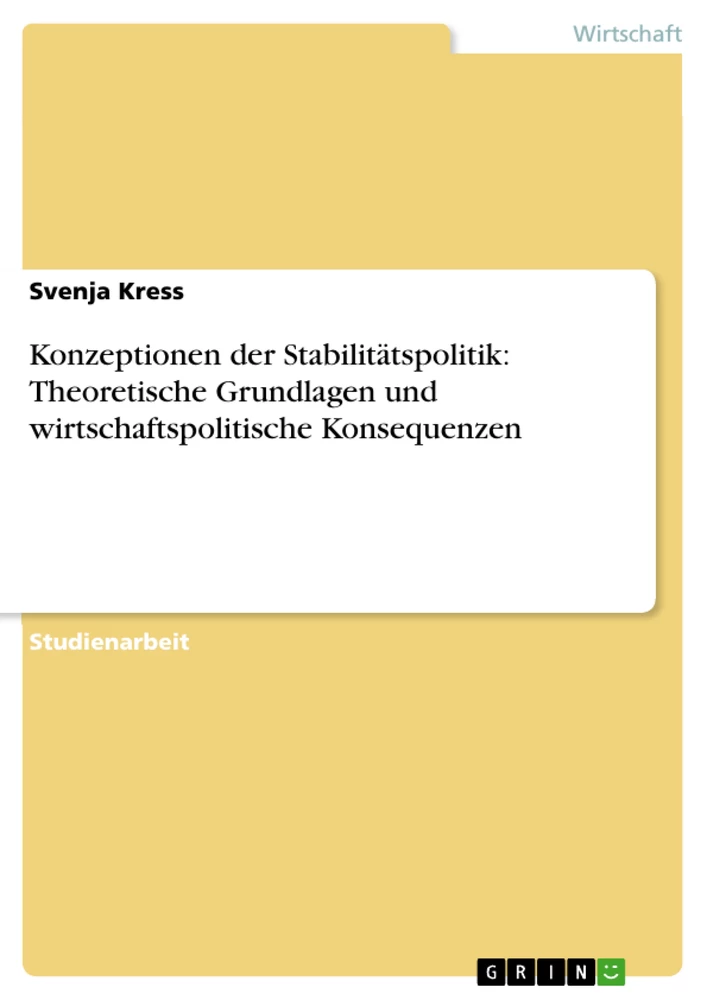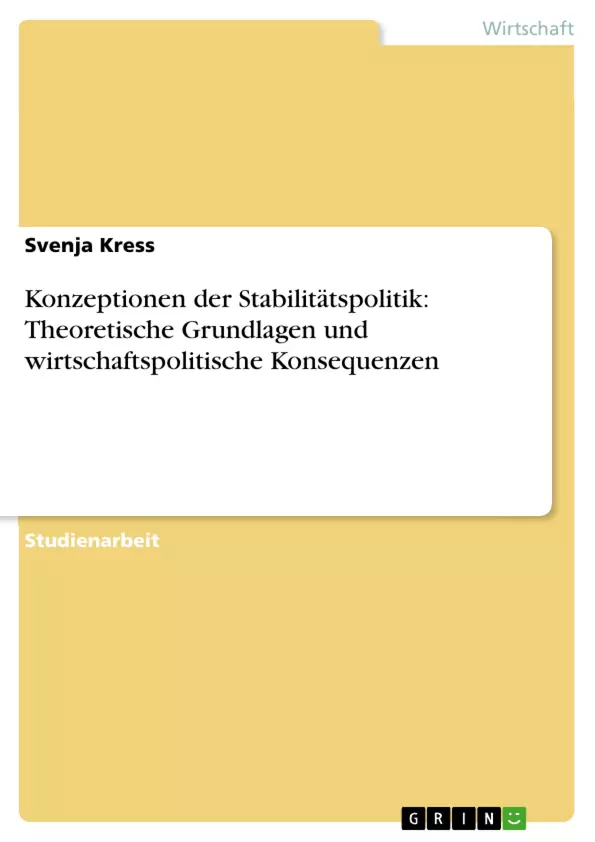Schon in der Antike beschäftigten sich Philosophen im Rahmen anderer Disziplinen, also nicht als eigenständige wissenschaftliche Sparte, mit Fragen der Wirtschaft. Hier ging es zunächst um Fragen der Wirtschafts- und Verwaltungspraxis und später bis zum 16. und 17. Jahrhundert, der Zeit des Merkantilismus, entwickelten sich Theorien um die nationale Handelskraft und die Einnahmen der öffentlichen Hand. Deren analytischer Gehalt war bis PETTY (1623-1687), dem Begründer des Konzeptes des volkswirtschaftlichen "Überschusses", jedoch noch dürftig. Die erste Analyse der Wirtschaftsprozesse, verstanden als Kreislauf zwischen drei sozialen Gruppen, folgte dann Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Physiokraten unter der Leitung von QUESNAY (1694-1774), dem Leibarzt Ludwig des XV.1
Um das Jahr 1770 ist der Beginn der Klassik anzusiedeln, in etwa mit der Veröffentlichung des Hauptwerkes von TURGOT (1727-1781) und der alle bisherigen Erkenntnisse zusammenfassenden Theorie von SMITH (1723-1790). Da man sich in einer Vollbeschäftigung befand und der Geldwert nach dem Goldstandard festgelegt war, bestand hier noch kein Bedarf für Stabilisierung. Die Klassik lehrt die Existenz einer natürlichen Ordnung und Koordination, ein "Harmonieprinzip", innerhalb der Wirtschaft und die ausdrückliche Forderung an die öffentliche Hand, nicht in den Prozeß einzugreifen. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Erklärung des Bruttosozialproduktes in der heute noch bestehenden Dreiteilung Entstehung, Verteilung und Verwendung. Weitere berühmte Vertreter dieser Epoche sind SAY (1767-1832), RICARDO (1722-1823) und MILL (1806-1873), der die klassische Theorie abschließend dargestellt hat. MARX (1818-1883) verfeinerte die Analyse der Wertschöpfung im Zuge seiner eher verteilungspolitisch motivierten Lehre, legte den Grundstein zur Erklärung von Vermögensänderungen und ergänzte die Kreislaufdarstellung um wesentliche heute noch vertretene Elemente. Auf ihn geht ebenfalls der Vorschlag der Bezeichnung der ökonomischen Erkenntnisse seiner Zeitgenossen und Vorgänger seit 1770 als eine "klassische Periode" zurück.2
Inhaltsverzeichnis
- 1 Entwicklung der Wirtschaftspolitik
- 1.1 Vorläufer
- 1.2 Die klassische Periode
- 1.3 Neo-Klassik
- 1.4 Keynes
- 1.5 Monetarismus
- 2 Zielsetzung und Instrumentarium der Stabilitätspolitik
- 2.1 Begriff
- 2.2 Konjunkturelle Fehlentwicklungen
- 2.3 Aufgaben und Ziele der Stabilitätspolitik
- 3 Alternative Ansätze zur Stabilisierung von Konjunkturschwankungen
- 3.1 Das keynesianische Konzept: Diskretionäre, antizyklische Geld- und Fiskalpolitik
- 3.1.1 Theoretische Konzeption
- 3.1.2 Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik
- 3.2 Das neo-klassisch-monetaristische Konzept: Regelgebundene Geld- und Fiskalpolitik
- 3.2.1 Theoretische Konzeption
- 3.2.2 Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik
- 3.3 Andere Regelpolitiken
- 3.3.1 Nominelle BSP-Stabilisierung
- 3.3.2 Outputstabilisierung
- 3.3.3 Preisniveaustabilisierung
- 3.3.4 Zinsniveaustabilisierung
- 3.3.5 Wechselkursstabilisierung
- 3.3.6 Inflation Targeting
- 4 Zeitgeschehen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Konzeptionen und deren Konsequenzen für die Stabilitätspolitik. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze zur Stabilisierung von Konjunkturschwankungen, sowohl keynesianische als auch neo-klassisch-monetaristische Perspektiven. Die Arbeit analysiert die jeweiligen theoretischen Grundlagen und deren praktische Implikationen für die Wirtschaftspolitik.
- Entwicklung der wirtschaftspolitischen Theorien von der Antike bis zum Monetarismus
- Keynesianische und neo-klassisch-monetaristische Konzepte der Stabilitätspolitik
- Alternative Regelpolitiken zur Konjunkturstabilisierung
- Das Instrumentarium der Stabilitätspolitik
- Bedeutung des Say'schen Theorems
Zusammenfassung der Kapitel
1 Entwicklung der Wirtschaftspolitik: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung wirtschaftspolitischer Theorien. Beginnend mit den Vorläufern in der Antike und dem Merkantilismus, werden die klassische Periode, die Neoklassik, der Keynesianismus und der Monetarismus erörtert. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung des Denkens über staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und die sich verändernden Perspektiven auf Konjunkturzyklen und Vollbeschäftigung. Die unterschiedlichen Schulen werden im Kontext ihres jeweiligen historischen und ökonomischen Hintergrunds analysiert, mit Betonung auf ihren Kernannahmen und Auswirkungen auf die damalige Wirtschaftspolitik. Die Entwicklung von der Fokussierung auf das reine Marktgeschehen hin zu staatlichen Eingriffsmöglichkeiten wird nachvollziehbar dargestellt. Das Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der unterschiedlichen Ansätze der Stabilitätspolitik in den folgenden Kapiteln.
2 Zielsetzung und Instrumentarium der Stabilitätspolitik: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Stabilitätspolitik und untersucht deren Ziele und Instrumente. Es beleuchtet verschiedene Auffassungen des Begriffs und unterscheidet zwischen verschiedenen Zielen und Maßnahmen. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der verschiedenen Aufgaben und Ziele, die die Stabilitätspolitik verfolgen soll, und der dazu notwendigen Instrumente. Der Zusammenhang zwischen Konjunkturschwankungen und den Zielen der Stabilitätspolitik wird ausführlich erläutert, wobei der historische Wandel des Verständnisses dieser Thematik im Kontext der vorhergehenden Kapitel dargestellt wird.
3 Alternative Ansätze zur Stabilisierung von Konjunkturschwankungen: Dieses Kapitel vergleicht verschiedene Ansätze zur Stabilisierung von Konjunkturschwankungen. Im Detail werden das keynesianische Konzept der diskretionären, antizyklischen Geld- und Fiskalpolitik und das neo-klassisch-monetaristische Konzept der regelgebundenen Geld- und Fiskalpolitik gegenübergestellt. Zusätzlich werden verschiedene alternative Regelpolitiken diskutiert, wie etwa die Nominelle BSP-Stabilisierung, Outputstabilisierung, Preisniveaustabilisierung, Zinsniveaustabilisierung, Wechselkursstabilisierung und Inflation Targeting. Die Kapitel analysieren die theoretischen Grundlagen und die praktischen Konsequenzen jedes Ansatzes für die Wirtschaftspolitik. Die jeweiligen Stärken und Schwächen der Ansätze werden miteinander verglichen und kritisch bewertet. Der Bezug zu den vorherigen Kapiteln wird hergestellt, indem die Entwicklung der jeweiligen Ansätze in den historischen Kontext eingeordnet wird.
Schlüsselwörter
Stabilitätspolitik, Konjunkturpolitik, Keynesianismus, Monetarismus, Regelpolitik, Diskretionäre Politik, Geldpolitik, Fiskalpolitik, Vollbeschäftigung, Preisniveau, Wirtschaftswachstum, Say'sches Theorem, Konjunkturschwankungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung und Ansätze der Stabilitätspolitik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung wirtschaftspolitischer Konzeptionen und deren Auswirkungen auf die Stabilitätspolitik. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze zur Stabilisierung von Konjunkturschwankungen, sowohl keynesianische als auch neoklassisch-monetaristische Perspektiven, analysiert deren theoretische Grundlagen und deren praktische Implikationen für die Wirtschaftspolitik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Entwicklung wirtschaftspolitischer Theorien von der Antike bis zum Monetarismus, keynesianische und neoklassisch-monetaristische Konzepte der Stabilitätspolitik, alternative Regelpolitiken zur Konjunkturstabilisierung, das Instrumentarium der Stabilitätspolitik und die Bedeutung des Say'schen Theorems.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel 1 bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung wirtschaftspolitischer Theorien. Kapitel 2 definiert den Begriff der Stabilitätspolitik und untersucht deren Ziele und Instrumente. Kapitel 3 vergleicht verschiedene Ansätze zur Stabilisierung von Konjunkturschwankungen (Keynesianismus, Neoklassischer Monetarismus und alternative Regelpolitiken). Kapitel 4 beinhaltet ein Fazit und Ausblick auf aktuelle Entwicklungen.
Welche konkreten Ansätze zur Konjunkturstabilisierung werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das keynesianische Konzept der diskretionären, antizyklischen Geld- und Fiskalpolitik mit dem neoklassisch-monetaristischen Konzept der regelgebundenen Geld- und Fiskalpolitik. Zusätzlich werden alternative Regelpolitiken wie nominelle BSP-Stabilisierung, Outputstabilisierung, Preisniveaustabilisierung, Zinsniveaustabilisierung, Wechselkursstabilisierung und Inflation Targeting diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Stabilitätspolitik, Konjunkturpolitik, Keynesianismus, Monetarismus, Regelpolitik, Diskretionäre Politik, Geldpolitik, Fiskalpolitik, Vollbeschäftigung, Preisniveau, Wirtschaftswachstum, Say'sches Theorem und Konjunkturschwankungen.
Welche historischen Entwicklungen werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung wirtschaftspolitischer Theorien von frühen Vorläufern über die klassische Periode und die Neoklassik bis hin zum Keynesianismus und Monetarismus. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Denkens über staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und die sich verändernden Perspektiven auf Konjunkturzyklen und Vollbeschäftigung.
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen keynesianischen und neoklassisch-monetaristischen Ansätzen?
Der zentrale Unterschied liegt im Ansatz zur Konjunkturstabilisierung: Keynesianische Ansätze favorisieren diskretionäre, antizyklische Maßnahmen (Geld- und Fiskalpolitik), während neoklassisch-monetaristische Ansätze regelgebundene Politiken bevorzugen, um die Stabilität des Wirtschaftsgeschehens zu gewährleisten. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen und die praktischen Implikationen beider Ansätze.
Welche Rolle spielt das Say'sche Theorem in der Arbeit?
Das Say'sche Theorem wird im Kontext der Entwicklung wirtschaftspolitischer Theorien und der unterschiedlichen Ansätze zur Konjunkturstabilisierung diskutiert. Seine Bedeutung für das Verständnis des Marktgeschehens und der Rolle staatlicher Eingriffe wird analysiert.
- Citation du texte
- Svenja Kress (Auteur), 2000, Konzeptionen der Stabilitätspolitik: Theoretische Grundlagen und wirtschaftspolitische Konsequenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2239