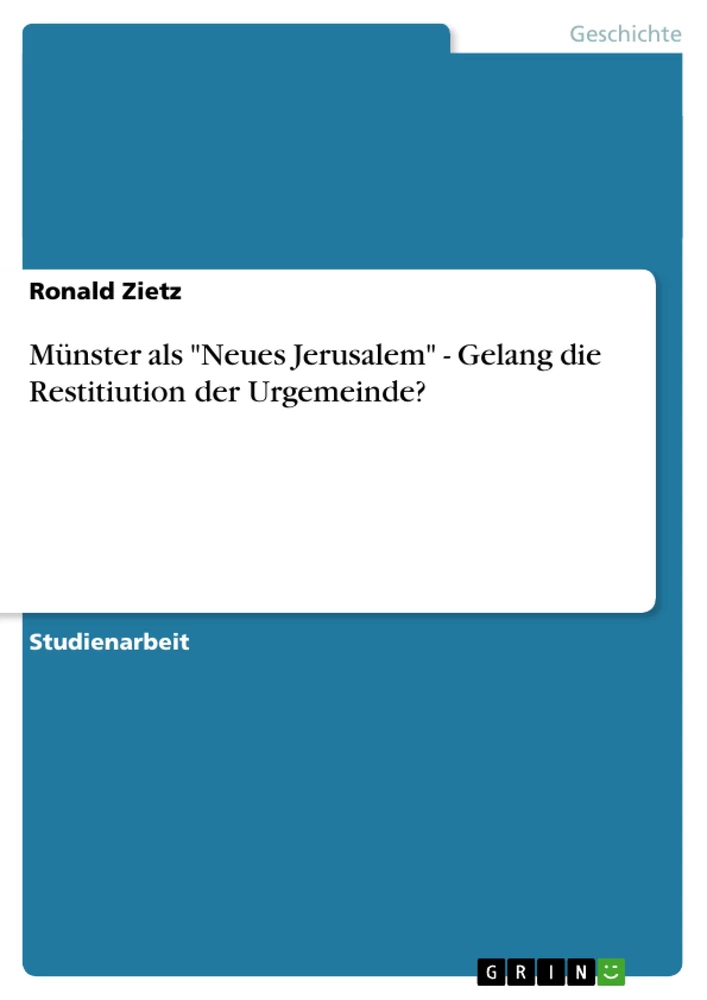Die Täuferbewegung war sicher eine der radikalsten aber auch faszinierendsten „Splittergruppen“ der Reformation. Sie hatte Hochs und Tiefs wie kaum eine andere „Neue Kirche“, als Beispiel hierfür die Entstehung des Täuferreiches zu Münster und sein tragischer Untergangs. Das Täufertum verbreitete sich sprunghaft, wurde ebenso energisch verfolgt, missachtet und vielmals auch missverstanden. Wie in vielen „neuen Kirchen“ jener Zeit gab es auch innerhalb der Taufgesinnten große Unterschiede. So gab es neben den, als „radikale Sekte“ eingestuften Vertretern, auch solche die auch das Münsteraner Reich errichteten, noch einen pazifistischen Teil welcher das Neue Jerusalem in Münster überlebte. Während es vor allem in den Niederlanden und Mähren, weitere als radikal einzustufende Taufgesinnte gab, konnten Ihre Forderungen wenn überhaupt nur in Münster umgesetzt werden, wo die Täufer durch geschickte eigene Politik und den politischen Machtkämpfen zwischen Bischof, Rat und Gilde innerhalb der Stadt letztlich immensen Einfluss gewannen und spätestens seit Februar 1534 praktisch freie Hand bei all ihren Schritten hatten. Auf eine detaillierte Darstellung wie es zur Täuferherrschaft kam muss an dieser Stelle jedoch verzichtet werden. In meiner Hausarbeit möchte ich mich mit den Lehren des Täufertums, speziell mit denen der Münsteraner Täufer um Rothmann, Mathys und Jan van Leiden beschäftigen und die Umsetzung ihrer Lehren am Täuferreich zu Münster 1534/35 aufzeigen. Welche Forderungen zur Wiederherstellung einer christlichen Ur- und Endzeitgemeinde wurden in Münster umgesetzt, und aus welcher Motivation heraus ist dies Geschehen und wie wurden z.B. auch strittige Reformen wie die Polygenie gerechtfertigt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Welt in den Augen der Täufer – warum eine Erneuerung nötig war
- Wie eine gottgerechte Welt entstehen sollte
- Münster als Neues Jerusalem - die Umsetzung der Forderungen
- Antiklerikalismus
- Gottesdienst/Messe
- Abendmahl
- Taufe
- Ehe und Polygamie
- Gütergemeinschaft
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lehren der Münsteraner Täufer um Rothmann, Mathys und Jan van Leiden und deren Umsetzung im Täuferreich von 1534/35. Im Fokus steht die Frage, welche Forderungen zur Wiederherstellung einer christlichen Ur- und Endzeitgemeinde in Münster umgesetzt wurden, welche Motivationen dahinter lagen und wie beispielsweise kontroverse Reformen wie die Polygamie gerechtfertigt wurden.
- Die Weltanschauung der Täufer und die Notwendigkeit einer Erneuerung
- Die Umsetzung der Forderungen der Täufer im Münsteraner Reich
- Die Rechtfertigung umstrittener Reformen wie der Polygamie
- Die Rolle der politischen Machtkämpfe in Münster
- Die Endzeit-Erwartung der Täufer und ihr Missionsbefehl
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Täuferbewegung ein, hebt deren Radikalität und Faszination hervor und beschreibt den tragischen Aufstieg und Fall des Täuferreichs in Münster. Sie umreißt die Vielfalt innerhalb der Taufgesinnten, von radikalen Sekten bis zu pazifistischen Gruppen, und kündigt das Thema der Arbeit an: die Untersuchung der Lehren der Münsteraner Täufer und deren Umsetzung in Münster. Die Einleitung stellt klar, dass der Fokus auf den Lehren und deren praktischer Umsetzung im Täuferreich liegt und nicht auf den politischen Aspekten der Machtergreifung.
Die Welt in den Augen der Täufer – warum eine Erneuerung nötig war: Dieses Kapitel beleuchtet die Sichtweise der Täufer auf die damalige Welt. Sie sahen sich als Auserwählte der letzten Tage und verurteilten andere Glaubensrichtungen als gottlos. Ihre Verfolgung beruhte auf der Angst vor radikalen Reformen und dem Aufstand unter Berufung auf Gottes Wort, wie beim Bauernkrieg. Als radikale Biblizisten folgten sie dem „sola scriptura“-Prinzip und verurteilten die bestehende Kirche als vom Glauben abgefallen. Die Vorstellung vom „Greuel der Verwüstung“ und die Erwartung der Parusie, verbunden mit einem Missionsbefehl, prägten ihre Weltanschauung und ihre Aktionen. Melchior Hoffmanns Idee einer irdischen Herrschaft der Heiligen bis zur Wiederkehr Christi lieferte eine wichtige ideologische Grundlage für das Münsteraner Täuferreich.
Wie eine gottgerechte Welt entstehen sollte: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele der Täufer, eine gottgerechte Welt nach dem Vorbild des Neuen Testaments zu schaffen. Es sollte eine Gemeinde wahrer Christen entstehen, im Gegensatz zur bestehenden Massenkirche, die Gute und Böse umfasste. Die Übernahme der Macht in Münster ermöglichte es den Täufern, ihre Vorstellungen einer theokratischen Gemeinde, einer Ur- und Endzeitgemeinde, zu verwirklichen. Die konkreten Maßnahmen zur Errichtung dieser "gottgerechten" Welt werden in den folgenden Unterkapiteln detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Täufer, Münster, Täuferreich, Rothmann, Mathys, Jan van Leiden, Urgemeinde, Endzeit, Polygamie, Reformation, Radikalreformatoren, Sola scriptura, Antiklerikalismus, Theokratie, Parusie, Missionsbefehl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Münsteraner Täuferreich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Lehren der Münsteraner Täufer um Rothmann, Mathys und Jan van Leiden und deren Umsetzung im Täuferreich von 1534/35. Der Fokus liegt auf den Forderungen zur Wiederherstellung einer christlichen Ur- und Endzeitgemeinde, den dahinterliegenden Motivationen und der Rechtfertigung kontroverser Reformen wie der Polygamie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Weltanschauung der Täufer und die Notwendigkeit einer Erneuerung aus ihrer Sicht, die Umsetzung ihrer Forderungen im Münsteraner Reich, die Rechtfertigung umstrittener Reformen (z.B. Polygamie), die Rolle der politischen Machtkämpfe in Münster und die Endzeit-Erwartung der Täufer sowie ihren Missionsbefehl.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, die die Täuferbewegung und das Münsteraner Täuferreich einführt. Kapitel zwei beleuchtet die Weltanschauung der Täufer und die Gründe für ihre Reformbestrebungen. Kapitel drei beschreibt die Ziele der Täufer, eine gottgerechte Welt zu schaffen. Ein Kapitel befasst sich detailliert mit der Umsetzung der Forderungen im Münsteraner Reich (Antiklerikalismus, Gottesdienst, Abendmahl, Taufe, Ehe/Polygamie, Gütergemeinschaft). Die Arbeit endet mit einem Schluss.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Täufer, Münster, Täuferreich, Rothmann, Mathys, Jan van Leiden, Urgemeinde, Endzeit, Polygamie, Reformation, Radikalreformatoren, Sola scriptura, Antiklerikalismus, Theokratie, Parusie und Missionsbefehl.
Wie wird die Polygamie in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie die kontroverse Reform der Polygamie von den Münsteraner Täufern gerechtfertigt wurde und welchen Stellenwert sie im Kontext ihrer Weltanschauung und Gesellschaftsordnung hatte.
Welche Rolle spielte die Politik im Münsteraner Täuferreich?
Die Arbeit thematisiert die Rolle der politischen Machtkämpfe in Münster und ihren Einfluss auf die Umsetzung der Täuferlehren und -forderungen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Frage ist, welche Forderungen der Münsteraner Täufer zur Wiederherstellung einer christlichen Ur- und Endzeitgemeinde umgesetzt wurden, welche Motivationen dahinter lagen und wie kontroverse Reformen gerechtfertigt wurden.
Wie wird die Endzeit-Erwartung der Täufer dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Endzeit-Erwartung der Täufer und ihren Missionsbefehl als zentrale Triebfedern ihres Handelns und ihrer Reformbestrebungen.
Wie wird die Vielfältigkeit innerhalb der Täuferbewegung berücksichtigt?
Die Einleitung hebt die Vielfältigkeit innerhalb der Taufgesinnten hervor, von radikalen Sekten bis zu pazifistischen Gruppen, und betont, dass der Fokus der Arbeit auf den radikalen Münsteraner Täufern liegt.
Welche Quellen werden in der Arbeit vermutlich verwendet?
(Diese Frage kann nicht direkt aus dem gegebenen HTML beantwortet werden, da keine explizite Quellenangabe enthalten ist.)
- Citation du texte
- Ronald Zietz (Auteur), 2003, Münster als "Neues Jerusalem" - Gelang die Restitiution der Urgemeinde?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22492