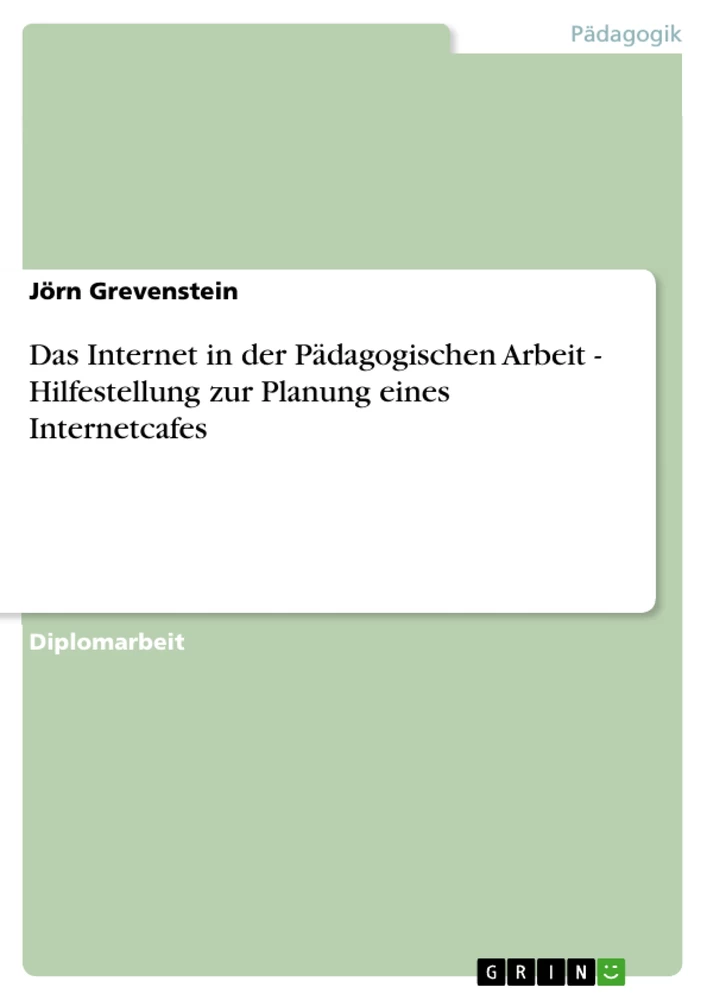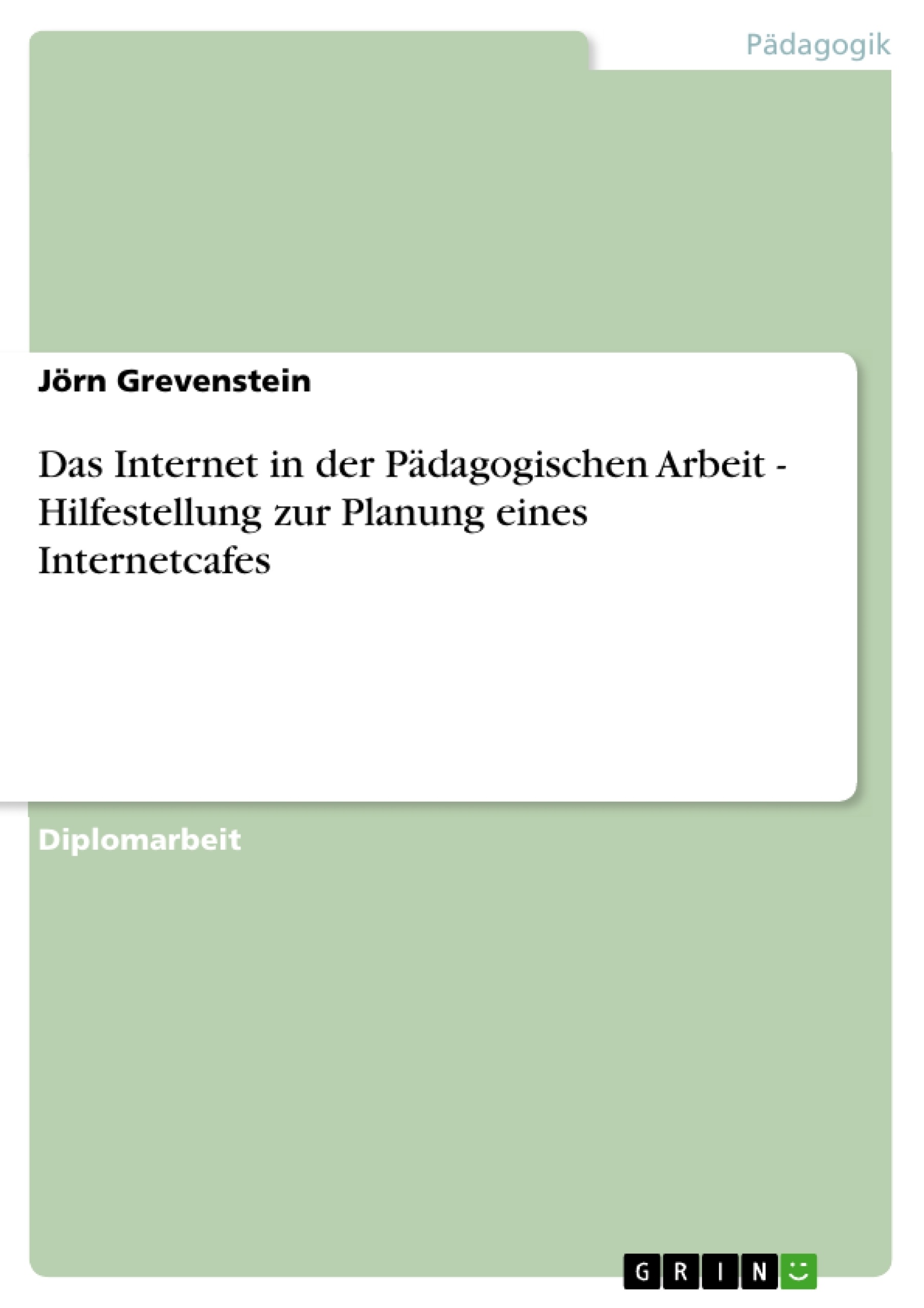EINLEITUNG
„Erkennen heißt nicht zerlegen und
auch nicht erklären.
Es heißt Zugang zur Schau finden.
Aber um zu schauen, muß man teilnehmen.
Das ist eine harte Lehre.“
(A. de Saint-Exupéry, Flug nach Arras)(1)
Übertragen auf das Thema dieser Diplomarbeit, deutet das Zitat darauf hin, daß ohne praktisch erworbene Erfahrung, und ohne eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Medium Internet, eine ausgewogene Beurteilung nicht möglich ist.
Viele Menschen haben ihr Bild und ihre Vorstellungen vom Internet aber nicht durch direkte Beschäftigung mit dem Medium erworben. Sie beziehen sich bei ihrer Meinungsbildung auf Informationen, die sie aus ihrem sozialen Umfeld und vermittelt durch andere Medien, erhalten haben. Das erklärt auch die weitverbreiteten Vorstellungen von einem fremden und geheimnisvollen, fast schon mystischen Medium, welche oft Berührungsängste hervorrufen.
Diese Entwicklungen sind jedoch nicht außergewöhnlich. Die Einführung des Radios bspw., hat ebenfalls Ängste und Hoffnungen in übertriebenem Maße geweckt. Erst wenn das Internet zu einem allgemeinen „Gebrauchsgegenstand“ geworden ist, und alle sozialen Schichten erreicht hat, wird es nicht mehr diese exponierte Stellung unter den Medien einnehmen. Diesen Prozeß voranzutreiben
und im Fluß zu halten, ist auch Aufgabe von (Medien-)Pädagogen. Doch finden sich auch hier die gleichen Vorstellungen und Ängste wieder.
Den teilweise irrationalen Ängsten und übertriebenen Hoffnungen eine
nüchterne Betrachtungsweise entgegenzustellen, ist ein Ziel dieser Diplomarbeit.
Das zweite Ziel ist, dem Leser, neben der Einführung in das Thema, konkrete Hilfestellungen und Empfehlungen für die Konzeptionierung eines pädagogisch orientierten Internetangebotes zur Verfügung zu stellen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- DAS INTERNET - WAS VERBIRGT SICH HINTER DIESEM SCHLAGWORT?
- DIE GESCHICHTE DES INTERNET.
- AUFBAU UND STRUKTUR DES INTERNET.
- DIENSTE DES INTERNETS.
- E-Mail.
- File Transfer Protocol (FTP).
- Telnet.
- News.
- Internet Relay Chat (IRC).
- Multi User Dungeon (MUD).
- World Wide Web (WWW)
- VERWALTUNG IM INTERNET
- KOMMUNIKATION VIA INTERNET UND DIE FOLGEN
- PSYCHOLOGISCHE THEORIEN ZU COMPUTERVERMITTELTER KOMMUNIKATION (COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION (CMC)).
- Kanalreduktionsmodell.
- Herausfiltern sozialer Hinweisreize.
- Rationale Medienwahl.
- Normative Medienwahl.
- Soziale Informationsverarbeitung.
- Simulation.
- Imagination.
- ZUSAMMENFASSUNG.
- SELBSTDARSTELLUNG, IDENTITÄT, BEZIEHUNGEN UND GEMEINSCHAFTEN IM INTERNET.
- Identität und Selbstdarstellung im Internet.
- Beziehungen im Internet.
- Gemeinschaften im Internet - virtuelle Gemeinschaften
- DEMOKRATISIERUNG ODER KOMMERZIALISIERUNG ?
- MEDIENKOMPETENZ
- INHALTSBEREICHE VON MEDIENKOMPETENZ.
- Dimension A: Orientierungs- und Strukturwissen.
- Dimension B: Kritische Reflexivität.
- Dimension C: Fähigkeit und Fertigkeit des Handelns.
- Dimension D: Soziale, kreative Interaktion.
- REALISATIONSMÖGLICHKEITEN.
- DIE UMSETZUNG IN DIE PRAXIS
- KURZVORSTELLUNGEN DER EINRICHTUNGEN.
- LogIn Essen.
- zakk in Düsseldorf - Café Internezzo.
- VHS-Oldenburg - Senioren im Internet.
- BAJ e. V. Bielefeld - Netcafé @ Tor 6.
- DIE METHODE DES LEITFADENINTERVIEWS.
- Persönliche Einschätzung und Stellungnahme zu den durchgeführten Interviews.
- HILFESTELLUNGEN ZUR KONZEPTION EINES INTERNETANGEBOTES
- Kompetenzen der Mitarbeiter.
- Lebenswirklichkeit des Klientels zugrunde legen.
- Unterschiedliche pädagogische Begleitformen.
- Kritische Reflexion fördern (Medienkompetenz).
- Pornographie und Gewalt im Netz.
- Vernetzung mit anderen Bereichen und Aktivitäten des Hauses.
- Der Faktor Zeit - alles braucht seine Zeit.
- Überlegungen zur Reglementierung der Nutzungszeiten.
- Aspekte der Raumgestaltung.
- BEMERKUNGEN ZU DIESEM KAPITEL
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit verfolgt das Ziel, dem Leser eine fundierte Einführung in die Thematik des Internets in der pädagogischen Arbeit zu bieten und gleichzeitig konkrete Hilfestellungen und Empfehlungen für die Konzeptionierung eines pädagogisch orientierten Internetangebotes zu liefern. Neben einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema liegt der Fokus auf der praktischen Anwendung des Internets in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen.
- Die Geschichte und Entwicklung des Internets
- Die psychologischen Aspekte von computervermittelter Kommunikation
- Identität, Beziehungen und Gemeinschaften im digitalen Raum
- Medienkompetenz und ihre Bedeutung in der digitalen Welt
- Praktische Umsetzung von Internetangeboten in der pädagogischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung des Internets in der heutigen Gesellschaft beleuchtet und die Ziele der Diplomarbeit darlegt. Anschließend wird das Internet in seiner Geschichte, seinem Aufbau und seinen vielfältigen Diensten vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich der Kommunikation im Internet und beleuchtet dabei die psychologischen Theorien zur computervermittelten Kommunikation. Es werden die Auswirkungen von Internetnutzung auf die Identität, Beziehungen und das Gemeinschaftsleben analysiert.
Kapitel 4 behandelt die Thematik der Medienkompetenz und ihre Bedeutung in der digitalen Welt. Die Arbeit geht auf verschiedene Inhaltsbereiche der Medienkompetenz ein und zeigt die Möglichkeiten ihrer Realisierung auf.
Kapitel 5 widmet sich der konkreten Umsetzung von Internetangeboten in der pädagogischen Praxis. Es werden verschiedene Einrichtungen vorgestellt und anhand von Leitfadeninterviews die Erfahrungen und Herausforderungen der Internetnutzung in diesen Einrichtungen beleuchtet.
Kapitel 6 bietet konkrete Hilfestellungen und Empfehlungen für die Konzeptionierung eines pädagogisch orientierten Internetangebotes. Es werden verschiedene Aspekte wie Kompetenzen der Mitarbeiter, Lebenswirklichkeit des Klientels, pädagogische Begleitformen, Medienkompetenz, Pornographie und Gewalt im Netz, Vernetzung, Zeitmanagement, Reglementierung der Nutzungszeiten und Raumgestaltung behandelt.
Schlüsselwörter
Internet, Pädagogik, Medienkompetenz, Computervermittelte Kommunikation, Identität, Beziehungen, Gemeinschaften, Virtuelle Welt, Digitale Medien, Pädagogisches Internetangebot, Konzeptionierung, Hilfestellungen, Empfehlungen, Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt das Internet in der pädagogischen Arbeit?
Das Internet dient als Werkzeug zur Förderung von Medienkompetenz und bietet neue Räume für Kommunikation, Identitätsbildung und soziale Interaktion.
Was sind die vier Dimensionen der Medienkompetenz?
Die Arbeit unterscheidet Orientierungswissen, kritische Reflexivität, Handlungsfähigkeit sowie soziale und kreative Interaktion.
Wie plant man ein pädagogisches Internetcafe?
Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung der Lebenswirklichkeit der Zielgruppe, die Qualifikation der Mitarbeiter, Raumgestaltung und klare Nutzungsregeln.
Welche psychologischen Folgen hat computervermittelte Kommunikation?
Analysiert werden Modelle wie das Kanalreduktionsmodell und das Herausfiltern sozialer Hinweisreize sowie deren Einfluss auf Identität und Beziehungen.
Wie geht man mit Gefahren wie Pornographie und Gewalt im Netz um?
Die Arbeit bietet konkrete Hilfestellungen zur kritischen Reflexion und zum Schutz von Jugendlichen innerhalb pädagogisch begleiteter Angebote.
- Citar trabajo
- Jörn Grevenstein (Autor), 2000, Das Internet in der Pädagogischen Arbeit - Hilfestellung zur Planung eines Internetcafes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/224