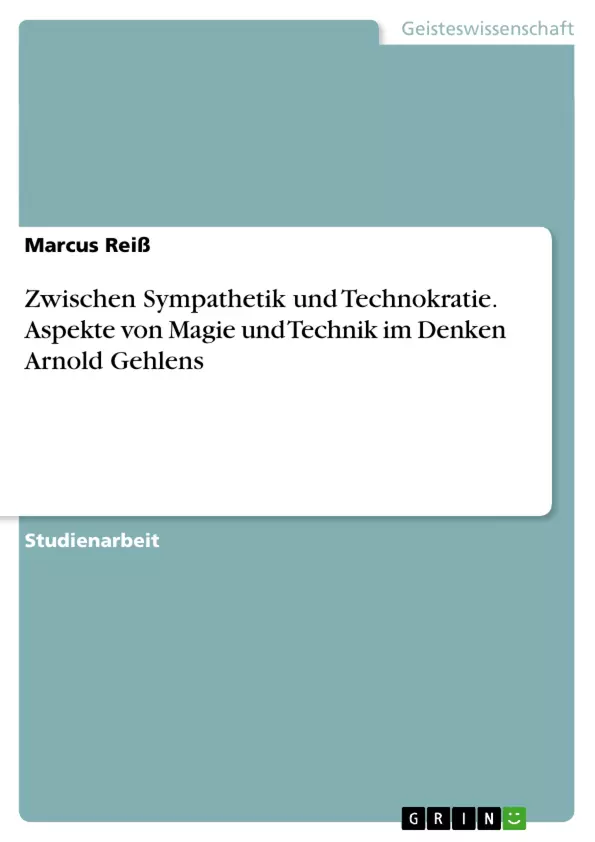Manchesmal beängstigt und des öfteren fasziniert blicken wir auf jene Vielzahl
technischer Konstrukte, die allein menschlicher Kreativität entstammen. Allzu bekannt
und dennoch fremd, bieten sie uns gerade in ihren postmodernen Ausprägungen
Bilder des Schreckens, der heimlichen Verzückung oder sie werden als notwendiges
Übel stoisch hingenommen. Die Technik begleitet den Menschen seit jeher,
hat Leben millionenfach zerstört und unzählige Male erhalten bzw. bereichert.
Mögen die Abschätzungen ihrer Geltung variieren, eine Ambivalenz ihrer Vermögen
bleibt bestehen.
Auf diese Zweideutigkeit weist auch der Anthropologe Arnold Gehlen hin1, dessen
Ausführungen dieser Arbeit ihr Gerüst verleihen werden. Sein überaus differenzierter
Zugang zur Technik, der von kulturkritischen Tönen bestimmt wird, eröffnet
sich über ihre Aspekte als Institution, die Verhaltensentlastungen ermöglicht, indem
sie Aufgaben übernimmt, erleichtert oder einspart. Thema sollen auch jene negativen
Implikationen technischer Prozesse sein, die bei Gehlen in der Behauptung von
Erfahrungsschwund, Primitivisierung und Entsinnlichung münden.
Als Superstruktur (siehe Kap. 4.3.) verstanden, zählt zur Technik auch die Wissenschaft
bzw. ihr erkenntnistheoretisches fundamentum inconcussum, die neuzeitliche
Rationalität. Letztere kann als ihren prominenten Vorläufer die Magie reklamieren,
die rationalere Züge trägt, als gemeinhin angenommen werden könnte.
Nach ersten Hinweisen und Bemerkungen zur Methodologie Gehlens fungiert eine
Skizze seiner Auffassung des Menschen als eines Mängelwesens als Ausgangspunkt
und Überleitung zu den darauf folgenden Umrissen seiner Handlungstheorie.
Da der Mensch und dessen Leben je in Institutionen eingelassen ist und
von ihnen begleitet bzw. gelenkt wird, enden die Voruntersuchungen mit knappen,
ausgesuchten Exkursen zur Institutionentheorie des Deutschen und dem Versuch
einer Sondierung der Bedeutung entlastenden Verhaltens für die menschliche Lebensführung.
Anlass für die darauf folgenden Ausführungen über die Magie ist ein kurzer Abschnitt
in „Die Seele im technischen Zeitalter“. Dort wird sie in ein nahes Verhältnis
gesetzt zur Technik und auf den Spuren dieser Beziehung wird es uns zunächst um
den historischen Aspekt der Magie gehen: [...]
1 Zu den bekanntesten Schriften des Anthropologen, Philosophen und Sozialpsychologen zählen „Der
Mensch“ (1940), „Urmensch und Spätkultur“ (1956) und auch „Die Seele im technischen Zeitalter“
(1957).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Skizzen: „Elementare Anthropologie“
- 2.1. Zur wissenschaftlichen Methode
- 2.2. Das biologische Mängelwesen
- 2.3. Handlung und Lebensführung
- 2.4. Institutionalisierte Entlastung
- 3. Magie „die kindlichste Technik“
- 3.1. Der ´entleerte' Ritus als Mittel
- 3.2. Der 'sympathetische Kosmos'
- 3.3. Stabile Umwelten
- 3.4. Magie, Technik, Wissenschaft
- 4. Aspekte der Technik
- 4.1. Zweideutigkeiten
- 4.2. Organersatz - Ersatz des Organischen
- 4.3. Qualitative Übergänge: Die Superstruktur
- 4.3.1 Entsinnlichung
- 4.3.2 Primitivisierung
- 4.4. Machbarkeit
- 5. Ausblicke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Arnold Gehlens Denken über die Beziehung zwischen Magie und Technik. Sie analysiert Gehlens kulturkritische Sicht auf die Technik, ihre Rolle als Institution und ihre negativen Auswirkungen wie Erfahrungsschwund und Primitivisierung. Die Arbeit betrachtet auch die Magie als Vorläufer der modernen Rationalität und untersucht die Verbindungen zwischen diesen beiden Konzepten.
- Gehlens methodologischer Ansatz in der philosophischen Anthropologie
- Der Mensch als Mängelwesen und die daraus resultierende Notwendigkeit von Technik und Institution
- Die Ambivalenz von Magie und Technik und ihre historische Verknüpfung
- Die negativen Folgen der Technisierung nach Gehlen (Entsinnlichung, Primitivisierung)
- Technik als Superstruktur und die Frage der Machbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die ambivalente Beziehung des Menschen zur Technik und kündigt Gehlens differenzierten Ansatz an, der die Technik als Institution mit entlastenden, aber auch negativen Implikationen betrachtet. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit: Beginnend mit Gehlens methodologischem Ansatz und seiner Anthropologie, folgt eine Auseinandersetzung mit Magie und Technik und endet mit einer Diskussion von Gehlens Überlegungen zur Technik im aktuellen Kontext. Die Einleitung betont die Zweideutigkeit der Technik und ihre historische Verknüpfung mit Magie.
2. Skizzen: „Elementare Anthropologie“: Dieses Kapitel skizziert Gehlens methodologischen Ansatz, der sich durch eine Abkehr von metaphysischen Spekulationen und eine Hinwendung zu einer naturwissenschaftlich-empirischen Untersuchung auszeichnet. Gehlen strebt eine objektive Kategorisierung des Menschen an, um dessen existentielle Weise zu erfassen, ohne den Leib-Seele-Dualismus zu verwenden. Der Fokus liegt auf den durchlaufenden Aufbaugesetzen aller menschlichen Funktionen und Leistungen, um den Unterschied zum Tier zu definieren. Das Kapitel behandelt auch Gehlens Konzept des Menschen als Mängelwesen, seine Handlungstheorie und die Bedeutung von Institutionen für die menschliche Lebensführung.
3. Magie „die kindlichste Technik“: Dieses Kapitel analysiert Gehlens Sicht auf Magie als eine frühe Form von Technik. Es untersucht den "entleerten" Ritus als Mittel zur Stabilisierung des "sympathetischen Kosmos", einer kosmologischen Ordnung, die durch rituelle Praktiken aufrechterhalten wird. Gehlen betrachtet Magie als einen Vorläufer der wissenschaftlichen Rationalität und untersucht die Verknüpfungen und Unterschiede zwischen Magie und Technik im historischen Kontext. Die Analyse beleuchtet, wie Magie und Technik zur Bewältigung der Mängel des Menschen beitragen.
4. Aspekte der Technik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Gehlens Verständnis von Technik. Es beginnt mit der Beschreibung der Zweideutigkeit der Technik, die sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist. Der Organersatz wird als ein zentrales Beispiel für die Funktion der Technik als Ausgleich der menschlichen Mängel betrachtet. Die Technik wird als Superstruktur analysiert, die zu Entsinnlichung und Primitivisierung führen kann. Schließlich wird die "Machbarkeit" als ein zentrales Telos der Wissenschaft und der Technik herausgearbeitet, das mit potentiellen Gefahren verbunden ist.
Schlüsselwörter
Arnold Gehlen, philosophische Anthropologie, Mängelwesen, Technik, Magie, Institution, Entlastung, Entsinnlichung, Primitivisierung, Machbarkeit, wissenschaftliche Methode, sympathetischer Kosmos, Superstruktur, Kulturkritik.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Gehlens Denken über Magie und Technik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Arnold Gehlens philosophisch-anthropologischen Ansatz und seine Sicht auf die Beziehung zwischen Magie und Technik. Der Fokus liegt auf Gehlens kulturkritischer Perspektive, die sowohl die positiven als auch die negativen Auswirkungen der Technisierung beleuchtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Gehlens methodologischen Ansatz, sein Konzept des Menschen als Mängelwesen, die Rolle von Institutionen, die Ambivalenz von Magie und Technik, die negativen Folgen der Technisierung (Entsinnlichung, Primitivisierung), sowie die Technik als Superstruktur und den damit verbundenen Aspekt der Machbarkeit. Im Kern geht es um die historische Verknüpfung von Magie und Technik und deren Entwicklung hin zur modernen Rationalität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Gehlens „Elementarer Anthropologie“, Magie als „kindlichste Technik“, Aspekte der Technik und einen Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte von Gehlens Denken, beginnend mit seinen methodologischen Grundlagen und seiner Anthropologie, über seine Analyse von Magie und Technik bis hin zu einer kritischen Betrachtung der Technisierung.
Was ist Gehlens methodologischer Ansatz?
Gehlen verfolgt einen naturwissenschaftlich-empirischen Ansatz, der metaphysische Spekulationen vermeidet und eine objektive Kategorisierung des Menschen anstrebt. Er konzentriert sich auf die durchlaufenden Aufbaugesetze menschlicher Funktionen und Leistungen, um den Unterschied zum Tier zu definieren.
Was versteht Gehlen unter dem „Mängelwesen“?
Gehlen beschreibt den Menschen als „Mängelwesen“, das im Gegensatz zu Tieren keine angeborenen Instinkte für alle Lebenslagen besitzt. Diese Mängel werden durch Technik und Institutionen ausgeglichen und ermöglichen die menschliche Lebensführung.
Wie betrachtet Gehlen Magie?
Gehlen sieht Magie als eine frühe Form von Technik, die zur Stabilisierung eines „sympathetischen Kosmos“ dient. Der „entleerte Ritus“ wird als Mittel zur Aufrechterhaltung dieser kosmologischen Ordnung verstanden. Magie wird als Vorläufer der wissenschaftlichen Rationalität betrachtet.
Welche negativen Folgen der Technisierung werden behandelt?
Gehlen analysiert die negativen Folgen der Technisierung kritisch. Er beschreibt die „Entsinnlichung“ und „Primitivisierung“ als mögliche Ergebnisse einer übermäßigen Technisierung, die zu einem Verlust an Erfahrung und einer Vereinfachung der menschlichen Lebenswelt führen kann.
Was versteht Gehlen unter „Technik als Superstruktur“ und „Machbarkeit“?
Die Technik wird als „Superstruktur“ verstanden, die über die unmittelbaren Bedürfnisse des Menschen hinausgeht und zu einer Entfremdung führen kann. „Machbarkeit“ bezeichnet das zentrale Telos von Wissenschaft und Technik, das mit potentiellen Gefahren verbunden ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Arnold Gehlen, philosophische Anthropologie, Mängelwesen, Technik, Magie, Institution, Entlastung, Entsinnlichung, Primitivisierung, Machbarkeit, wissenschaftliche Methode, sympathetischer Kosmos, Superstruktur, Kulturkritik.
- Citation du texte
- Marcus Reiß (Auteur), 2003, Zwischen Sympathetik und Technokratie. Aspekte von Magie und Technik im Denken Arnold Gehlens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22508